Fünf Jahre Nach Der Elbeflut
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Hochwasserforschung an Der Elbe Und Ihren Nebenflüssen
Hochwasserforschung an der Elbe und ihren Nebenflüssen Datenbankauszug aus der Umweltforschungsdatenbank UFORDAT Hochwasserforschung an der Elbe und ihren Nebenflüssen Datenbankauszug aus der Umweltforschungsdatenbank UFORDAT von Dirk Groh, Larissa Pipke, Franziska Galander UMWELTBUNDESAMT Diese Publikation ist ausschließlich als Download unter http://www.uba.de/uba-info-medien/4563.html verfügbar. Stand: Juli 2013 Herausgeber: Umweltbundesamt Wörlitzer Platz 1 06844 Dessau-Roßlau Tel.: 0340/2103-0 Telefax: 0340/2103 2285 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.umweltbundesamt.de http://fuer-mensch-und-umwelt.de/ Bearbeitung: Fachgebiet I 1.5 Nationale und Internationale Umweltberichterstattung - Sachgebiet Umweltinformationssysteme und –dienste Dirk Groh, Larissa Pipke, Franziska Galander Foto Deckblatt: © Motive, www.fotolia.com Dessau-Roßlau, August 2013 UFORDAT – Die Datenbank zur Umweltforschung http://www.umweltbundesamt.de/ufordat Inhaltsverzeichnis Die Umweltforschungsdatenbank UFORDAT ................................................................................... 6 Umweltforschung im Überblick ................................................................................................... 6 Zielgruppen und Zielsetzung ....................................................................................................... 6 Datenquellen .................................................................................................................................... 7 UFORDAT im Internet.................................................................................................................... -

Official Journal L 338 Volume 35 of the European Communities 23 November 1992
ISSN 0378 - 6978 Official Journal L 338 Volume 35 of the European Communities 23 November 1992 English edition Legislation Contents I Acts whose publication is obligatory II Acts whose publication is not obligatory Council Council Directive 92 /92/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 86/ 465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC (Federal Republic of Germany) 'New Lander* 1 Council Directive 92 /93 / EEC of 9 November 1992 amending Directive 75 /275 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268/ EEC (Netherlands) 40 Council Directive 92 / 94/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 75 / 273 /EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268/ EEC (Italy) 42 2 Acts whose titles are printed in light type are those relating to day-to-day management of agricultural matters, and are generally valid for a limited period . The titles of all other Acts are printed in bold type and preceded by an asterisk. 23 . 11 . 92 Official Journal of the European Communities No L 338 / 1 II (Acts whose publication is not obligatory) COUNCIL COUNCIL DIRECTIVE 92/92/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 86 /465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 /268 / EEC (Federal Republic of Germany ) 'New Lander' THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Commission of the areas considered eligible for inclusion -
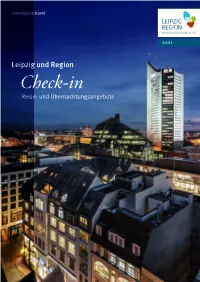
Check-In 2021 | Reise
www.leipzig.travel 2021 Leipzig und Region Check-in Reise- und Übernachtungsangebote Tageskarte 12,40 € Leipzig © & Hannot/Günther LTM/Heimrich gültig für eine Person Leipzig Card 12,40 € Tageskarte für 1 Person Day ticket for 1 person Die Leipzig Card 3-Tageskarte Freie Fahrt durch Leipzig und viele Preisvorteile © Kunstkraftwerk Leipzig, Foto: Luca Migliore Multimediale immersive Show „VAN GOGH experience“ 24,90 € Leipzig Card 24,90 € gültig für eine Person 3-Tageskarte für 1 Person an 3 aufeinander folgenden Tagen Mit der Leipzig Card haben Sie freie Fahrt mit den Ver- 3-day ticket for 1 person on 3 successive days kehrsmitteln des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes © Zoo Leipzig © Zoo Zoo Leipzig, Capybara Capybara Leipzig, Zoo 3-Tagesgruppenkarte (Zone 110) und Preisvorteile bei Stadtspaziergängen 46,40 € und Rundfahrten, freien Eintritt oder Ermäßigung Leipzig Card 46,40€ gültig für 2 Erwachsene bis zu 50 % in Museen, Preisvorteile in Restaurants, 3-Tagesgruppenkarte für 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder (unter 15 Jahren) und bis zu 3 Kinder an 3 aufeinander folgenden Tagen Geschäften, beim Souvenirkauf, Ermäßigung bei 3-day group ticket for 2 adults and up to 3 children (under 15) on 3 successive days (unter 15 Jahre) Freizeiteinrichtungen, Festivals sowie in Konzert- und Theaterhäusern. 1 Information und Verkauf: 2 Leipzig Tourismus und Marketing GmbH Tourist-Information, Katharinenstraße 8, 04109 Leipzig Tel. +49 (0)341 7104-260 sowie im LVB-Mobilitätszentrum, im LVB-Servicecenter am Wilhelm-Leuschner-Platz (Petersstraße/ Ecke Markgrafenstraße), -

„Kurregion Elbe-Heideland“
Verwaltungsgemeinschaft „Kurregion Elbe-Heideland“ Mitgliedsgemeinden: Stadt Bad Schmiedeberg, Stadt Pretzsch Gemeinden: Globig-Bleddin, Korgau, Meuro, Priesitz, Schnellin, Söllichau, Trebitz Herzlich Willkommen in Bad Schmiedeberg Sie erreichen uns: Die Touristinformation bietet Ihnen Gut beraten von telefonisch: (03 49 25) 7 11 01 folgenden Service: per Fax: (03 49 25) 7 11 03 Ingeborg Teffner per E-Mail: [email protected] ☛ Vermittlung von Übernachtungen ☛ Stadtführungen und Wanderungen durch im Internet: www.bad-schmiedeberg.de sachkundige Stadt- und Wanderführer. ☛ Vermittlung für Fahrradverleih Wir haben für Sie Tourismusinformation Bad Schmiedeberg ☛ umfangreiches Kartenmaterial für täglich geöffnet: Rehhahnweg 1 c • 06905 Bad Schmiedeberg Rad- und Wandertouren Mo. – Fr.: 10.00 – 12.00 Uhr ☛ Zusammenstellung von Tagesprogrammen und 14.00 – 18.00 Uhr Wir wünschen Ihnen einen angenehmen für Individualtouristen Sa. 09.00 – 12.00 Uhr Aufenthalt in Bad Schmiedeberg. E-mail: [email protected] • Erlebnisbad „BASSO“ www.reisebuero-sunshine-dm.de Tel. 03 49 25 / 6 94 10 mobil: 0173-3 84 20 89 • Freizeitpark Rezeption Tel. 03 49 25 / 6 94 26 Reisebüro mit 600 preiswerten Übernachtungen und vielfältigen Angeboten • Partyservice Ferienpark Tel. 03 49 25 / 6 94 14 Org. von Veranstaltungen im Inh. Doreen Meyer Kundenberatung: Bad Schmiedeberg Ferienpark und zu Hause Leipziger Straße 51 Tel.: (034925) 72840 Lindenstraße 50 Web: www.Ferienpark-Bad-Schmiedeberg.de 06905 Bad Schmiedeberg Fax: (03 49 25) 7 28 41 06905 Bad Schmiedeberg -

Leipzig New Lake Land
LEIPZIG NEW LAKELAND LAND IN MOTION 1 Maritime atmosphere at Zöbigker Marina Welcome to Leipzig New Lakeland ! By 2015, the flooding of opencast mines around the city of Leipzig in central Germany will have created nearly 70 square kilometres of new lakes – and a wealth of leisure opportunities. Visitors can already enjoy various adrenaline sports on water and on land, as well as fun and relaxation for the whole family, not to mention a wide variety of culture. Join the local Schladitz family as they discover Leipzig New Lakeland – Land in Motion. 2 Black gold Leipzig New Lakeland has a proud mining heritage. And with its industrial past still very much in evidence, there are some fascinat- ing discoveries to be made. page 4 In the pink Sports enthusiasts are always on the look-out for attractive facilities in the right surroundings for their favourite activities. They’re spoilt for choice in Leipzig New Lakeland! page 6 Green surroundings Get away from your daily routine – and get back to nature! Leipzig New Lakeland’s the place to recharge your batteries in the company of family and friends. page 8 Colourful history HierHistorical wurden spectacles Geschichten and placesgeschrie - ben.where Historische famous writers, Spektakel philosophers, und Ausflügeartists and zu composers Wirkungsstätten once lived nam - hafterand worked Dichter, make Denker Leipzig und New Künstler Lake - machenland a cultural das Leipziger treasure Neuseenland trove. zur Schatzkammer. page 10 Play the blues Art and music are part and parcel of Leipzig New Lakeland. After your days out, take in first-rate perfor- mances in the evenings. -

Lebendige Burgaue?
1 Lebendige Burgaue? Lebendige Burgaue? Das Projekt „Lebendige Luppe“ im Kontext der notwendigen Auendynamik zum Erhalt der Leipziger Burgaue Holger Seidemann Heiko Rudolf Ökolöwe - Umweltbund Leipzig e.V. 2 Inhalt Lebendige Burgaue? 1. Leitbild der Burgaue 2. aktueller Planungsstand „Lebendige Luppe“ 3. Weiterentwicklung „Lebendige Luppe“ 4. Vorgetragene Einwände gegen auendynamische Flutungen 5. Ausblick 3 1. Leitbild der Burgaue Lebendige Burgaue? Die Burgaue ist eine der wenigen, noch erhaltenen Hartholzauen von überregionaler Bedeutung mit europäischem Schutzstatus. Lebensgemeinschaft von außerordentlicher Vielfalt . Auenstandorte entwickelten sich unter dem spezifischen Einfluss von Grundwasser und Hochwasser: geringer Grundwasser-Flur-Abstand, mit starken Schwankungen häufige und unregelmäßige Überflutungen, mit wechselnder Intensität und Ausbreitung dynamischer Wechsel zwischen Überschwemmungen und längeren Trockenzeiten Leitbild einer Hartholzaue Auendynamik ist Basis und Entwicklungsziel für Erhalt der Burgaue 4 1. Leitbild der Burgaue Lebendige Burgaue? Entwicklungsziel: dynamischer Fluss ökolog. Flutung HQ1-5 MQ Ziel (dynamisch) Ist Grundwasserstand Sohlanhebung . dynamische Zufuhr von Oberflächenwasser . Sohlanhebung der Neuen Luppe dynamische Wasserverhältnisse in Oberflächen- und Grundwasser 5 1. Leitbild der Burgaue Lebendige Burgaue? Projektziel eines Auenrevitalisierungsprojekts, abgeleitet aus dem Leitbild der Burgaue: Förderung auentypischer dynamischer Wasserverhältnisse in Oberflächen- und Grundwasser 6 2. aktueller -

Zur Schneckenfauna (Mollusca: Gastropoda) Isolierter Auenwald- Fragmente Der Elster-Luppe-Aue in Sachsen-Anhalt
ISSN 0018-0637 Hercynia N. F. 35 (2002): 137–143 137 Zur Schneckenfauna (Mollusca: Gastropoda) isolierter Auenwald- fragmente der Elster-Luppe-Aue in Sachsen-Anhalt Jörg HAFERKORN 3 Abbildungen und 3 Tabellen ABSTRACT HAFERKORN, J.: Snailfauna (Mollusca: Gastropoda) of isolated floodplain forests fragments at the Elster- Luppe-floodplain in Saxony-Anhalt. – Hercynia N. F. 35: 137-143. Gastropod communities were investigated in 40 neighbouring fragmented floodplain forests with different sizes (0.04 to 20.4 ha) in Central Germany. Species numbers of land snail communities varied between 4 and 23. An increase in species richness and diversity of the land snail communities was noticed in connection with the sizes of forest fragments. Species numbers decreased with the distance to the next forest fragment with a size over 1.5 ha. KÖRNIG (2000) designate Succinea putris, Aegopinella nitidula, Balea biplicata, Fruticicola fruticum and Arianta arbustorum as the characteristic species of the floodplain forest in Central Germany. These five land snails would be shown also in subject to the size of the floodplain forests. Keywords: gastropods, land snails, floodplain forest fragments, species numbers 1 EINLEITUNG Im europäischen Maßstab gehören die Auen zu den am stärksten umgestalteten und zerstörten Land- schaftselementen. Ihre natürliche Vegetation, die ehemals großflächigen Auenwälder, die die Fließge- wässer von ihrer Quelle bis zur Mündung bandförmig begleiteten, wurde im Vergleich zu allen anderen Waldökosystemen am intensivsten reduziert. Die Auenwälder existieren gegenwärtig oft nur noch insel- förmig in der Agrarlandschaft oder in Siedlungsgebieten als kleinflächige Refugien, die von weiterer Fragmentierung bedroht sind. Dabei stellt sich die Frage, welche Mindestflächengrößen zur Ausprägung auenwaldtypischer Lebensgemeinschaften erforderlich sind. -

RADREGION Dübener Heide – Rund Geht‘S Im Biber-, Luther- Und Kneippland
RADREGION Dübener Heide – rund geht‘s im Biber-, Luther- und Kneippland m co e. eid r-h ene ueb rk-d turpa www.na Neu: APP RADREGION Naturpark Dübener Heide Mit der neuen App Fahrrad-Tourenplaner Dübener Heide sind 16 Rundtouren (20–50 km) von sieben Ausgangspunkten ausführlich beschrieben und in einer topografischen Karte im Maßstab 1:25.000 detailliert verzeichnet. Daneben sind alle relevanten Zusatzinformationen vom Radservice, über Gastronomie, Sehenswürdigkeiten bis zur Übernachtung über dieses regionale Informationssys- tem eingespielt. Die topografischen Karten zeigen sowohl den exakten Tourenverlauf wie auch die eigene Position per GPS während der Tour an. Jede Route kann inklusive Beschrei- bung, Bildern und zugehörigem Kartenausschnitt lokal auf dem iPhone gespei- chert werden. Einmal gespeichert, sind diese Inhalte auch ohne Mobilfunkver- Mockrehna bindung verfügbar. Die Radfahr-App in der frischen Waldheide-, Seen- und Flusslandschaft zwi- schen Leipzig und der Lutherstadt Wittenberg ermöglicht Ihnen stressfrei zu planen und anschließend entspannt zu genießen. Laden Sie die App hier kostenlos runter: www.naturpark-duebener-heide.com http://karte.wanderwalter.de/np-dh/ Mit der S-Bahn von Leipzig bis Torgau Radmitnahme kostenlos Mit der Regionalbahn von Leipzig bis Wittenberg Mit der Regionalbahn von Halle nach Eilenburg Mit der Regionalbahn von Halle nach Gräfenhainichen Liebe Bürger und Gäste, wir laden Sie in die Radregion Naturpark Dübener Heide ein. Eingebettet in den natürlichen Fluss- landschaften von Elbe und Mulde mit einer Seenkette im Nordwesten verströmt der größte Misch- wald Mitteldeutschlands die Frische einer eiszeitlich geprägten Hügellandschaft. Im 75.000 Hektar großen Naturpark Dübener Heide können Sie Kranich und Seeadler über roman- tischen Teichen und Seen kreisen sehen. -

Maßnahmeblatt
Umsetzungskonzept zur Realisierung Potenzieller Standorte fürxxxxxxxxl Anlage 1.4 Hochwasserpolder und Deichrückverlegungen im Land Sachsen-Anhalt Maßnahme- und Datenblätter Elbe Polder Prettin Ret_elb_03_M2_08_001 Maßnahmeblatt Lageeinordnung: Südwestlich der OL Axien, einem Ortsteil der Stadt Annaburg im Landkreis Wittenberg; rechtsseitig der Elbe von Fluss-km 177+500 bis 181+000 Überregionale Der potenzielle Polderstandort Prettin wurde im Zuge der Polderstudie 2014 als Wirksamkeit, mögliche Untervariante (südliche Erweiterung) des Polders Axien-Mauken Besonderheiten: (Ret_elb_03_M2_08_002 bis _004) untersucht. Der Standort grenzt nahezu unmittelbar an das Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung für oberflächennahe Baurohstoffe XXXI Prettin Feld B. Eine negative Beeinflussung dieses Vorranggebietes durch einen potenziellen Polder kann nicht ausgeschlossen werden. Im potenziellen Polderstandort verläuft ein Altarm der Elbe. Dieser würde durch die Polderdeiche abgeschnitten. Der potenzielle Standort wurde nicht vertiefend untersucht, so dass keine Aussagen zur möglichen Lage von Bauwerken vorliegen. Deren Darstellung entfällt deswegen. Standort ist nicht umsetzbar Sehr geringe oder keine Retentionswirkung, nicht tolerierbare Raumwiderstände und / oder immense Kosten Seite 1/22 Umsetzungskonzept zur Realisierung Potenzieller Standorte fürxxxxxxxxl Anlage 1.4 Hochwasserpolder und Deichrückverlegungen im Land Sachsen-Anhalt Maßnahme- und Datenblätter Elbe Polder Axien-Mauken Ret_elb_03_M2_08_002, _003, _004 Maßnahmeblatt Lageeinordnung: Südlich -

Verzeichnis Der Schiffbaren Gewässer
Anlage 2 (zu § 17 Abs. 2 Satz 1 und 2) Verzeichnis der schiffbaren Gewässer Nummer 1: allgemeine schiffbare Gewässer Name Gewässerart Gemeinde Beschränkung der Schifffahrt auf: Speicherbecken Knappenrode Speicherbecken Lohsa, Wittichenau Fahrgastschifffahrt, nichtmotorange- (Hoyerswerdaer Schwarzwasser) triebener und elektromotorangetrie- bener Sportbootverkehr Talsperre Kriebstein (Zschopau) Talsperre Kriebstein, Rossau, Fahrgastschifffahrt, Fährbetrieb, Mittweida nichtmotorangetriebener und elekt- romotorangetriebener Sportbootver- kehr Vereinigte Mulde Fließgewässer Wurzen/Bennewitz Fahrgastschifffahrt, Fährbetrieb, mo- (Fluss-km 114,4 bis 118,3) torangetriebener Sportbootverkehr Vereinigte Mulde Fließgewässer Grimma Fahrgastschifffahrt, Fährbetrieb, mo- (Fluss-km 135,8 bis 138,0) torangetriebener Sportbootverkehr Talsperre Pöhl; Hauptsperre bis Talsperre Pöhl, Neuensalz Fahrgastschifffahrt, nichtmotorange- Vorsperren Neuensalz und Thoßfell triebener und elektromotorangetrie- (Trieb) bener Sportbootverkehr Talsperre Bautzen (Spree) Talsperre Bautzen, Malschwitz Fahrgastschifffahrt, nichtmotorange- triebener und elektromotorangetrie- bener Sportbootverkehr Speicherbecken Lohsa I (Kleine Speicherbecken Lohsa Fahrgastschifffahrt, nichtmotorange- Spree) triebener und elektromotorangetrie- bener Sportbootverkehr Talsperre Quitzdorf (Schwarzer Talsperre Niesky, Waldhufen, Fahrgastschifffahrt, nichtmotorange- Schöps) Quizdorf am See triebener und elektromotorangetrie- bener Sportbootverkehr Lausitzer Neiße Fließgewässer Ostritz, Görlitz, -

Bericht-Alte-Luppe-09-2006.Pdf
Wiederherstellung ehemaliger Wasserläufe der Luppe Bericht Inhaltsverzeichnis Teil 1 0 Aufgabenstellung.....................................................................................................1 1. Charakterisierung des Untersuchungsraumes.....................................................7 1.1 Lage und Abgrenzung / Gewässersystem der Alten Luppe.......................................7 1.2 Naturräumliche Einordnung und Landnutzung ..........................................................9 1.3 Historische Entwicklung des Gewässersystems des Luppeflusses.........................10 1.4 Relevante bisherige und zukünftige naturschutzfachliche und wasserwirtschaftliche Planungen im nordwestlichen Auwald ..................................11 1.4.1 Naturschutzfachliche Entwicklungsplanungen ................................................11 1.4.2 Wasserbauliche und wasserwirtschaftliche Planungen ..................................12 2. Gegenwärtiger Zustand des Auwaldes und der Wasserläufe der Luppe .........17 2.1. Aktuelle Gewässersituation......................................................................................17 2.1.1 Stehende Gewässer........................................................................................17 2.1.2 Fließgewässer.................................................................................................18 2.1.2.1 Luppewildbett (Restgewässer ehemaliger Luppe – Fluss) .............................18 2.1.2.2 Zschampert .....................................................................................................19 -

Mollusca: Gastropoda) Isolierter Auenwald- Fragmente Der Elster-Luppe-Aue in Sachsen-Anhalt
©Univeritäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg ISSN 0018-0637 Hercynia N. F. 35 (2002): 137–143 137 Zur Schneckenfauna (Mollusca: Gastropoda) isolierter Auenwald- fragmente der Elster-Luppe-Aue in Sachsen-Anhalt Jörg HAFERKORN 3 Abbildungen und 3 Tabellen ABSTRACT HAFERKORN, J.: Snailfauna (Mollusca: Gastropoda) of isolated floodplain forests fragments at the Elster- Luppe-floodplain in Saxony-Anhalt. – Hercynia N. F. 35: 137-143. Gastropod communities were investigated in 40 neighbouring fragmented floodplain forests with different sizes (0.04 to 20.4 ha) in Central Germany. Species numbers of land snail communities varied between 4 and 23. An increase in species richness and diversity of the land snail communities was noticed in connection with the sizes of forest fragments. Species numbers decreased with the distance to the next forest fragment with a size over 1.5 ha. KÖRNIG (2000) designate Succinea putris, Aegopinella nitidula, Balea biplicata, Fruticicola fruticum and Arianta arbustorum as the characteristic species of the floodplain forest in Central Germany. These five land snails would be shown also in subject to the size of the floodplain forests. Keywords: gastropods, land snails, floodplain forest fragments, species numbers 1 EINLEITUNG Im europäischen Maßstab gehören die Auen zu den am stärksten umgestalteten und zerstörten Land- schaftselementen. Ihre natürliche Vegetation, die ehemals großflächigen Auenwälder, die die Fließge- wässer von ihrer Quelle bis zur Mündung bandförmig begleiteten, wurde im Vergleich zu allen anderen Waldökosystemen am intensivsten reduziert. Die Auenwälder existieren gegenwärtig oft nur noch insel- förmig in der Agrarlandschaft oder in Siedlungsgebieten als kleinflächige Refugien, die von weiterer Fragmentierung bedroht sind.