2. Programm Der Deutschen Bahn AG
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Schwerbehinderten-Mitteilungen Engagement Für Menschen Mit Handicap Bei Der Deutschen Bahn AG
Schwerbehinderten-Mitteilungen Engagement für Menschen mit Handicap bei der Deutschen Bahn AG Ausgabe 2, März 2020 Kostenlose Bahnfahrten für aktive Soldaten KSVP DB AG Soldaten in Uniform können seit dem 01. Januar 2020 alle Züge des Regional- und Fernverkehrs kostenfrei nutzen n Seit dem 01. Januar 2020 können aktive Soldaten in Uniform alle Züge der Deutschen Bahn AG im Fern- und Regionalverkehr für dienstliche und private Fahrten kostenfrei nutzen. Steffen Pietsch, Konzernschwerbehinderten- vertrauensperson der Deutschen Bahn AG, erläutert hierzu seinen Standpunkt. Schwerbehinderten-Mitteilungen, Ausgabe 2/2020 1 Fortsetzung auf Seite 4 Aus dem Inhalt IMPRESSUM Mitarbeiter mit Behinderung im Wegbereiter und Wegbegleiter Herausgeber aktiven und erweiterten der Bahn Konzernschwerbehindertenvertretung Personalbestand 3 KSVP DB AG Arbeitsfrühstück beim BEV Deutsche Bahn AG am 23.01.2020 in Bonn 8 Kostenlose Bahnfahrten Verantwortlich für den Inhalt für aktive Soldaten Steffen Pietsch, KSVP DB AG, KSVP DB AG Schwerbehindertenvertreter der Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin Soldaten in Uniform können alle DB AG Holding tagen in Erfurt Züge des Regional- und Fern- GSVP DB AG Holding [email protected] verkehrs kostenfrei nutzen 4 4. ordentl. SVP-Tagung am 04. Februar 2020 9 Gesamtredaktion, Layout, Vertrieb – verantwortlich – Geschichte der Freifahrt 5 Gesamtinklusionsverein- Joachim Hellmeister, barung unterzeichnet Wissenschaftlicher Mitarbeiter GSVP DB Fernverkehr AG Es geht auch ohne Bestehende Gesetze, Prozesse der KSVP DB -

The Climate Impacts of High-Speed Rail and Air Transportation: a Global Comparative Analysis
The Climate Impacts of High-Speed Rail and Air Transportation: A Global Comparative Analysis by Regina Ruby Lee Clewlow B.S. Computer Science, Cornell University (2001) M.Eng. Civil and Environmental Engineering, Cornell University (2002) Submitted to the Engineering Systems Division in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy at the MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY September 2012 © Regina R. L. Clewlow All rights reserved The author hereby grants to MIT permission to reproduce and to distribute publicly paper and electronic copies of this thesis document in whole or in part in any medium now known or hereafter created. Signature of Author ............................................................................................................................ Engineering Systems Division August 17, 2012 Certified by ........................................................................................................................................ Joseph M. Sussman JR East Professor of Civil and Environmental Engineering and Engineering Systems Thesis Supervisor Certified by ........................................................................................................................................ Hamsa Balakrishnan Assistant Professor of Aeronautics and Astronautics and Engineering Systems Certified by ........................................................................................................................................ Mort D. Webster Assistant Professor of -

German Rail Pass Holders Are Not Granted (“Uniform Rules Concerning the Contract Access to DB Lounges
7 McArthurGlen Designer Outlets The German Rail Pass German Rail Pass Bonuses German Rail Pass holders are entitled to a free Fashion Pass- port (10 % discount on selected brands) plus a complimentary Are you planning a trip to Germany? Are you longing to feel the Transportation: coffee specialty in the following Designer Outlets: Hamburg atmosphere of the vibrant German cities like Berlin, Munich, 1 Köln-Düsseldorf Rheinschiffahrt AG (Neumünster), Berlin (Wustermark), Salzburg/Austria, Dresden, Cologne or Hamburg or to enjoy a walk through the (KD Rhine Line) (www.k-d.de) Roermond/Netherlands, Venice (Noventa di Piave)/Italy medieval streets of Heidelberg or Rothenburg/Tauber? Do you German Rail Pass holders are granted prefer sunbathing on the beaches of the Baltic Sea or downhill 20 % reduction on boats of the 8 Designer Outlets Wolfsburg skiing in the Bavarian Alps? Do you dream of splendid castles Köln-Düsseldorfer Rheinschiffahrt AG: German Rail Pass holders will get special Designer Coupons like Neuschwanstein or Sanssouci or are you headed on a on the river Rhine between of 10% discount for 3 shops. business trip to Frankfurt, Stuttgart and Düsseldorf? Cologne and Mainz Here is our solution for all your travel plans: A German Rail on the river Moselle between City Experiences: Pass will take you comfortably and flexibly to almost any German Koblenz and Cochem Historic Highlights of Germany* destination on our rail network. Whether day or night, our trains A free CityCard or WelcomeCard in the following cities: are on time and fast – see for yourself on one of our Intercity- 2 Lake Constance Augsburg, Erfurt, Freiburg, Koblenz, Mainz, Münster, Express trains, the famous ICE high-speed services. -
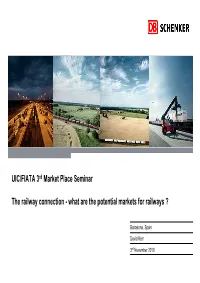
David Kerr, DB Schenker Rail
UIC/FIATA 3 rd Market Place Seminar The railway connection - what are the potential markets for railways ? Barcelona, Spain David Kerr 3rd November 2010 Today’s key points DB Schenker Rail The Railway Network Developing markets for rail 2 Deutsche Bahn A.G. is based on three strong pillars 1) DB Bahn DB Schenker DB Netze Long Distance Rail Track No. 2 Public transport Rev. (EUR m) 3,565 Rev. (EUR m) 4,055 Rev. (EUR m) 4,369 in Europe EBIT (EUR m) 141 EBIT (EUR m) -189 EBIT (EUR m) 558 Employees (,000) 15 Employees (,000) 34 Employees (,000) 40 No. 2 Passenger rail transport in Europe No. 1 European rail freight DB Bahn DB Schenker DB Netze transport Regional Logistics Stations No. 1 European land transport Rev. (EUR m) 6,856 Rev. (EUR m) 11,292 Rev. (EUR m) 1,025 No. 1 Biggest rail network EBIT (EUR m) 870 EBIT (EUR m) 199 EBIT (EUR m) 217 in Europe Employees (,000) 25 Employees (,000) 57 Employees (,000) 5 DB Bahn DB Netze DB Services Rev. (EUR bn) 29.3 StadtverkehrUrban Energy EBIT (EUR bn) 1,685 Rev. (EUR m) 1,985 Rev. (EUR m) 1,237 Rev. (EUR m) 2,308 EBIT (EUR m) 100 EBIT (EUR m) 125 EBIT (EUR m) 103 Employees (‚000.) 239 Employees (,000) 13 Employees (,000) 24 Employees (,000) 2 As of 31.12.2009, revenue as total revenue, 1 Difference between the sum of the business units and DB Group result from other activities/consolidation DB ML AG, Communication Transportation and Logistics (GKL) 3 DB Schenker Rail has consistently expanded its rail freight network along the main corridors DB Schenker’s rail freight network Acquisitions NL -

German Rail Pass 2015 (Validity: 01 Jan – 31 Dec 15)
German Rail Pass 2015 (Validity: 01 Jan – 31 Dec 15) Features Unlimited travel on trains operated by Deutsche Bahn (DB) on the national rail network of Germany, inclusive of Salzburg (Austria) and Basel Bad Bf (Switzerland). Not valid on DB Autozug and DB Urlaubsexpress (UEX) 1st & 2nd class available German Rail Pass Flexi / German Rail Pass Consecutive German Rail Pass Extension is included in all German Rail Passes German Rail Pass Extension allows travel on the following routes: Brussels to Germany on ICE routes Kufstein and Innsbruck (Austria) on DB-OBB Eurocity trains Bolzano, Verona, Bologna and Venice (Italy) on DB-OBB Eurocity Trains Prague from Munich and Nuremberg on DB IC Bus services Krakow from Berlin on DB IC bus services Twin formula : for 2 adults traveling together at all times Youth formula : for traveler from 12 up to 25 included on the first day of travel (price per person, in €€€) Adult Twin Youth 1st class 2nd class 1st class 2nd class 1st class 2nd class German Rail Pass Flexi 3d w/in 1m 255 189 191.5 142 204 151 4d w/in 1m 274 203 205.5 152.5 219 162 5d w/in 1m 293 217 219.5 163 234 174 7d w/in 1m 363 269 272.5 202 291 215 10d w/in 1m 466 345 349.5 259 373 276 German Rail Pass Consecutive 5 consecutive days 285 211 427 317 228 169 10 consecutive days 413 306 620 459 330 245 15 consecutive days 571 423 857 635 457 338 Children’s rules: 1. -

Competition Figures
2017 Competition figures Publishing details Deutsche Bahn AG Economic, Political & Regulatory Affairs Potsdamer Platz 2 10785 Berlin No liability for errors or omissions Last modified: May 2018 www.deutschebahn.com/en/group/ competition year's level. For DB's rail network, the result of these trends was a slight 0.5% increase in operating performance. The numerous competitors, who are now well established in the market, once again accounted for a considerable share of this. Forecasts anticipate a further increase in traffic over the coming years. To accommodate this growth while making a substantial contribution to saving the environment and protecting the climate, DB is investing heavily in a Dear readers, modernised and digitalised rail net- work. Combined with the rail pact that The strong economic growth in 2017 we are working toward with the Federal gave transport markets in Germany and Government, this will create a positive Europe a successful year, with excellent competitive environment for the rail- performance in passenger and freight ways so that they can help tackle the sectors alike. Rail was the fastest- transport volumes of tomorrow with growing mode of passenger transport high-capacity, energy-efficient, in Germany. Rising passenger numbers high-quality services. in regional, local and long distance transport led to substantial growth in Sincerely, transport volume. In the freight mar- ket, meanwhile, only road haulage was able to capitalise on rising demand. Among rail freight companies, the volume sold remained at the -

Eighth Annual Market Monitoring Working Document March 2020
Eighth Annual Market Monitoring Working Document March 2020 List of contents List of country abbreviations and regulatory bodies .................................................. 6 List of figures ............................................................................................................ 7 1. Introduction .............................................................................................. 9 2. Network characteristics of the railway market ........................................ 11 2.1. Total route length ..................................................................................................... 12 2.2. Electrified route length ............................................................................................. 12 2.3. High-speed route length ........................................................................................... 13 2.4. Main infrastructure manager’s share of route length .............................................. 14 2.5. Network usage intensity ........................................................................................... 15 3. Track access charges paid by railway undertakings for the Minimum Access Package .................................................................................................. 17 4. Railway undertakings and global rail traffic ............................................. 23 4.1. Railway undertakings ................................................................................................ 24 4.2. Total rail traffic ......................................................................................................... -
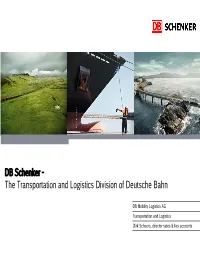
DB Schenker - the Transportation and Logistics Division of Deutsche Bahn
DB Schenker - The Transportation and Logistics Division of Deutsche Bahn DB Mobility Logistics AG Transportation and Logistics Dirk Scheers, director sales & key accounts Agenda1 Transportation and Logistics division DB Schenker Logistics DB Schenker Rail 2020 Strategy NGe S Next Generati on E services DB Schenker Belgium Overview of revenues, EBIT and employees of DB and its business units 2014 Revenues 2014 (m € ) EBIT 2014 (m €) Employees 2014 [fte2] DB Bahn Long Distance 4,034 212 16,461 DB Bahn Regional 8,831 843 36,605 DB Arriva 4,,9491 265 45,712 DB Schenker Rail 4,863 46 30,842 DB Schenker Logistics 14,943 332 64,810 DB Netze Track 4,951 562 43,382 DB Netze Stations 1,172 240 4,867 DB Netze Energy 2, 797 55 1, 770 DB Services 3,172 82 25,476 1 39,720 2,109 295,763 As of December 31, 2014; 1 Difference between total for divisions and DB Group due to other activities/consolidation (revenues, EBIT) and other (employees); 2 full time equivalent A rail freight company operating in Germany has become a ggplobal transportation and lo ggpgistics group Until 2001 Today National Global transportation and logistics rail freight network network Acquisitions, organic growth 19.8 EUR bn1 revenue Solutions along the whole 3.5 EUR bn revenue logistics chain Rail freight network Global network with intermodal Primarily national services services 1 As of 31.12.2014 DB Schenker Logistics offers global transport and logistics solutions – onshore, by sea and in the air DB Schenker Logistics Employees: 64, 051 Revenues (EUR): 14.9 bn EBIT (EUR): 335 -

ERT-Newslines-Sep-2011
NEWSLINES What's new this month With winter fast approaching, this is the time of year when we start to and 323 after that date will be found on page 237. However, include advance versions of selected International tables valid from the passengers travelling between September 19 and 24 are advised to December timetable change. These will be found in our Winter check locally before travelling. International Supplement on pages 571 to 591, valid from December The new timetable from December 11 will see significant changes, 11. Asummary of the principal changes will be found on page 337. notably in the Dijon area with the opening of the Rhin-Rhoà ne high- With the opening of the Rhin-Rhoà ne high-speed line on that date, we speed line linking Dijon with Mulhouse. There will be two new stations have also included on page 591 the full Paris - Dijon - BesancË on - on the high-speed line, BesancË on Franche-Comte TGV, and Belfort Basel - ZuÈ rich timetable (Table 370) from December 11, when Montbe liard TGV. The former will have a shuttle rail service to the passengers for Mulhouse, Basel and ZuÈ rich will switch to using Paris existing BesancË on station (BesancË on Viotte) taking around 15 minutes. Gare de Lyon instead of Paris Est station. Table 370 will be extended to show the TGV service from Paris Gare Last month we expanded the European Rail Timetable by 32 pages de Lyon via Dijon through to Basel and ZuÈ rich, and an advance version and started to include a new 12-page Beyond Europe section, of this table valid from December 11 will be found on page 591. -
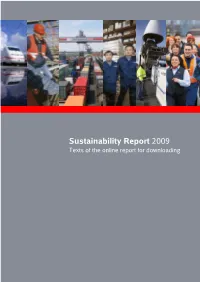
Sustainability Report 2009 Texts of the Online Report for Downloading
Sustainability Report 2009 Texts of the online report for downloading 1 Note: These are the texts of the Sustainability Report 2009, which are being made available in this file for archival purposes. The Sustainability Report was designed for an Internet presentation. Thus, for example, related links are shown only on the Internet in order to ensure that the report can be kept up-to-date over the next two years until the next report is due. Where appropriate, graphics are offered on the Internet in better quality than in this document in order to reduce the size of the file downloaded. 2 Table of Contents 1 Our company 6 1.1 Preface .................................................................................................................................... 6 1.2 Corporate Culture................................................................................................................... 7 1.2.1 Confidence..................................................................................................................................... 7 1.2.2 Values ............................................................................................................................................ 8 1.2.3 Dialog ........................................................................................................................................... 10 1.2.3.1 Stakeholder dialogs 10 1.2.3.2 Memberships 12 1.2.3.3 Environmental dialog 14 1.3 Strategy ................................................................................................................................ -

IRG-Rail (14) 2A - Annexes to the Annual Market Monitoring Report
Independent Regulators’ Group – Rail IRG–Rail Annexes to the 2nd IRG-Rail Annual Market Monitoring Report 27 February 2014 IRG-Rail (14) 2a - Annexes to the Annual Market Monitoring Report Index 1. Country sheets market structure.................................................................................2 2. Common list of definitions and indicators .................................................................11 3. Graphs not used in the report...................................................................................14 1 IRG-Rail (14) 2a - Annexes to the Annual Market Monitoring Report 1. Country sheets market structure Regulatory Authority: Schienen-Control GmbH Country: Austria Date of legal liberalisation of : Freight railway market: 9 January 1998. Passenger railway market: 9 January 1998. Date of entry of first new entrant into market: Freight: 1 April 2001. Passenger: 14 December 2003. Ownership structure Freight RCA: 100% public Lokomotion: 30% DB Schenker, 70% various institutions with public ownership WLC: 100% public LTE: 100% public (was 50% private, new partner to be announced soon) Logserv: 100% private TXL: 100% public (Trenitalia) GySEV: 93.8% public SLB, STB, GKB, MBS: 100% public RTS: 100% private RPS: 100% private Passenger ÖBB PV 100% public WLB, GKB, StLB, MBS, StH, SLB: 100% public CAT: 49.9% ÖBB PV, 50.1% Vienna Airport (public majority) WESTbahn: 74% private, 26% public (SNCF Voyages) Regulatory Authority: Rail Market Regulatory Agency Country: Croatia Date of legal liberalisation of : Freight railway market: 1 January 2005. Passenger railway market: 1 January 2005. Date of entry of first new entrant into market: Freight: no new entrant. Passenger: no new entrant. Ownership structure Freight 100% public Passenger 100% public 2 IRG-Rail (14) 2a - Annexes to the Annual Market Monitoring Report Regulatory Authority: Danish Rail Regulatory Body Country: Denmark Date of legal liberalisation of : Freight railway market: Beginning June 27th 1997. -

Deutsche Bahn Im Verfolgungswahn Fahrgasterlebnisse Bei Fahrscheinkontrollen
Thema Deutsche Bahn im Verfolgungswahn Fahrgasterlebnisse bei Fahrscheinkontrollen Keine Beratung – kein Verkauf: Realität auf den Bahnsteigen. Wer damit nicht zurechtkommt, wird von der DB als Schwarzfahrer verfolgt. ➢ Die Berichte von Fahrgästen über unberechtigte Personalien wurden aufgenommen. Frage: Warum werde ich und unangemessene Reaktionen von Zugbegleitern kriminalisiert, wenn die DB Personal spart und ich gleichzeitig und Kontrollpersonal der Deutschen Bahn AG häufen die Funktion des Verkäufers übernehmen muss und ich damit sich, seitdem die DB in vielen Bundesländern den nicht zurecht komme? Fahrscheinverkauf in den Regionalzügen eingestellt Maria S. aus S. (Bayern) am 15.05.2007 hat. Es sind keine Einzelfälle mehr, die auf „mensch- liches Versagen“ oder auf ein unglückliches Zusam- $! Fahrscheinkauf oft unmöglich mentreffen verschiedener Vorstellungen von Fahr- gästen und Personal zurückzuführen sind. Es sieht Seitdem der Fahrscheinverkauf in bayerischen Regionalzügen alles danach aus, als gäben die Mitarbeiter der DB eingestellt wurde, ärgere ich mich bei fast jeder Fahrt. Ich den Druck, dem sie selbst vonseiten der Unterneh- selber bin glücklicherweise bis jetzt nicht betroffen gewesen, mensführung der DB ausgesetzt sind, an die Fahr- beobachte aber häufig, wie unfreundlich andere Fahrgäste gäste weiter. Wir lassen Betroffene, die sich in behandelt werden und wie leicht man aus Versehen oder der Regel über den PRO BAHN-Kummerkasten Unwissen in die Situation gerät, ohne gültigen Fahrschein (www.pro-bahn.de/meinung) gemeldet haben, dazustehen. zu Wort kommen. Eine häufige Beobachtung: Gelegenheitsfahrgäste benutzen manchmal versehentlich ein Bayernticket vor 9 Uhr. In der Vergangenheit wurde in solchen Fällen einfach noch ein l# Warum werde ich kriminalisiert? Zusatzfahrschein verkauft, um die Zeit bis 9 Uhr abzudecken.