Zusammenfassung Der Ergebnisse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Continuous Modelling Approach for Design Flood Estimation on Sub-Daily Time Scale
Hydrological Sciences Journal ISSN: 0262-6667 (Print) 2150-3435 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/thsj20 A continuous modelling approach for design flood estimation on sub-daily time scale B. Winter, K. Schneeberger, N.V. Dung, M. Huttenlau, S. Achleitner, J. Stötter, B. Merz & S. Vorogushyn To cite this article: B. Winter, K. Schneeberger, N.V. Dung, M. Huttenlau, S. Achleitner, J. Stötter, B. Merz & S. Vorogushyn (2019) A continuous modelling approach for design flood estimation on sub-daily time scale, Hydrological Sciences Journal, 64:5, 539-554, DOI: 10.1080/02626667.2019.1593419 To link to this article: https://doi.org/10.1080/02626667.2019.1593419 © 2019 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group. Accepted author version posted online: 25 Mar 2019. Published online: 08 Apr 2019. Submit your article to this journal Article views: 1681 View related articles View Crossmark data Citing articles: 3 View citing articles Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=thsj20 HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL 2019, VOL. 64, NO. 5, 539–554 https://doi.org/10.1080/02626667.2019.1593419 A continuous modelling approach for design flood estimation on sub-daily time scale B. Winter a,b, K. Schneeberger a,b, N.V. Dungc, M. Huttenlaud, S. Achleitnere, J. Stöttera, B. Merz c,f and S. Vorogushyn c aInstitute of Geography, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria; balpS GmbH, Innsbruck, Austria; cSection Hydrology, GFZ German Research Centre for Geosciences, Potsdam, Germany; dILF Consulting Engineers Austria GmbH, Innsbruck, Austria; eUnit of Hydraulic Engineering, Department of Infrastructure Engineering, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria; fInstitute of Earth and Environmental Science, University of Potsdam, Potsdam, German ABSTRACT ARTICLE HISTORY Design flood estimation is an essential part of flood risk assessment. -

Wasser in Vorarlberg
Wasser in Vorarlberg Wissenswertes über den wertvollsten Bodenschatz des Landes Die wichtigsten Zahlen und Fakten Vorwort Vorarlberg verfügt mit seinem Wasserreichtum über einen sehr wichtigen Bodenschatz. Wir erleben Wasser als Regen oder Schnee, in den Gebirgsbächen, Flüssen oder im Bodensee. Wasser ist aber auch Lebensraum für unzählige Pflanzen und Tiere. Wir nutzen das „Lebens-Mittel“ Wasser darüber hinaus zum Trinken und Waschen – und als Energielieferant: Strom aus Wasserkraft ist eine wichtige erneuerbare Energiequelle. Gleichzeitig tragen wir eine besondere Verantwortung, dieses kostbare Gut vor Verunreinigungen zu schützen und nachhaltig zu bewirtschaften – beispielsweise mit dem Vorarlberger Trinkwasservorsorgekonzept. Wir müssen uns aber auch vor den Gefahren des Wassers schützen. Wasser als Lebensraum zu erhalten oder auch wieder herzustellen, ist eine weitere wichtige Herausforderung. Haben Sie gewusst, dass es in Bregenz mehr als doppelt so viel regnet wie in London? Dass auf einem Quadratmeter Gewässersohle bis zu 200.000 Organismen leben? Oder dass wir in Vorarlberg ein Netz von ca. 3.600 Kilometer Wasser- leitungen haben und der tägliche Pro-Kopf-Wasserverbrauch 130 Liter beträgt? Mit dieser aktualisierten Broschüre wollen wir unserer Bevölkerung die wichtigsten Informationen zum Thema Wasser in Vorarlberg näherbringen. Sie soll zudem zum bewussten und sorgsamen Umgang mit unserem Wasser beitragen. Landeshauptmann Landesrat Mag. Markus Wallner Christian Gantner H20 und mehr Was ist Wasser? Wasser ist eine chemische Verbindung aus den Elementen Sauerstoff (O) und Wasserstoff (H). Es ist der einzige bekannte Stoff, der in der Natur in nennenswerten Mengen in allen drei klassischen Aggregatzuständen2 existiert. Die Bezeichnung Wasser wird besonders für den flüssigen Zustand verwendet. Im festen, also gefrorenen Zustand, wird es Eis genannt, im gasförmigen Zustand Wasserdampf, oder einfach nur Dampf. -

GZÜV Bericht 2016.Pdf (0.1
GZÜV Fließgewässer 2016 Auswertung gemäß Qualitätszielverordnung Ökologie Oberflächengewässer allgemein physikalisch-chemische Parameter Temperatur O2 -Sättigung pH BSB5 DOC PO4-P NO3-N Chlorid 98% Perzentil 80 - 120% 6 - 9 90% Perzentil 90% Perzentil 90% Perzentil 90% Perzentil Mittelwert Alter Rhein / Höchst sehr gut eingehalten eingehalten sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut eingehalten Bregenzerach / Bregenz sehr gut eingehalten eingehalten sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut eingehalten Breitach / uh. Schwarzwasserbach sehr gut eingehalten eingehalten sehr gut sehr gut gut sehr gut eingehalten Dornbirnerach / Lauterach sehr gut eingehalten eingehalten sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut eingehalten Frutz / Bad Laterns sehr gut eingehalten eingehalten sehr gut sehr gut gut sehr gut eingehalten Ill / Feldkirch sehr gut eingehalten eingehalten sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut eingehalten Leiblach / Hörbranz sehr gut eingehalten eingehalten sehr gut gut gut sehr gut eingehalten Neuer Rhein / Fußach sehr gut eingehalten eingehalten sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut eingehalten Leiblach / oh. Rickenbach sehr gut eingehalten eingehalten sehr gut gut gut sehr gut eingehalten Lauterach / Hard Bommen sehr gut nicht eingehalten eingehalten sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut eingehalten Rotach / oh. Kesselbach sehr gut eingehalten eingehalten sehr gut gut nicht gut sehr gut eingehalten Rotach / oh. Wehr gut eingehalten eingehalten sehr gut gut nicht gut sehr gut eingehalten Rotach / uh. ARA Rotachtal gut eingehalten eingehalten sehr gut gut nicht gut sehr gut eingehalten Auswertung gemäß Qualitätszielverordnung Chemie Oberflächengewässer Schadstoffe Zeichenerklärung: NH4-N NO2-N Temperatur…Wassertemperatur Mittelwert Mittelwert O2-Sättigung…Sauerstoffsättigung pH…pH-Wert Alter Rhein / Höchst eingehalten eingehalten BSB5…biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen Bregenzerach / Bregenz eingehalten eingehalten DOC…gelöster organisch gebundener Kohlenstoff Breitach / uh. -

Bericht Morphologie Und Geschiebehaushalt Am Alpenrhein
Internationale Regierungskommission Alpenrhein Projektgruppe Flussbau Morphologie und Geschiebehaus- halt Alpenrhein Zusammenfassender Bericht über die Untersuchungen zwischen 1985 und 2000 Kiesbank bei Balzers (km 38) Projekt Nr. A-108 Aarau und Domat/Ems, November 2001 Adresse Auftraggeber Adresse Auftragnehmer Internationale Regierungskommission Hunziker, Zarn & Partner AG Alpenrhein Ingenieurbüro für Fluss- und Wasserbau Projektgruppe Flussbau Via Flucs 10 Lämmlisbrunnenstrasse 54 7013 Domat/Ems 9001 St. Gallen Kontaktperson: Leo Kalt Kontaktperson: Dr. Benno Zarn Telefon: +41 (0)71 229 21 00 Telefon: +41 (0)81 630 36 18 Fax: +41 (0)71 229 21 35 Fax: +41 (0)81 630 36 19 Mail: [email protected] Mail: [email protected] Morphologie und Geschiebehaushalt Alpenrhein Vorbemerkung Eine erster Bericht über die Morphologie und den Geschiebehaushalt des Alpenrheins, welcher die Untersuchungen zwischen 1991 und 1997 zusam- menfasst, erschien im April 1998 auf Initiative der Kantone St. Gallen und Graubünden. Im Rahmen der laufenden Untersuchungen am Alpenrhein wurde dieser erste Bericht mit neuen Erkenntnissen aktualisiert. Der vorlie- gende Bericht vom November 2001 ersetzt den Bericht vom April 1998. Zusammenfassung Mit den am Alpenrhein ausgeführten Korrektionsmassnahmen sollte die Hochwassersicherheit erhöht und ein stabiles Längenprofil erreicht werden. Verschiedene aktuelle Studien über den Alpenrhein zeigen, dass die Abflusskapazität zwar markant zunahm, das Längenprofil aber nicht stabil ist: Der Alpenrhein ist nicht im Gleichgewicht. Auf Strecken, welche sich zwischen 1974 und 1995 eintieften, folgen Strecken mit Auflandungen. Nummerische Simulationen zeigen, dass auch in Zukunft mit grösseren Soh- lenveränderungen gerechnet werden muss. Für die Stabilisierung des Flussbettes sind folgende Massnahmen denkbar: (1) Veränderung des Geschiebeeintrages aus den Zuflüssen, (2) Block- rampen, (3) Veränderung der Flussbreite und (4) Kiesentnahmen. -

Ökologische Funktionsfähigkeit Der Fließgewässer Des Ill-Frutz-Schwemmfächers Von Thomas Spindler
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Vorarlberger Naturschau - Forschen und Entdecken Jahr/Year: 1996 Band/Volume: 2 Autor(en)/Author(s): Spindler Thomas Artikel/Article: Ökologische Funktionsfähigkeit der Fliessgewässer des Ill- Frutz-Schwemmfächers. 39-82 ©inatura Dornbirn, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Ökologische Funktionsfähigkeit der Fließgewässer des Ill-Frutz-Schwemmfächers von Thomas Spindler VORARLBERGER Zum Autor NATURSCHAU Geboren 1961, Studium Zoologie an der Universität Wien, Dissertation zum 2 Thema Jungfischökologie der freien Fließstrecke der Donau unterhalb Wiens. SEITE 39-82 Promotion im Februar 1989 und Gründung eines Konsulentenbüros für Fischerei Dornbirn 1996 und Gewässerökologie. Schwerpunkt der Tätigkeiten auf Fischereimanagement, angewandte Forschung, ökologische Bewertung von Fließgewässern sowie Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit geplanter Gewässereingriffe. Abstract This study follows a concept for an integrated ecological evaluation of running waters within the alluvial rubble system formed by the rivers III, Frutz and Rhine in the most western part of Austria. The assessment of the ecological water quality is, according to the new ÖNORM M 6232, based on the analyses of hydrological, morphological, ichthyological, biological, saprobiological and hydrochemical parameters and was done for the first time in Austria. The results draw a rather sad picture of the actual ecological situation. All investigated brooks, streams and rivers are concerned to be noticably damaged, some of them, especially the larger ones, or at least parts of them, are heavily damaged. The most serious anthropogenius influences are regarded to be the changes of the hydrological regimes due to intensive generation of hydroelectric power in the watershed. This is leading to very strong daily fluctuations of water- levels in the order of one year's high waters. -

Zur Hydrogeologie Des Rheintals Zwischen Iiifächer Und Diepoldsauer Rheinschlinge, Der Talränder Und Des Freschengebietes
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Archiv für Lagerstättenforschung der Geologischen Bundesanstalt Jahr/Year: 1991 Band/Volume: 13 Autor(en)/Author(s): Oberhauser Rudolf Artikel/Article: Zur Hydrogeologie des Rheintals zwischen Illfächer und Diepoldsauer Rheinschlinge, der Talränder und des Freschengebietes 101-110 ©Geol. Bundesanstalt, Wien; download unter www.geologie.ac.at Arch. f. Lagerst.forsch. Geol. B.-A. ISSN 0253-097X S.101-110 Wien, Juni 1991 Zur Hydrogeologie des Rheintals zwischen IIIfächer und Diepoldsauer Rheinschlinge, der Talränder und des Freschengebietes Von RUDOLF OBERHAUSER*) Mit 2 Abbildungen und 1 Tafel (Beilage) Vorarlberg Österreichische KarteI: 50.000 Rheintal Blätter 110, 111, 141, 142 Hydrogeologie Inhalt Zusammenfassung 101 Abstract 101 1. Übersicht 101 2. Vom Laternser Tal über die Valdunafurche zum IlImündungsbereich 102 3. Vom Hörnlegrat zwischen Hoher Kugel und Hohem Freschen übers Vorderland zur Frutzmündung und über den Blattenberg in Richtung Kamor 106 4. Von Schuttannen - Fluher Eck nach Hohenems und Götzis und über die Inselberge zum Semelen- und Chienberg . 106 5. Von Emsrütti und den Klienfelsen über Altach zum linksrheinischen Talrand zwischen Kobelwies und Altstätten 107 6. Das Hintere MeIlental und das Hintere Dornbirner Ach-Tal 108 7. Ausblick 108 Literatur 108 Zusammenfassung Die Trink- und Nutzwassergewinnung wird in immer größerem Umfang auf 111- und Rheinbegleitgrundwässer ausgerichtet. Daneben sollten Talrandwässer, die aus Karstgebieten gespeist werden, und Schuttquellen im Gebirge mehr beachtet werden. Auf Möglichkeiten einer Gewinnung von mineralisiertem Thermalwasser aus dem Rheintaluntergrund wird verwiesen. Hydrogeological Observations in the Rhine Valley Between the Mouth of the River '" and Diepoldsau, on the Valley Slopes and in the Freschen Area Abstract The main sources of drinking water are the groundwater flows beside the rivers III and Rhine. -

Case Study Rhine
International Commission for the Hydrology of the Rhine Basin Erosion, Transport and Deposition of Sediment - Case Study Rhine - Edited by: Manfred Spreafico Christoph Lehmann National coordinators: Alessandro Grasso, Switzerland Emil Gölz, Germany Wilfried ten Brinke, The Netherlands With contributions from: Jos Brils Martin Keller Emiel van Velzen Schälchli, Abegg & Hunzinger Hunziker, Zarn & Partner Contribution to the International Sediment Initiative of UNESCO/IHP Report no II-20 of the CHR International Commission for the Hydrology of the Rhine Basin Erosion, Transport and Deposition of Sediment - Case Study Rhine - Edited by: Manfred Spreafico Christoph Lehmann National coordinators: Alessandro Grasso, Switzerland Emil Gölz, Germany Wilfried ten Brinke, The Netherlands With contributions from: Jos Brils Martin Keller Emiel van Velzen Schälchli, Abegg & Hunzinger Hunziker, Zarn & Partner Contribution to the International Sediment Initiative of UNESCO/IHP Report no II-20 of the CHR © 2009, KHR/CHR ISBN 978-90-70980-34-4 Preface „Erosion, transport and deposition of sediment“ Case Study Rhine ________________________________________ Erosion, transport and deposition of sediment have significant economic, environmental and social impacts in large river basins. The International Sediment Initiative (ISI) of UNESCO provides with its projects an important contribution to sustainable sediment and water management in river basins. With the processing of exemplary case studies from large river basins good examples of sediment management prac- tices have been prepared and successful strategies and procedures will be made accessible to experts from other river basins. The CHR produced the “Case Study Rhine” in the framework of ISI. Sediment experts of the Rhine riparian states of Switzerland, Austria, Germany and The Netherlands have implemented their experiences in this publication. -

Water Management in Vorarlberg, in Alpine Rhine and Lake Constance Basin
Skadar/Shkodra Lake Commission 17.11.2009 Water management in Vorarlberg, in Alpine Rhine and Lake Constance basin Thomas Blank State governement of Vorarlberg Unit for water management Vorarlberg, Lake Constance, Alpine Rhine Rheinspitz Rohrspitz Rheinmündung BregenzThomas Blank, Unit for water management 1 Content 1 Water management in Vorarlberg 2 International water management in the basin of Lake Constance 3 Alpine Rhine -International water management 4 International Commission for the Protection of Lake Constance IGKB 5 EU water framework directive Thomas Blank, Unit for water management Catchment areas in Europe Thomas Blank, Unit for water management 2 Rhine basin Thomas Blank, Unit for water management River-basins of Vorarlberg Thomas Blank, Unit for water management 3 Amount of water in Vorarlberg Precepitation/year: 1900 mm „Burgenland“ „Vorarlberg“ „Burgenland“Quelle: Wasserland Bayern, Bayer. Staatsministe rium f ü r Landesentwicklung „V undorarlberg“ Umweltfragen Quelle: Wasserland Bayern, Bayer. Staatsministerium f ür Landesentwicklung und Umweltfragen Thomas Blank, Unit for water management Water-balance of Vorarlberg Water-supply: 1 % of precepitation Verbrauch 5 Werte in Mio m³/Jahr Thomas Blank, Unit for water management 4 Monitoring Surface water monitoring Legaly binding program for quality an quantity (precipitation, discharge) Thomas Blank, Unit for water management Monitoring Groundwater monitoring Legaly binding program for quality an quantity Thomas Blank, Unit for water management 5 Water-supply 70 % Groundwater -

Vorarlberg Flüsse Überblick Ó
Vorarlberg Flüsse Überblick Ówww.mein-lernen.at Flüsse in Vorarlberg: Vorarlberg wird bis auf wenige Ausnahmen durch den Rhein, im oberen Flusslauf auch Alpenrhein genannt, entwässert. Entweder münden die Flüsse direkt in den Rhein (z.B. Ill) oder sie münden in den Bodensee, dessen Abfluss wiederum der Rhein darstellt. Abb. Fluss Ill bei Feldkirch Die einzigen Ausnahmen stellen der Fluss Lech im Arlberggebiet und die Breitach im Kleinwalsertal dar. Beide münden in die Donau und damit in weiterer Folge im Schwarzen Meer. Rhein: Der Rhein ist der Hauptfluss und Namensgeber des Vorarlberger Rheintals, in welchem fast die Hälfte der Vorarlberger Bevölkerung (ca. 180.000) lebt. Der 1233 Kilometer lange Fluss hat seine Mündung in der Nordsee und sein Quellgebiet liegt im Schweizer Kanton Graubünden. Er bildet bei seinem Verlauf in Vorarlberg über weite Strecke die Grenze zur Schweiz. Aufgrund immer wieder auftretenden schweren Überschwemmungen wurde der Rhein mit dem Fußacher Durchstich (1900) und dem Diepoldsauer Durchstich (1923) begradigt. Deshalb gibt es heutzutage einen Alten Rhein (ursprünglicher Flussverlauf) und einen Neuen Rhein (regulierter Flussverlauf). Im Vorarlberger Gebiet mündet der Rhein in den Bodensee, von dem er bei Konstanz in Deutschland (Konstanzer Rinne) wieder abfließt. Vorarlberg Flüsse Überblick Ówww.mein-lernen.at Ill: Die Ill ist mit einer Länge von ca. 75 km, der längste Fluss, der vollständig durch Vorarlberg fließt. Sie entspringt am Fuße des Piz Buins, dem höchsten Berg von Vorarlberg, aus dem Schmelzwasser des Ochsentaler Gletschers in der Silvretta. Danach fließt die Ill durch das gesamte Montafon und den Walgau, bevor sie bei Meiningen im Illspitz in den Rhein mündet. -
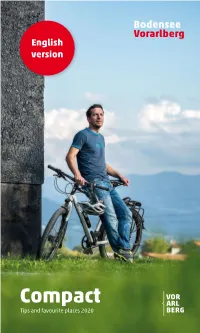
Compact Tips and Favourite Places 2020 U2 U3 U4
English version Compact Tips and favourite places 2020 U2 U3 U4 The most beautiful Information about the Network of cycle paths Ravensburg excursions with one card Bodensee-Vorarlberg Bodensee-Vorarlberg Meersburg Mainau Discover the diversity of the region – in summer, winter, autumn Leisure Card Ill-Rhein Route Gaißau-Dornbirn Route Friedrichshafen and spring! The region of Bodensee-Vorarlberg has so much to Villages-cities Route Leiblachtal Route Stein a. Rhein offer the whole year long. Bregenzerwald Route Lake Constance Cycle Route Validity and price Konstanz 1-day card ............................................................... €16 Signposted cycle tours This card is your easy access to the whole region, from Bregenz to 2-day card ............................................................... €25 Nenzing. The Bodensee-Vorarlberg Leisure Card paves the way for 3-day card ................................................................ €32 the best excursions in the region, is your bus and train ticket, and Hohenweiler Children and young people (6-15 years) each pay half. grants you discounts with bonus partners. You can visit any of the Children aged up to 5 years go free provided they are Lindau attractions several times: however, no more than once per day. accompanied by an adult. 6 Price advantage The Bodensee-Vorarlberg Leisure Card pays off as soon as you Rorschach Bregenz have visited just two attractions. 1 Hard 2 Example: visits to the Karren in Dornbirn and the vorarlberg 1 Kennelbach Gaißau Fußach 3 museum Bregenz together normally cost €20.70 – with the 5 1 Lauterach Bodensee-Vorarlberg Leisure Card, you can visit them from just Wolfurt Bodensee Vorarlberg Bodensee Vorarlberg €16 and also travel comfortably from one to the other by public 2 FreizeitkarteBodensee Freizeitkarte transport. -

International Koordinierter Bewirtschaftungsplan Für Die Internationale Flussgebietseinheit Rhein
International koordinierter Bewirtschaftungsplan für die internationale Flussgebietseinheit Rhein (Teil A = übergeordneter Teil) Dezember 2009 Impressum Herausgeberin: Internationale Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) Kaiserin-Augusta-Anlagen 15, D 56068 Koblenz Postfach 20 02 53, D 56002 Koblenz Telefon +49-(0)261-94252-0, Fax +49-(0)261-94252-52 E-mail: [email protected] www.iksr.org © IKSR-CIPR-ICBR 2009 IKSR CIPR ICBR Bewirtschaftungsplan IFGE Rhein Inhaltsverzeichnis Einleitung ............................................................................................7 1. Allgemeine Beschreibung ........................................................10 1.1 Oberflächengewässer.......................................................................... 11 1.2 Grundwasser ..................................................................................... 12 2. Menschliche Tätigkeiten und Belastungen ...............................13 2.1 Hydromorphologische Veränderungen einschließlich Entnahmen ............... 13 2.2 Chemische Belastung durch diffuse und Punktquellen .............................. 14 2.2.1 Allgemeines.............................................................................. 14 2.2.2 Relevante Einträge in Oberflächengewässer ................................... 15 2.2.3 Relevante Einträge in Grundwasser ............................................... 17 2.3 Andere Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf den Gewässerzustand .. 17 3. Verzeichnis der Schutzgebiete .................................................18 -

Jahrhundert-Hochwasser 2005
10 Jahre danach Jahrhundert-Hochwasser 2005 Maßnahmen und Strategie Inhalt Das Jahrhundert-Hochwasser 2005 8 Extreme Niederschläge im August 2005 10 Hochwasser in allen Flüssen und Bächen des Landes 14 Schäden durch das Hochwasser 10 Jahre danach – Maßnahmen und Investitionen 2005 bis 2015 19 Investitionen 2005 bis 2015 22 Die wichtigsten Hochwasserschutz-Maßnahmen 32 Interviews mit Betroffenen 34 Moderner Schutzwasserbau – Die Grundsätze Die Hochwasserschutz-Strategie des Landes Vorarlberg 38 Integraler Hochwasserschutz 40 Gefahrenzonenplan 42 Vorhersage und Warnung 44 Blauzone Rheintal 46 Hochwasserrisiko-Managementplan 48 Interview mit Landeshauptmann Wallner und Landesrat Schwärzler 50 Links, Quellen, Hinweise Wasser: wertvoller Naturschatz und bedrohliche Naturgewalt Mit seinem Wasserreichtum verfügt das Land Vorarlberg über einen Boden- schatz von ganz elementarer Bedeutung, der die hohe Lebensqualität und die wirtschaftliche Entwicklung maßgeblich mitbegründet. Wasser kann aber auch zur Bedrohung werden. Das haben viele Menschen in unserem Land in der Nacht vom 22. auf den 23. August 2005 miterleben müssen. Seit diesem Jahrhundert-Hochwasser sind zehn Jahre vergangen. Doch die bitteren Stunden für unser Land sind noch in Erinnerung. Kleine, harmlose Bäche verwandelten sich in reißende Wildbäche, wichtige Stra- ßen- und Schienenverbindungen sind durch Muren gekappt und mehrere Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten worden. Zwei Menschen- leben und elf Verletzte sowie enorme Schäden an der Infrastruktur waren zu beklagen. Auf schmerzliche Weise hat uns die Katastrophe vor Augen geführt, dass es absoluten Hochwasserschutz nicht gibt, aber es ist unsere Verantwortung, in den Schutz vor Naturgefahren heute und in Zukunft weiter zu investie- ren. Es hat sich in den Stunden des Unglücks auch gezeigt, dass sich die erheblichen Investitionen in den Schutz unserer Siedlungen und unserer Infrastruktur und der Ausbau der regionalen Sicherheitsstrukturen hervor- ragend bewährt haben.