Gerlinde Steininger Befasst Sich in Ihrem Beitrag
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

An Intersectional Analysis of Julya Rabinowich's Die Erdfresserin (2012) Author(S): Hajnalka Nagy Source: Austrian Studies , Vol
Representations of the Other: An Intersectional Analysis of Julya Rabinowich's Die Erdfresserin (2012) Author(s): Hajnalka Nagy Source: Austrian Studies , Vol. 26, Austria in Transit: Displacement and the Nation-State (2018), pp. 187-201 Published by: Modern Humanities Research Association Stable URL: https://www.jstor.org/stable/10.5699/austrianstudies.26.2018.0187 JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at https://about.jstor.org/terms Modern Humanities Research Association is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Austrian Studies This content downloaded from 143.205.176.60 on Wed, 17 Mar 2021 08:54:25 UTC All use subject to https://about.jstor.org/terms Representations of the Other: An Intersectional Analysis of Julya Rabinowich’s Die Erdfresserin (2012)* HajNALKA NAGY Alpen-Adria-Universität Klagenfurt I In the age of globalization, mass migration and transculturalization, traditional structures and frameworks of belonging such as home, culture and nation are destabilized. The transcultural turn in Cultural Studies of the new millennium has rejected any essentializing determination of collective and individual -

Crossing Central Europe
CROSSING CENTRAL EUROPE Continuities and Transformations, 1900 and 2000 Crossing Central Europe Continuities and Transformations, 1900 and 2000 Edited by HELGA MITTERBAUER and CARRIE SMITH-PREI UNIVERSITY OF TORONTO PRESS Toronto Buffalo London © University of Toronto Press 2017 Toronto Buffalo London www.utorontopress.com Printed in the U.S.A. ISBN 978-1-4426-4914-9 Printed on acid-free, 100% post-consumer recycled paper with vegetable-based inks. Library and Archives Canada Cataloguing in Publication Crossing Central Europe : continuities and transformations, 1900 and 2000 / edited by Helga Mitterbauer and Carrie Smith-Prei. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-4426-4914-9 (hardcover) 1. Europe, Central – Civilization − 20th century. I. Mitterbauer, Helga, editor II. Smith-Prei, Carrie, 1975−, editor DAW1024.C76 2017 943.0009’049 C2017-902387-X CC-BY-NC-ND This work is published subject to a Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivative License. For permission to publish commercial versions please contact University of Tor onto Press. The editors acknowledge the financial assistance of the Faculty of Arts, University of Alberta; the Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta; and Philixte, Centre de recherche de la Faculté de Lettres, Traduction et Communication, Université Libre de Bruxelles. University of Toronto Press acknowledges the financial assistance to its publishing program of the Canada Council for the Arts and the Ontario Arts Council, an agency of the -

8.Große Kiesau Literaturnacht 24. Mai 2014 Trifft
8.Große Kiesau Gefördert durch: Literaturnacht 24. Mai 2014 trifft Vorverkauf ab 01. April 2014 Kartenpreis 18,00 Euro Online-Ticketing 18,60 Euro (incl. Porto) Buchhandlung Langenkamp Beckergrube 19, 23552 Lübeck oder Welcome Center (Touristbüro) Lübeck und Travemünde Marketing GmbH Holstentorplatz 1, 23552 Lübeck Tel.: 0451/ 88 99 700 oder Online-Ticketing www.grosse-kiesau.de oder www.luebeck-tourismus.de 8. Große Kiesau Literaturnacht am 34. Internationalen Hansetag Künstlerische Leitung „HandelN“ Groß geworden in einer kleinen Straße, wird die 8. Große Kiesau Literaturnacht zum 34. Hansetag 2014 auf der gesamten Lübecker Altstadtinsel Literaturliebhaber aus Nah und Fern in ihren Bann ziehen. Unter dem Dachthema „HandelN“ werden in insgesamt 24 charmante Altstadthäusern Reinhard Göber, Berlin bekannte Schauspieler, Autoren und Musiker Theaterregisseur, Lehrbeauftragter und Festivalleiter mit inszenierten Lesungen ihre Gäste begeistern. Studium Humboldt-Universität Berlin und Hochschule für Die Lesungen finden in kleinem, besonders Schauspielkunst „Ernst Busch“, Berlin. 2000-2002 Oberspielleiter stimmungsvollem privatem Ambiente statt, Schauspiel Theater Lübeck. Lehraufträge u.a. TU-Berlin „unplugged“ und ganz nah am Publikum. Kunsthochschule Berlin-Weissensee , H M T Rostock und Universität Literatur wird so zum besonderen sinnlichen Wien. Auszeichnungen beim 11. und 13. NRW Theatertreffen Erlebnis. Nominierung 22. Norddeutsches Theatertreffen Oldenburg Im Anschluss an die parallel stattfindenden Theaterpreis der Stadt Oberhausen 1995 Lesungen besteht die Möglichkeit, gemeinsam Künstlerische Leitung bei „DIVA- 1. Intern. Monodramafestival mit den beteiligten Künstlern, Gastgebern und Österreich“ Tirol 2011/2013 und „Große Kiesau Literaturnacht“ Gästen in der Schiffergesellschaft zu Lübeck den Lübeck seit 2006 Abend im anregenden Austausch ausklingen zu Inszenierungen u.a. an den Stadt - und Staatstheatern von Bonn lassen. -
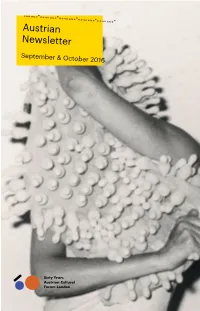
Austrian Newsletter
•"""""""•"""""""•"""""""•"""""""•"""""" Austrian Newsletter September & October 2016 •""""""•""""""•""""""•""""""•""""""" •""""""•"""""""•"""""""•""""""•"""""" Last Chance September Out of the Box London Design Biennale 2016 Until Thursday 15 September, ACF London Wednesday 7 – Tuesday 27 September, Somerset House, London Don’t miss the final weeks of our 60th anniversary exhibition curated by This year, Austria will take part in the Vienna-based art consultancy section.a. first London Design Biennale under the The exhibition responds to the site, motto 'Utopia by Design' at Somerset history and current programme of the House. The theme celebrates the 500th ACF through a number of specially anniversary of the first publication of commissioned artworks and installations. 'Utopia' by Thomas Morus. Austria will present a specially developed Maria Lassnig kinetic light installation by celebrated Until Sunday 18 September, Tate Liverpool design duo mischer'traxler studio, commissioned by Austria Design Net. This major exhibition of works by Austrian LeveL: the fragile balance of utopia artist Maria Lassnig (1919 – 2014) includes transforms itself as it interacts with the around 40 paintings, works on paper audience as well as its environment. and animations, focusing on Lassnig’s committed exploration of the notion www.londondesignbiennale.com www.somersethouse.org.uk of self-portraiture and the boundaries between the self and the world. Info: Tate Liverpool, Albert Dock, Liverpool L3 4BB; www.tate.org.uk/liverpool The Body Extended: Sculpture and Prosthetics Until Sunday 23 October, Henry Moore Institute, Leeds The Body Extended: Sculpture and Prosthetics traces how artists have addressed radical changes to the very mischer'traxler studio thing we humans know best: our bodies. The exhibition presents over seventy Percussion Discussion at KISS artworks, objects and images including works by three celebrated Austrian artists: Wednesday 7 – Saturday 10 September, Michael Kienzer, Walter Pichler and Leicester Franz West. -

COALITION of WOMEN in GERMAN (WIG) 41Stannual CONFERENCE
COALITION OF WOMEN IN GERMAN (WIG) 41st ANNUAL CONFERENCE Banff Centre, Alberta, Canada !October 13-16, 2016 PROGRAM THURSDAY, OCTOBER 13 4:30 – 5:30 pm TOUR OF THE BANFF CENTRE (Meet in the Professional Development Centre foyer) 5:30-6:45 pm DINNER (Vistas) 6:45-7:00 pm WELCOME (Kinnear Centre Room 201) 7:00-9:15 pm THURSDAY EVENING SESSION (KC 201) OMEKA WORKSHOP AND WIG HERSTORY EVENT Organizers: Beth Muellner (College of Wooster) Kerstin Steitz (Old Dominion University) Workshop Leader: Alicia Peaker, Mellon CLIR/DLF Postdoc, Digital Liberal Arts (Middlebury College) FRIDAY, OCTOBER 14 7:00-8:30 am BREAKFAST (Vistas) 8:45-10:30 am PRE-20TH CENTURY PANEL (KC 201) MOURNING WOMEN Organizers: Lena Heilmann (Knox College) Beth Ann Muellner (College of Wooster) 1. “Geschmücket festlich”: Sorrow and the Sonnet Form in Günderrode’s Die Malabarischen Witwen – Stephanie Galasso (Brown University) 2. Seeking Appropriate Ways of Expressing the Unfathomable: Mourning the Loss of a Muse in Friederike Brun’s and Fanny Lewald’s Writing – Stefanie Ohnesorg (University of Tennessee) and Judith Hector (University of Tennessee) 3. Old Maids’ Mourning and Material Agency in Marie von Ebner-Eschenbach’s Lotti die Uhrmacherin and Theodor Storm’s “Marthe und ihre Uhr” – Petra Watzke (Skidmore College) 10:45-12:30 pm BLACK AUTHORSHIP IN GERMAN VISUAL MEDIA AND PERFORMANCE (KC 201) Organizers: Angelica Fenner (University of Toronto) Jamele Watkins (University of Massachusetts, Amherst) 1. Authorial Stakes in Documentary Testimonial: The Postwar Adoption of Black Germans, Revisited – Rosemarie Peña (Rutgers University) 2. Belonging and the Black Flaneuse in Two European Web Series – Karina Griffith (University of Toronto) 3. -

Kulturbericht 2014 Kulturbericht Kulturbericht 2014
Kultur bericht 2014 Kulturbericht 2014 Kulturbericht Kulturbericht 2014 Wien, 2015 Impressum Medieninhaber, Verleger und Herausgeber: Bundeskanzleramt, Sektion II Kunst und Kultur Concordiaplatz 2, 1010 Wien Redaktion: Michael P. Franz, Ruth Pröckl Foto Bundesminister Dr. Josef Ostermayer (Vorwort): Johannes Zinner Grafische Gestaltung: BKA | ARGE Grafik Druck: REMAprint Litteradruck Wien, Juni 2015 Vorwort Die Kulturaufgaben des Bundes werden seit März 2014 vom Bundeskanzleramt wahrgenommen. Das Ergebnis des ersten Berichtsjahres unter den neuen Voraussetzungen fällt für die Bundeskultureinrichtungen positiv aus. Besondere Heraus- forderungen konnten gelöst und die Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen im Sinne neuer Weichenstellungen und einer nachhaltigen Absicherung erfolgreich in Angriff genom- men werden. Letzteres galt vor allem im Bereich der Bundestheater. Als Konsequenz der wirtschaftlichen Turbulenzen im Bereich des Burgtheaters zu Jahresbeginn wurden organisatorische und personelle Neuausrichtungen vorgenommen. Im März 2014 wurde Karin Bergmann interimistisch – und mit 14. Oktober 2014 definitiv – als neue künstlerische Geschäftsführerin des Burgtheaters bestellt. Nach dem Rücktritt von Georg Springer von seiner Funktion als Geschäftsführer der Bundestheater- Holding im Juni 2014 wurde dieser Verantwortungsbereich an Günter Rhomberg übertragen. Im Sommer des Jahres erhielt die ICG Integrated Consulting Group den Auftrag zur Analyse der Organisationsstruktur der Bundestheater-Holding und damit verbunden zur Erarbeitung von -

University of Southampton Research Repository Eprints Soton
University of Southampton Research Repository ePrints Soton Copyright © and Moral Rights for this thesis are retained by the author and/or other copyright owners. A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the copyright holder/s. The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given e.g. AUTHOR (year of submission) "Full thesis title", University of Southampton, name of the University School or Department, PhD Thesis, pagination http://eprints.soton.ac.uk UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON FACULTY OF HUMANITIES Modern Languages Über die Schwelle. Zugewanderte AutorInnen und Texte um das Kulturzentrum exil in Wien by Silke Schwaiger Thesis for the degree of Doctor of Philosophy July 2014 UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON ABSTRACT FACULTY OF HUMANITIES Modern Languages Thesis for the degree of Doctor of Philosophy Über die Schwelle. Zugewanderte AutorInnen und Texte um das Kulturzentrum exil in Wien Silke Schwaiger This study focuses on selected texts and authors associated with the cultural centre exil in Vienna which promotes the culture of migrants and minorities, mainly Roma and Sinti, in Austria. Since 1997 exil has awarded the annual prize ދwriting between culturesތ. The literary prize addresses authors with a ދmigrant background’ whose mother tongue is not German but who write in German. -

Reviews 191 FOCUS on GERMAN STUDIES 19
Volume 19 2012 reviews 191 FOCUS ON GERMAN STUDIES 19 JULIA ALBRECHT UND CORINNA PONTO PATENTÖCHTER. IM SCHATTEN DER RAF – EIN DIALOG. KÖLN: KIEPENHEUER UND WITSCH, 2011. 224 S. € 18.99. m 30. Juli 1977 wurde Jürgen Ponto, Vorstandssprecher der Dresdner Bank, während eines missglückten Entführungsversuchs in seinem eigenen Haus von der RAF erschossen. RAF-Mitglied Susanne Albrecht, die Tochter Aeines Familienfreundes, hatte ihre besondere Vertrauensstellung bei den Pontos missbraucht und zwei weitere Mitglieder der linksextremistischen Terrororganisation ins Haus geschleust. Mit der Ermordung Pontos begann der Deutsche Herbst, eine der größten politischen und gesellschaftlichen Krisen der Bundesrepublik. Genau 30 Jahre später, im Jahre 2007, nehmen Pontos Tochter Corinna Ponto und die jüngere Schwester Albrechts, Julia Albrecht, den Dialog miteinander auf. Sie brechen damit das Schweigen, das seit der Tat zwischen den beiden Familien geherrscht hat. Dabei hatte man sich einmal sehr nahe gestanden: Julia ist die Patentochter Jürgen Pontos, und Corinna ist die Patentochter von Susannes Vater, dem Anwalt Hans-Christian Albrecht. Nun haben die beiden Patentöchter ihren Briefwechsel veröffentlicht, zusätzlich kommentiert und mit eigenen Analysen versehen. Hinzugefügt haben sie außerdem Augenzeugenberichte der Ermordung, Briefe von anderen Familienangehörigen über die Tat und ihre Folgen, und sogar Ablichtungen von Dokumenten verschiedener Art wie etwa das Bekennerschreiben Susannes und Karteikarten der Stasi, die auf Verwicklungen des ostdeutschen Geheimdienstes mit den Machenschaften der RAF hinweisen. Gekonnt verdichten die Autorinnen all diese Materialien und erstellen dadurch einen heterogenen, abwechslungsreichen sowie hochinteressanten Text. Auf diese Weise soll letztendlich Licht in die Sache gebracht werden, die sich bisher niemand erklären konnte: wie es zu Susanne Albrechts folgenschwerer Tat kam. -
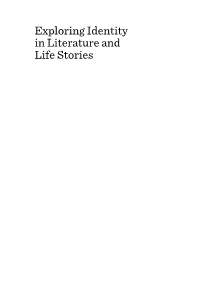
Exploring Identity in Literature and Life Stories
Exploring Identity in Literature and Life Stories Exploring Identity in Literature and Life Stories: The Elusive Self Edited by Guri E. Barstad, Karen S. P. Knutsen and Elin Nesje Vestli Exploring Identity in Literature and Life Stories: The Elusive Self Edited by Guri E. Barstad, Karen S. P. Knutsen and Elin Nesje Vestli This book first published 2019 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2019 by Guri E. Barstad, Karen S. P. Knutsen, Elin Nesje Vestli and contributors All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-5275-3571-1 ISBN (13): 978-1-5275-3571-8 TABLE OF CONTENTS Acknowledgements .................................................................................. viii Introduction ................................................................................................. 1 The Search for Self: Continuity and Mutability Guri Ellen Barstad, Karen Patrick Knutsen and Elin Nesje Vestli Identity and Cultural Hybridity Chapter One ............................................................................................... 16 “Brittle identities”: Identity Discourses in the Work of Austrian Author Julya Rabinowich Elin Nesje -

Diplomarbeit
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Vermittlung von nach Österreich zugewanderter AutorInnen durch Verlage und andere Institutionen des Literaturbetriebs Verfasserin Katharina Strasser angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2011 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 393 Studienrichtung lt. Studienblatt: Vergleichende Literaturwissenschaften Betreuer: Dr. Ernst Grabovszki Besonderer Dank gilt meiner Mutter Christine, die mir dieses Studium nicht nur finanziell ermöglicht hat, sondern mir auch stets den Rücken gestärkt hat. Danke Mama Ein großes Dankeschön auch an Ines Gherardini und David Pearson, für die große Hilfe und Unterstützung. Inhaltsverzeichnis: 1. Einleitung...............................................................................................................1 2. Öffentlichkeit.........................................................................................................6 3. Öffentlichkeit und die Identität der AutorInnen................................................10 3.1. Kollektive Identitäten..........................................................................................11 3.2. Neue Identitäten.................................................................................................14 3.3. Sprachenwechsel...............................................................................................16 3.4. Selbstpositionierung...........................................................................................19 4. Verlage und Literaturvermittlung -

Austria Kultur International Jahrbuch Der Österreichischen Auslandskultur 2017
Austria Kultur International Jahrbuch der Österreichischen Auslandskultur 2017 Austria Kultur International Jahrbuch der Österreichischen Auslandskultur 2017 Austria Kultur International Jahrbuch der Österreichischen Auslandskultur 2017 Jutta Benzenberg, Junge in Adriatic City, Albanien Inhalt Die Österreichische Auslandskultur 2017 Karin Kneissl, Bundesministerin für Europa, Integration und Äußeres 11 Vorwort Teresa Indjein (BMEIA), Leiterin der Sektion für Kulturelle Auslandsbeziehungen 15 EUROPÄISCHE AUSLANDSKULTURPOLITIK: MÜHEN DER IMPLEMENTIERUNG VERSUS HERAUSFORDERUNGEN DER PRAXIS Actuatione des Comunicatione por EU internationale culturale relationes (Europanto)//Implementing the communication on culture in the external relations Diego Marani: Seniore Counsellero por culturale politica// Senior Advisor on Cultural Policy, European External Action Service 21 EUNIC-Pilotprojekt „Tfanen – Tunisie Créative“ – österreichische Auslandskultur im Rahmen einer zukunftsweisenden Partnerschaft Marion Kasten (BMEIA), Österreichische Botschaft Tunis 27 European Comics Festival 2017 in Rumänien: Konsequenzen und Chancen für die österreichisch-europäische Kulturpolitik in einer sich wandelnden Gesellschaft Elisabeth Marinkovic (BMEIA), ehem. Direktorin des Kulturforums Bukarest 33 DER AUSLANDSKULTUR-LÄNDERSCHWERPUNKT 2017 Das Kulturjahr Österreich – Kroatien 2017: Gemeinsam Kultur erleben. Eine intensive Freundschaft geprägt von Kreativität und Dialog Susanne Ranetzky (BMEIA), Direktorin des Kulturforums Zagreb 37 Das Kulturjahr Österreich-Kroatien -

AUSSIGER BEITRÄGE Germanistische Schriftenreihe Aus Forschung Und Lehre
AUSSIGER BEITRÄGE GERMANISTISCHE SCHRIFTENREIHE AUS FORSCHUNG UND LEHRE 8 ********* 2014 8. JAHRGANG Begegnungen und Bewegungen: Österreichische Literaturen Hrsg. von Anna Babka, Renata Cornejo und Sandra Vlasta ACTA UNIVERSITATIS PURKYNIANAE FACULTATIS PHILOSOPHICAE STUDIA GERMANICA AUSSIGER BEITRÄGE Germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre Redaktionsrat: Andrea Bartl (Bamberg), Hana Bergerová (Ústí n. L.), Renata Cornejo (Ústí n. L.), Ekkehard W. Haring (Nitra/Wien), Věra Janíková (Brno), Klaus Johann (Münster), Marek Schmidt (Ústí n. L.), Georg Schuppener (Leipzig/Ústí n. L.), Petra Szatmári (Budapest) E-Mail-Kontakt: [email protected] Für alle inhaltlichen Aussagen der Beiträge zeichnen die Autor/innen verant wortlich. Hinweise zur Gestaltung der Manuskripte unter: http://ff.ujep.cz/index.php/aussigerbeitraege Die Zeitschrift erscheint einmal jährlich und ist in der internationalen Daten bank Scopus gelistet. Anschrift der Redaktion: Katedra germanistiky FF UJEP Pasteurova 13, CZ–40096 Ústí nad Labem Bestellung in Tschechien: Knihkupectví UJEP Pasteurova 1, CZ–40096 Ústí nad Labem [email protected] Bestellung im Ausland: PRAESENS VERLAG Wehlistraße 154/12, A–1020 Wien [email protected] Design: LR Consulting, spol. s r. o. J. V. Sládka 1113/3, CZ–41501 Teplice www.LRDesign.cz Technische Redaktion: [email protected] Druck: Jana Rulfová, RS DESIGN Tolstého 451, CZ–415 03 Teplice Auflage: 250 © Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta Ústí nad Labem, 2014 ISSN 18026419 ISBN 9788074147791 (UJEP), ISBN 9783706908139 (Praesens Verlag) INHALTSVERZEICHNIS Vorwort 7 I. WISSENSCHAFTLICHE BEITRÄGE Lucie Antošíková/ JAn Budňák/ evA SchörkhuBer: Der Österreich Spiegel? – Jiří Grušas Essays Beneš als Österreicher und die Gebrauchsan- weisung für Tschechien und Prag als Beispiele transkulturellen essayistischen Schreibens 13 eLisabeth tropper: Hybride und Monster im ‚Dritten Raum‘.