Langfassung Interview
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

DER SPIEGEL Jahrgang 1999 Heft 45
Werbeseite Werbeseite DAS DEUTSCHE NACHRICHTEN-MAGAZIN Hausmitteilung 8. November 1999 Betr.: Havel, Speer, Wehrmacht, Limbach er tschechische Staatspräsident Václav Havel bat um Entschuldigung: „Ich Dkomme zu spät, ich weiß“, sagte er den zum Gespräch angereisten SPIEGEL- Redakteuren Olaf Ihlau, 57, und Walter Mayr, 39. Grund für die Verspätung: Das Staatsoberhaupt hatte gerade seine Fahrer und Sicherheitsbeamten angewiesen, ihn künftig wie einen normalen Menschen durch die Gegend zu kutschieren – nicht mehr mit Hupe, Blaulicht und in rasender Geschwindigkeit. „Unheimliche Qualen“ habe er in den vergangenen Jahren bei dem rabiaten Fahrstil in den Dienstkaros- sen ertragen, erzählte Havel den SPIEGEL-Leuten, „es ist so unangenehm, wenn mir die Leute auf der Straße die Zunge rausstrecken oder drohend winken“. Da- mit solle jetzt Schluss sein (Seite 218). ahrelang hatte sich der Frank- Jfurter Architekt Albert Speer, 65, einem Gespräch mit dem SPIEGEL verweigert. Speer ist einer der er- folgreichsten deutschen Stadtpla- ner, scheute aber, als Sohn des Hit- ler-Architekten, die Öffentlichkeit. Nun – auf dem Höhepunkt seiner Karriere – überwand er sich doch. Sieben Stunden sprach Speer mit den SPIEGEL-Redakteuren Susan- ne Beyer, 30, und Dietmar Pieper, G. GERSTER 36, erklärte ihnen stolz seine Pläne Beyer, Speer, Pieper für den Bau des Europaviertels in Frankfurt am Main und berichtete von Kindheitserinnerungen an Adolf Hitler: „Aus meiner Perspektive war er ein Onkel wie jeder andere auch“ (Seite 239). m die Aufklärung von Verbrechen der Wehrmacht bemüht sich seit 1995 das UHamburger Institut für Sozialforschung mit einer viel beachteten Ausstellung. Schon vor einem Jahr hatte sich allerdings der Historiker Bogdan Musial beim SPIEGEL gemeldet und von Fehlern berichtet: Einige Bilder zeig- ten nicht Opfer deutscher Soldaten, sondern des sowjetischen Ge- heimdienstes. -

The Handover
THE HANDOVER There comes a point at which every development cooperation project which is designed to continue in the long-term has to face up to the question of handing over to local partners. The School for Life, now in its eleventh year of existence, was transferred over to 100% Thai management on the 15th of September 2014. In terms of development policy, this step was already overdue. International cooperation still continues to take place via the Board of the School for Life Foundation, but on campus, Thais will from now on take sole responsibility for educational, social, operational and financial affairs. The School for Life was founded in 2003 through the German-Thai cooperation of Thaneen “Joy” Worrawittayakun and Jürgen Zim- mer. In 2006, Dominique Leutwiler from Switzerland became its General Manager, and until earlier this year led the project with a sure touch, contributing greatly towards the protection of the school in times of financial difficulty. The School for Life owes her the greatest of thanks. She based her management on international standards and ensured transparency and credibility, as her successes in fundraising prove. She was supported by Khun Anchana, who was responsible for the quality of accounting as well as being engaged in many ways in the School for Life and its children. She also deserves great thanks. The handover of the project to the Thais necessitates a team of people who want this too. Whether in Latin America, Asia or Africa, many cases of development cooperation have experienced this transfer to be problematic and it has often been at this point that the project gives up the ghost. -

Send to Mike H
More Shock than Therapy: Why there has been no miracle in eastern Germany?, Socialism and Democracy (Summer). Draft Over the last few years a change of mood has affected German politics with regard to the country‘s ‗eastern problem‘.1 Until recently it was generally addressed by politicians with bluff confidence, expressing a sanguine faith that the combination of marketisation and state subsidies would rapidly modernise the region. But to an increasingly sceptical eastern electorate, such affirmations of a swift and sure revival are beginning to sound as empty as the promissory slogans of a previous era. Some politicians now feel obliged to adopt a more cautious tone. Dissenting voices are becoming more outspoken. Perhaps the most notable of the latter is that of Wolfgang Thierse, deputy leader of the Social Democratic Party (SPD) and president of the German parliament, who created a furore last year with the publication of critical theses, followed by a book, on economic and social conditions in the East.2 ‗Any honest appraisal‘, Thierse warned (Die Zeit No. 2 2001), ‗must establish that Eastern Germany‘s social and economic situation is approaching the brink.‘ The theses were indeed alarming; they drew attention to the decline in the economically active population, which had fallen below five million for the first time; to the unemployment rate, which had soared from 1.8 times that of the West in 1998 to 2.3 times in 2000; and to soaring levels of youth emigration and unemployment. ‗The longer the catch-up process stagnates,‘ Thierse warned, ‗the more quickly and clearly tendencies to decline will develop, even to the point of endangering what has, often at great cost, already been achieved.‘ The conclusion was sombre: ‗East Germany is, in this light, no longer a region in transition but second rate in perpetuity.‘ The contrast between such serious consideration of perpetual backwardness and the hopes and predictions of earlier phases of the ‗catch-up process‘ could hardly be sharper. -

Regine Hildebrandt Herz Mit Schnauze
Tel.: 01805 / 30 99 99 (0,14 €/Min., Mobil max. 0,42 €/Min.) www.buchredaktion.de Zum Buch Regine Hildebrandt, die Politikerin mit Herz und Verstand, nahm nie ein Blatt vor den Mund. Die »Mutter Theresa von Pots- dam«, wie man die brandenburgische Ministerin für Arbeit, So- ziales, Gesundheit und Frauen liebevoll nannte, engagierte sich für Gleichberechtigung und setzte sich besonders für die Rechte von Frauen in Ostdeutschland ein. Sie war in Sachen Arbeitsbe- schaffung unterwegs, kämpfte gegen soziale Ausgrenzung und Abschiebung, für bezahlbare Wohnungen und angemessene Le- bensverhältnisse im Osten. Das Erfrischende an ihr: Sie ist nie eine richtige Politikerin geworden. Weder war sie unangreifbar noch verlor sie schnell die Fassung. Und immer war sie für eine Überraschung gut. Eine Auswahl ihrer bekannt pointierten Formulierungen in In- terviews und Talk-Shows, Reden, Briefen und Artikeln haben zwei ihrer Töchter gemeinsam mit einer Freundin in dem vorlie- genden Buch zusammengestellt: kantige Anmerkungen zu poli- tischen Sachverhalten, komische Einwürfe zu Alltäglichem, em- pörte Kommentare zur sozialen Lage, treffende Auslassungen über sich selbst, Köstliches über die Familie – die eigene und an- dere – und prägnante Spitzen zur Frauenfrage. Das alles natür- lich im unverwechselbaren Hildebrandt-Ton. Zur Autorin Regine Hildebrandt (1941–2001), promovierte Biologin, enga- gierte sich 1989 in der Bürgerbewegung »Demokratie jetzt« und wurde Mitglied der SPD. Von 1990 bis 1999 war sie Ministerin für Soziales, Gesundheit und Frauen des Landes Brandenburg, bis zu ihrem Tod saß sie im Bundesvorstand der Sozialdemokraten. Sie liegt in Woltersdorf begraben. Regine Hildebrandt Herz mit Schnauze Sprüche und Einsprüche Herausgegeben von Frauke und Elske Hildebrandt und Roswitha Köppel edition berolina ISBN 978-3-86789-820-1 1. -
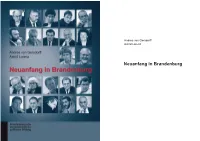
Neuanfang in Brandenburg.Pdf
Andrea von Gersdorff Astrid Lorenz Neuanfang in Brandenburg Copyright 2010 Herausgeber: Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung Eine Publikation der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Mit freundlicher Unterstützung von Ungewöhnlicher Ort für eine Kabinettsitzung – unterwegs im Zug durch das Land Brandenburg. ISBN 3-932502-57-4 Fotografien: Simone Diestel Gestaltung und Realisierung: Bauersfeld Werbeagentur Druck: Druckerei Arnold, Großbeeren Diese Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen die Verantwortung. Inhalt Vom Parteineuling zum Landtagsvizepräsidenten 93 Martin Habermann Auf Distanz zur eigenen Fraktion 99 An einem Wochenende im Sommer 1989… 6 Herbert Knoblich Andrea von Gersdorff und Astrid Lorenz REINGERATEN SUCHEN Kinderärztin mit neuen Aufgaben 108 Werte leben und konsequent sein 11 Hannelore Birkholz Beate Blechinger Von New York nach Potsdam – Ein Diplomat wird Landespolitiker 115 Ein Mann der offenen Worte 17 Hans Otto Bräutigam Günter Nooke Zum obersten Finanzexperten in neuem Umfeld 123 Endlich Ideen verwirklichen 24 Klaus-Dieter Kühbacher Matthias Platzeck In die Pflicht genommen 129 Rücksichtsvoller Idealist 31 Manfred Stolpe Alwin Ziel TREU BLEIBEN MACHEN Ein Pragmatiker als Fraktionschef 138 Ein Freigeist – kein Parteisoldat 41 Wolfgang Birthler Peter-Michael Diestel Standpunkte bewahren 145 Fürsorge und Verantwortung als Leitmotiv 47 Stefan Körber Jörg Hildebrandt über seine Frau Regine Hildebrandt Der Anfang vom Ende in der alten Partei 152 Mit Entschlossenheit am Werk 54 Karl-Heinz Kretschmer Steffen Reiche Enttäuschungen mit der Partei 159 Beseelt von der Freiheit 62 Alfred Pracht Britta Stark (damals Schellin) Konstruktiver Kritiker 165 Flucht nach vorn 69 Marco Schumann über seinen Vater Michael Schumann Heinz Vietze Aufstieg, Ausstieg, Umstieg. -

German Women Today: What Some German Newspapers Say. Inter Nationes Basis-Info 4-2000/Society
DOCUMENT RESUME ED 439 264 CE 079 887 AUTHOR Born, Sigrid, Ed. TITLE German Women Today: What Some German Newspapers Say. Inter Nationes Basis-Info 4-2000/Society. In Press. INSTITUTION Inter Nationes, Bonn (Germany). PUB DATE 2000-01-00 NOTE 29p. AVAILABLE FROM Inter Nationes, Kennedyallee 91-103, D-53175 Bonn, Germany (free). Tel: 02 28 / 88 00; Fax: 88 04 57; Web site: http://www.inter-nationes.de. PUB TYPE Collected Works General (020) EDRS PRICE MF01/PCO2 Plus Postage. DESCRIPTORS Building Trades; Comparative Analysis; Education Work Relationship; *Employed Women; *Employment Level; Employment Patterns; *Employment Problems; Entrepreneurship; Foreign Countries; Internet; Newspapers; Poverty; *Salary Wage Differentials; Sex Bias; Sex Differences; *Sex Discrimination; Sex Fairness; Small Businesses; *Success; Technical Occupations; Trend Analysis; World Wide Web IDENTIFIERS *Germany ABSTRACT This document contains eight articles from German newspapers that feature women who have achieved career success in very diverse economic sectors, while simultaneously highlighting the discrimination and other problems (including lower income, fewer promotions to executive positions, and smaller pensions) that many other German women continue to encounter in the workplace. The following articles are included: "Introduction" (Simone Denise Battenfeld); "A Woman Helps Small to Medium-Sized Businesses" (Margarete Pauli); "A Woman as Cathedral Building Supervisor in Cologne; Barbara Schock-Werner from Nuremburg Convinced the Churchmen with Her Unusual -

30 Jahre Mauerfall
Zeitung der Berliner Sozialdemokratie | Nr. 7 · 2019 | 69. Jahrgang THEMA 30 JAHRE MAUERFALL BEGEGNUNG BERÜHMTHEIT BERLIN Zwei Generationen sprechen Klavierbauer Michael Masur Eine geteilte Stadt findet über 30 Jahre Mauerfall erzählt über seinen Vater Kurt wieder zusammen E D I T O R I A L 2 BERLINER STIMME Text Michael Müller Foto Senatskanzlei Berlin Die lang ersehnte Freiheit Die Tage im November 1989 werde ich Menschen in den so genannten Neuen nie vergessen. Ich war damals frisch Bundesländern ein sehr schmerzhafter gewählter Bezirksverordneter in Prozess. Viele verloren ihre Arbeit, Tempelhof. Die ganze Familie saß vor Betriebe wurden geschlossen, einige dem Fernseher und staunte über die Berufe gab es plötzlich nicht mehr. Geschehnisse und ihre Dynamik. Es ging alles schnell, an mancher Stelle auch zu schnell. Entschlossen hatten die Menschen in Ost-Berlin und der DDR demonstriert Trotz aller Maßnahmen zur Angleichung und gerufen: „Wir sind das Volk!“ und der Lebensverhältnisse dauert der Prozess „Die Mauer muss weg!“. Wir im Westen des Zusammenwachsens noch an. bewunderten diesen Mut und hofften Wir müssen gemeinsam die besten inständig, dass es kein Eingreifen der Lösungen finden und dazu mehr und DDR-Sicherheitskräfte geben würde. wertschätzend aufeinander zugehen. Und dann war es soweit – die berühmte Ankündigung von Günter Schabowski! Besonders jetzt, im Gedenken an die Gemeinsam mit Freunden fuhren wir Toten und die Opfer der Mauer, werden zum Brandenburger Tor und feierten mit wir daran erinnert, wie wertvoll Freiheit, wildfremden Menschen. Wir konnten es Demokratie und Rechtsstaat sind. nicht glauben, dass dieses stets sichtbare Und wie wichtig es ist, sich stets dafür Symbol der Teilung zwischen Ost und einzusetzen. -

The Länder and German Federalism Prelims 27/5/03 11:39 Am Page Ii
GPOLGunlicks cover 21/5/2003 5:22 pm Page 1 Issues in German Politics The Länder This book provides a detailed introduction to how the Länder (the sixteen states of Germany) function not only within the country itself but also within the wider context of European political affairs. Some knowledge of the role of the Länder is and German federalism essential to an understanding of the political system as well as of German federalism. The Länder This book traces the origin of the Länder. It looks at their place in the constitutional order of the country and the political and administrative system. Their organization and administration are fully covered, as is their financing. Parties and elections in the Länder and the controversial roles of parliaments and deputies are also examined. and German Because of their role in the Bundesrat, the second legislative chamber, the Lander are clearly an important part of the national legislative process. They participate in policy-making with regard to the European Union, and have limited influence on Germany's foreign affairs outside of Europe. This is the first English language book that considers the Länder in this depth. federalism Arthur Gunlicks is a professor of political science and chair of the department at the University of Richmond, Virginia Gunlicks Arthur Gunlicks ISBN 0-7190-6533-X 9 780719 065330 prelims 27/5/03 11:39 am Page i The Länder and German federalism prelims 27/5/03 11:39 am Page ii ISSUES IN GERMAN POLITICS Edited by Professor Charlie Jeffery, Institute for German Studies Dr Charles Lees, University of Sussex Issues in German Politics is a major new series on contemporary Germany. -

23/Hildebr. Portr (Page
Deutschland OSTDEUTSCHLAND Politik aus der Wundertüte Die brandenburgische Sozialministerin Regine Hildebrandt bündelt die politischen Sehnsüchte ihrer Landsleute und rackert für den Wechsel in Bonn. Sollte sich die SPD dort mit der FDP einlassen, will die Kultfigur aus der Partei austreten. Von Stefan Berg K. MEHNER SPD-Politikerin Hildebrandt, ABM-Kräfte: „Keene Angst, ick komm’ nicht jedetmal“ unkelgrünes Kostüm, weiße Bluse, besonders komisch. Vielleicht haben sie drehten blonden Locken – im selben Ton- die Ärmel etwas hochgerutscht, so die Ministerin schon zu oft leibhaftig er- fall, in dem die Frau Ministerin spricht. Dsteht sie vor den Gästen. Mal hebt lebt, vielleicht finden sie es einfach unpas- Minuten später steht Regine Hilde- sie den Zeigefinger, mal ballt sie die Hän- send, daß sich ihre oberste Dienstherrin brandt, mit einem Teller in der Hand, bei de zur Faust. Hin und wieder unterbre- so bei der Grundsteinlegung für das ihnen: „Mann, dit sieht ja prima aus.“ Kur- chen ein paar „Ähs“ ihre Rede. Krankenhaus in Elsterwerda aufführt. Sie zer Stopp am Tisch der Bauarbeiter: „Wie Bei anderen würde man dies einen ener- lächeln höflich. viele Lehrlinge werden hier’n ausjebildet?“ gischen Auftritt nennen. Für Regine Hilde- Doch je weiter die Leute von Regine Es folgt ein Vortrag zum Thema, wie wich- brandts Verhältnisse ist es eine kurze und Hildebrandt entfernt sind, desto fröhlicher tig die Berufsausbildung ist. Dann ver- ruhige Ansprache. Wie eine richtige Mini- werden ihre Gesichter. Klar, deshalb sind schwindet die Schnellsprecherin. sterin liest sie Fakten von der Karteikarte, sie gekommen, die Krankenschwestern und Bald acht Jahre ist Regine Hildebrandt, erklärt, wann und wo wie viele Millionen die Bauarbeiter. -

Deutsche Einheit Jahre
Deine Geschichte Transformationserfahrungen aus Ostdeutschland 30Jahre Deutsche E EinheitD Unsere Zukunft Herausgegeben von Rohnstock Biografien Die Geschichten aus den Digitalen Erzählsalons wurden aufgeschrieben von den Autobiografikerinnen von Rohnstock Biografien. Das Projekt „30 Jahre Deutsche Einheit: Deine Geschichte – Unsere Zukunft“ wurde gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, dem Beauftragten der Bundesregierung für die neuen Bundesländer. Impressum © Rohnstock Biografien Berlin, Dezember 2020 [email protected] www.rohnstock-biografien.de www.deine-geschichte-unsere-zukunft.de Rohnstock Biografien auf YouTube Rohnstock Biografien bei Twitter@RohnstockBio Rohnstock Biografien auf InstagramRohnstock Biografien INHALT Grußwort Marco Wanderwitz Vorwort Katrin Rohnstock Kapitel 1 Wir können etwas verändern Carla Meierl | Thierschneck (Thüringen) Man muss auch mal den Mund aufmachen Hannes Rühlmann | Rochau (Sachsen-Anhalt) Die Verlierer der Einheit brauchen unsere Hilfe Marion Zosel-Mohr | Stendal (Sachsen-Anhalt) Wir können mitgestalten, wir müssen es nur tun Angela Klier | Aue-Bad Schlema (Sachsen) „Wir gründen einen Verein“: Die Anfänge der Selbsthilfebe- wegung im Erzgebirge Susanne Borkowski | Lüderitz (Sachsen-Anhalt) Wie eine Kita-Leiterin neue Arbeitsweisen durchsetzte Udo Mauersberger | Mildenau (Sachsen) „Wir müssen den Wald retten“: Ein Forstbetriebsdirektor erzählt Susanne Gabler | Wismar (Mecklenburg-Vorpommern) Meine Kunst für Ökologie und soziale Gerechtigkeit Kapitel 2 Wir haben gekämpft -

Und Öffentlichkeitsarbeit Heinr
PUBLISHING INFORMATION Published by: Staatskanzlei des Landes Brandenburg Abteilung 3 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Heinrich-Mann-Allee 107 | D-14473 Potsdam Telefon: +49 (0) 331 866-0 | [email protected] www.brandenburg.de | facebook: unser brandenburg Legally responsible for content as per German Press Law: Government Spokesman Florian Engels Texts: Tobias Dürr, Florian Engels, Gerlinde Krahnert A red eagle on a white and red Layout: Schuetz Brandcom GmbH, Berlin background: The flag of the federal Print: Koch Druck, Am Sülzegraben 28, state of Brandenburg D-38820 Halberstadt Translation for the English and Polish issues: Alpha Translation Service GmbH, Berlin Editing: Tobias Dürr (english); Markus Mildenberger (polish) 1st Edition, September 2017 PICTURE CREDITS Yorck Maecke/U. Gatz/TMB-Fotoarchiv Schloss Babelsberg (Potsdam) with Havel p 1 + 48 | Shutterstock p 1 top (t.), 5 t., 8 + 9, 10 bottom (b.), 14, 15 bottom left (b. l.), 18. + 19., 25 top left (t. l.), 34 + 35 t. l. + top right (t. r.), 47 r. | Die Hoffotografen p 3 | Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH p 4 + 5 | Paul Hahn/TMB-Fotoarchiv p 5 b. | Stephanie Hochberg p 5 centre (c.),16, 21 b. l., 25 t. r., 31 bottom right (b. r.), 42 + 43, 45 t. r. | Bernd Geller p 6 | brandenburg.de p 6 Portrait (po.), 8 po., 12 po., 43 po., 47 po., 21 b. l. | Frank Lieb- ke/TMB-Fotoarchiv p 7 l., 22 + 23 | Ulf Böttcher/TMB-Fotoarchiv p 7 r. | Schütz Brandcom p 9 r., 11 b. l., 46 | Jan Wischnewski Photography p. 10 b. | Gabriele Boiselle p 11 bottom centre (b. -

Predigtreihe Vorbilder__Regine
Predigtreihe des Distrikts 2019: Schon vor dem Mauerfall 1989, im Ende der Deutschen „VORBILDER“ Demokratischen Republik und ab dem Zusammenschluß der Sonntag 3. Februar 2019 beiden Deutschland-Teile ab 1990 begann dann für die damals Pfarrerin Christine Eppler 48- Jährige Regine Hildebrandt ein ganz neuer Abschnitt ihres Lebens- jetzt war sie als Politikerin tätig. Predigt in Jettenburg und in Wankheim Warum sie das tat? Politik treiben- aus Verantwortung für die Welt. Aus bürgerlicher Regine Hildebrandt Verantwortung für Gesellschaft und Staat. Wegen Gott, der den Gott bekennen in der DDR (und danach!) Menschen aufgetragen hat, dem Bruder und der Schwester Hüterin zu sein. Wegen der Bibel also: Einer trage des anderen Last (Gal 6,2). Dies verbandt die Christin Hildebrandt mit den vielen anderen evangelischen Glaubensgeschwistern, welche mit ihren Eintritten v.a. in die SPD oder die CDU ab der Wende selbstverständlich ihre christlichen Grundüberzeugungen nicht abgaben, sondern diese als Grundlage hatten und haben in der politischen Arbeit. P: „Eure Rede sei ja,ja! Nein, nein!- Matthäus 5,37 Wir hier in unserem westlichen Württemberg täten gut daran, die Namen dieser Christenmenschen gelegentlich aufzuzählen: Bundeskanzlerin Angela Merkel, evangelisch, geprägt in ihrem Amt, in ihrem Menschen und Weltbild von dem, was sie als Pfarrerstochter in der DDR mitbekam, den Katholiken Wolfgang Thierse, 15 Jahre Präsident bzw. Vize-Präsident des Bundestages/ lange dabei im Zentralkomitee d. deutschen Katholiken, das frühere Staatsoberhaupt Bundespräsident Joachim Gauck, protestantischer Pfarrer in Liebe Gemeinde, Mecklenburg-Vorpommern in den Zeiten der DDR, Katrin Göring-Eckart aus Gotha in Thüringen, studierte Theologin, Regine Hildebrandt ist es, welche mich nicht losläßt und überzeugte Parlamentarierin in Land und Bund.