Das Stanser Verkommnis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
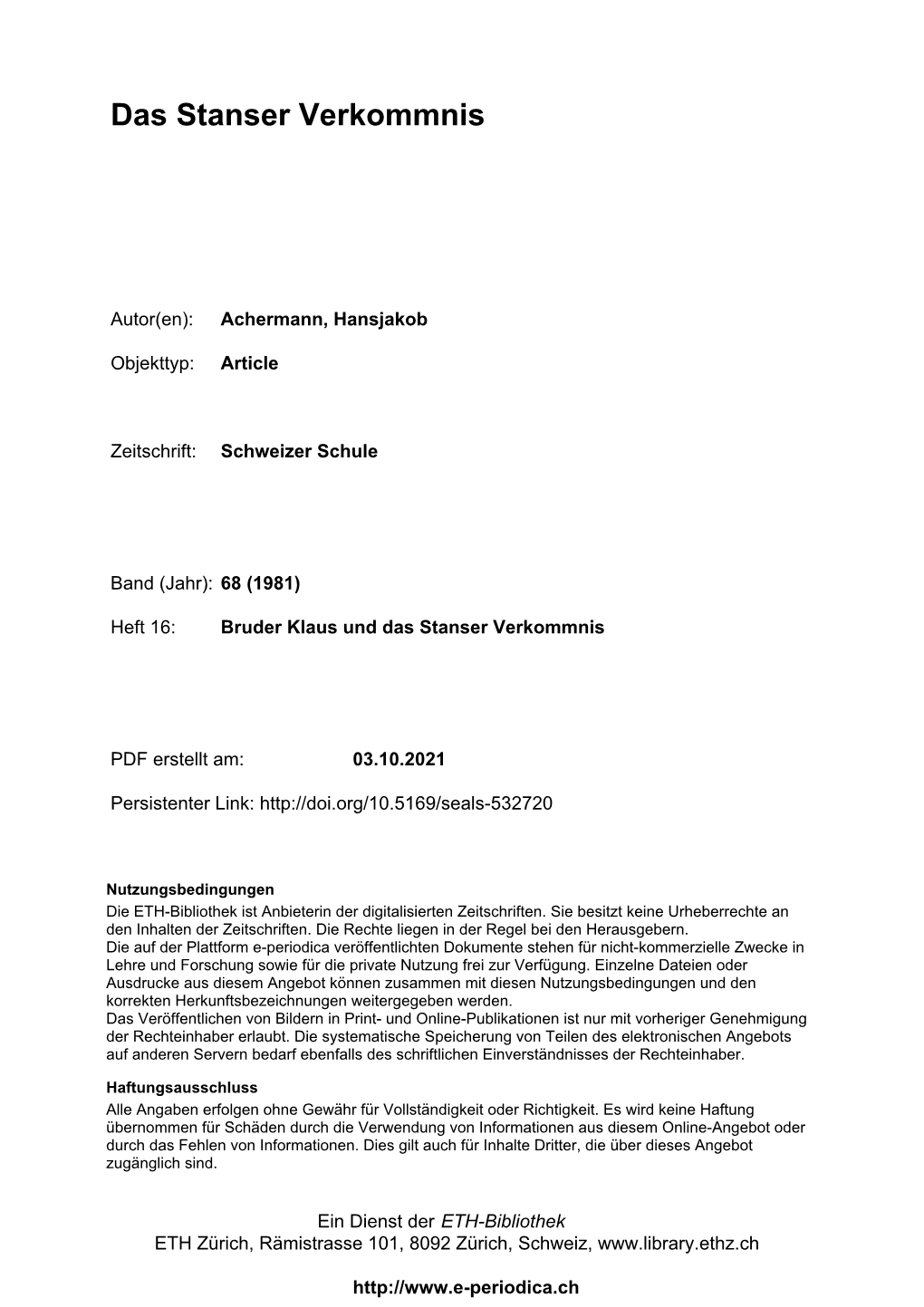
Load more
Recommended publications
-

Raiders of the Lost Ark
Swiss American Historical Society Review Volume 56 Number 1 Article 12 2020 Full Issue Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review Part of the European History Commons, and the European Languages and Societies Commons Recommended Citation (2020) "Full Issue," Swiss American Historical Society Review: Vol. 56 : No. 1 , Article 12. Available at: https://scholarsarchive.byu.edu/sahs_review/vol56/iss1/12 This Full Issue is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in Swiss American Historical Society Review by an authorized editor of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact [email protected], [email protected]. et al.: Full Issue Swiss A1nerican Historical Society REVIEW Volu1ne 56, No. 1 February 2020 Published by BYU ScholarsArchive, 2020 1 Swiss American Historical Society Review, Vol. 56 [2020], No. 1, Art. 12 SAHS REVIEW Volume 56, Number 1 February 2020 C O N T E N T S I. Articles Ernest Brog: Bringing Swiss Cheese to Star Valley, Wyoming . 1 Alexandra Carlile, Adam Callister, and Quinn Galbraith The History of a Cemetery: An Italian Swiss Cultural Essay . 13 Plinio Martini and translated by Richard Hacken Raiders of the Lost Ark . 21 Dwight Page Militant Switzerland vs. Switzerland, Island of Peace . 41 Alex Winiger Niklaus Leuenberger: Predating Gandhi in 1653? Concerning the Vindication of the Insurgents in the Swiss Peasant War . 64 Hans Leuenberger Canton Ticino and the Italian Swiss Immigration to California . 94 Tony Quinn A History of the Swiss in California . 115 Richard Hacken II. Reports Fifty-Sixth SAHS Annual Meeting Reports . -

Bindex 531..540
Reemers Publishing Services GmbH O:/Wiley/Reihe_Dummies/Andrey/3d/bindex.3d from 27.07.2017 10:15:16 3B2 9.1.580; Page size: 176.00mm x 240.00mm Stichwortverzeichnis A Annan, Kofi 484 Bartholomäusnacht 147 – Appeasement 129 Basel 57, 119, 120, 131, 139, Aarau 221, 227 229 Appenzell 122, 148, 229, 249, 141, 153, 165, 205, 207–210, Aare 298 250, 253, 266, 286, 287, 217, 221, 228, 229, 231, 232, Aargau 107, 249, 253, 274, 300, 320, 350, 364, 423 249, 253–255, 275, 276, 275, 287, 294, 296, 311, 319, – Appenzeller Monatsblatt 300 286, 287, 291, 293, 296, 321 325, 349, 350, 352, Appenzeller Zeitung 300, 318, 319, 321, 324, 325, 331, 353, 367, 377 307, 323 337, 349, 350, 353, 358, Aargauer Volksblatt 465 Aquae Helveticae 49, 51 366–368, 375, 392, 466, Académie Française 296, 297 Arbedo 108 476, 477, 479 Ador, Gustave 410, 422 Arbeiterstimme 385 Basilika 48 Aebli, Hans 136, 137 Arbeitsfrieden 437, 438 Bassanesi, Giovanni 429, 430 Ädilen 52 Arbeitslosenversicherung Batzenkrieg 156 Affäre Bassenesi 429 434, 435 Bauern-, Gewerbe- und Affäre Perregaux de Watte- Arcadius 60 Bürgerpartei 426, 462, 476 ville, die 166 Arianismus 66 Bauernkrieg, Schweizerischer Affäre von Neuenburg, die Arius 66 156 166 ’ Armagnacs 110 Baumgartner, Jakob 314, 320, Affry, Louis d 246, Armbrust 89 328 254–256, 258, 259, – Arnold, Gustav 387 Bay, Ludwig 231 261 265, 268, 272 Arp, Hans 415–417 Beccaria 183, 194 Agaune 65 Arth 340 Begos, Louis 231 Agennum 34 Artillerie 99 Béguelin, Roland 477, 478 Agrarismus 162 Assignaten 216 Belfaux 336 Aix-la-Chapelle 285 Atelier de Mirabeau -

Geschichte Verbindet Das Weisse Buch Von Sarnen Niklaus Von Flüe Eine Obwaldner Zeitreise
Geschichte verbindet Das Weisse Buch von Sarnen Niklaus von Flüe Eine Obwaldner Zeitreise Begleitinformationen und Kopiervorlagen © Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons Obwalden, 2017, als Kopiervorlage freigegeben Seite 1 von 56 Inhaltsverzeichnis 1 Objekte und ihre Geschichte ................................................ 3 KV 1 Objekte erzählen Geschichte ............................................ 5 2 Die Eidgenossenschaft als Bündnisgeflecht ................................... 7 3 Vom Bündnisgeflecht zum Bündnisverbund .................................. 8 KV 2 Ein komplizierter Text .................................................. 10 4 Habsburg, die Eidgenossenschaft und Burgund ............................... 13 5 Eine Geschichte der Befreiung .............................................. 15 KV 3 Das Weisse Buch von Sarnen ........................................... 17 6 nah dran: Lesen und Schreiben .............................................. 20 7 Methode: Schriftliche Quellen auswerten .................................... 22 KV 4 Methode: Schriftliche Quellen auswerten ................................ 23 8 nah dran: Der «Hexenturm» von Sarnen ...................................... 25 9 nah dran: Das Weisse Buch im Archiv ........................................ 26 10 Konflikte zwischen Stadt und Land .......................................... 27 11 Das Stanser Verkommnis und Bruder Klaus ................................... 29 KV 5 Das Leben des Niklaus von Flüe ......................................... 31 12 nah -

Das Torechte Leben
Das torechte Leben © 2001 by Sandro Rudin 0. Inhaltsverzeichnis 0. INHALTSVERZEICHNIS 2 1. EINLEITUNG 3 I. Vorwort 3 II. Quellenlage 3 2. DARSTELLUNG DER EREIGNISSE 4 I. Vorgeschichte 4 II. Die Entstehung des torechten Lebens 5 III. Der Marsch der Gesellen 8 IV. Die Erfüllung der Forderungen 10 V. Übersicht 11 3. INTERPRETATIONSVERSUCHE 13 I. Entwicklung 13 II. Gründe 13 III. Bedeutungen 14 IV. Wirkungen 16 V. Thesen 16 4. BIBLIOGRAPHIE 17 - Seite 2 - 1. Einleitung I. Vorwort Die vorliegende Arbeit möchte das torechte Leben von 1477 etwas näher erläutern. Das torechte Leben ist die Bezeichnung für eine Bewegung, deren Teilnehmer sich ‚Gesellen des torechten Lebens’ nannten und der 1477 im Raum der damaligen Eidgenossenschaft stattfand. Die Arbeit ist in zwei Kapitel unterteilt: Das erste Kapitel liefert eine quellenorientierte Darstellung der Ereignisse von 1477. Das zweite Kapitel bietet Hintergrundinformationen an, geht offenen Fragen nach und versucht schliesslich eine Interpretation der Geschehnisse vorzunehmen. Ziel der Arbeit ist die Erklärung der Bedeutung des torechten Lebens für den Abschluss des darauf folgenden ewigen Burgrechts beziehungsweise Stanser Verkommnisses, zwei als Reaktion auf das torechte Leben abgeschlossene Vereinbarungen zur Verhinderung von Aufständen. II. Quellenlage Der Abschluss des ewigen Burgrechts und des Stanser Verkommnisses ist in mehreren Chroniken der damaligen Zeit festgehalten. Das torechte Leben als Auslöser dieser Vereinbarungen wird allerdings nur in der Chronik des Berner Chronisten Diebold Schilling erwähnt. Von seiner Chronik sind zwei Fassungen überliefert, eine gekürzte und eine ungekürzte. Die ungekürzte und damit für diese Arbeit massgebende Fassung ist als Teil in der ‚Grossen Burgunder Chronik’ enthalten.1 Neben den Chroniken sind in verschiedenen Akten einzelne Schreiben bezüglich der Gesellen des torechten Lebens vorhanden.2 1 Walder: Das Stanser Verkommnis, S. -

3. Niklaus Von Flüe, Der Vermittler Bruder Klaus – Annäherung an Den (Un)Bekannten Lektionsbausteine Zu
3. Niklaus von Flüe, der Vermittler Bruder Klaus – Annäherung an den (un)bekannten Lektionsbausteine zu. S. 57-71 3.1 Aufgaben-und Materialset zur politischen Bedeutung des Stanser Verkommnis M1 Konfliktgegenstände (Mehrzahl!) in folgenden Jahren M2 Konfliktgegenstand 1477 Ausgangslage: Streit um die Beute aus den Burgunderkriegen. Fastnacht. „Saubannerzug“ (das „torechte Leben“): Bewaffnete aus der Inner- schweiz ziehen gegen Genf, um eine seit 1475 ausstehende Brandschatzungssumme einzutreiben. Tagsatzungsgesandte erreichen schliesslich die Umkehr der zuchtlosen Banden. Erbitterung der Städte. Mai. Burgrecht (d.h. Städtebund) der fünf Städte Zürich, Bern, Luzern, Freiburg und Solothurn, teils zur gemeinsamen Abwehr künftiger Überfälle, teils um die Aufnahme Freiburgs und Solothurns unter die Orte durchzusetzen. Drohende Spaltung der Eidgenossenschaft. Die Länder fürchten das Übergewicht der Städte, sie sträuben sich gegen die Gleichberechtigung Freiburgs und Solothurns und verlangen erbittert den Austritt Luzerns aus dem reinen Städtebund/Burgrecht (da Luzern seit dem Bund von 1332 auch mit Länderorten verbündet war). 1478 Amstaldenhandel. Die Obwaldner (Länderort) wiegeln das Entlebuch (Untertanengebiet der Luzerner) gegen Luzern auf. Die Verschwörung wird entdeckt und der Hauptschuldige, Landeshauptmann Peter Amstalden, in Luzern hingerichtet. Steigerung der Spannungen zwischen Stadtorten und Länderorten. 1480/81 Beratungen über die Aufnahme Freiburgs und Solothurns und über einen neuen, für alle Orte gleichen Bund, der über den alten Bundesbriefen stehen soll. Leiden- schaftlicher Widerstand der Länder gegen den von den Städten erstrebten engeren Zusammenschluss der Orte. Vermittlung durch den Eremiten Niklaus von der FIüe: Stanser Verkommnis / Seite 2 M3 Konfliktvermittlung M 4 Konfliktparteien M5 Konfliktlösung: Bestimmungen des Stanser Verkommnis Kein Ort (…) soll einem anderen Schaden und Gewalt antun. (…) Niemand soll gefährliche Versammlungen oder Zusammenrottungen ohne Willen der Herren und Oberen veranstalten dürfen. -

The Age of Wars of Religion, 1000-1650
THE AGE OF WARS OF RELIGION, 1000–1650 THE AGE OF WARS OF RELIGION, 1000–1650 AN ENCYCLOPEDIA OF GLOBAL WARFARE AND CIVILIZATION Volume 1, A–K Cathal J. Nolan Greenwood Encyclopedias of Modern World Wars GREENWOOD PRESS Westport, Connecticut London Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Nolan, Cathal J. The age of wars of religion, 1000–1650 : an encyclopedia of global warfare and civilization / Cathal J. Nolan. p. cm.—(Greenwood encyclopedias of modern world wars) Includes bibliographical references and index. ISBN 0–313–33045–X (set)—ISBN 0–313–33733–0 (vol. 1)— ISBN 0–313–33734–9 (vol. 2) 1. Middle Ages—History—Encyclopedias. 2. History, Modern—17th century— Encyclopedias. 3. Military history, Medieval—Encyclopedias. 4. Military history, Modern—17th century—Encyclopedias. 5. Biography—Middle Ages, 500–1500— Encyclopedias. 6. Biography—17th century—Encyclopedias. I. Title. D114.N66 2006 909.0703—dc22 2005031626 British Library Cataloguing in Publication Data is available. Copyright # 2006 by Cathal J. Nolan All rights reserved. No portion of this book may be reproduced, by any process or technique, without the express written consent of the publisher. Library of Congress Catalog Card Number: 2005031626 ISBN: 0–313–33045–X (set) 0–313–33733–0 (vol. I) 0–313–33734–9 (vol. II) First published in 2006 Greenwood Press, 88 Post Road West, Westport, CT 06881 An imprint of Greenwood Publishing Group, Inc. www.greenwood.com Printed in the United States of America The paper used in this book complies with the Permanent Paper Standard issued by the National Information Standards Organization (Z39.48–1984). -

Radicalreformationlookinside.Pdf
Habent sua fata libelli Volume XV of Sixteenth Century Essays & Studies Charles G. Nauert, Jr., General Editor Composed by Paula Presley, NMSU, Kirksville, Missouri Cover Design by Teresa Wheeler, NMSU Designer Printed by Edwards Brothers, Ann Arbor, Michigan Text is set in Bembo II 10/12 Volume XV Sixteenth Century Essays & Studies Copyright© 1992 by Truman State University Press (previously Sixteenth Century Journal Publishers, Inc.), Kirksville, Missouri USA. All rights reserved. This book has been brought to publication with the generous support of Truman State University (previously Northeast Missouri State University). First edition ©1962, Westminster Press, Philadelphia. Second edition, titled La Reforma Radical, ©1983, Fondo de Cultura Económica, Mexico. Permission is gratefully acknowledged by Westminster Press to reprint the Introduction to the first edition and to Fondo de Cultura Económica to reprint the Introducción to the Spanish edition. Cover image: Permission for use of the Siege of Münster by Erhard Schoen granted by Abaris Books. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Williams, George Huntston, 1914–2000 The radical Reformation / by George Huntston Williams. – 3rd ed., rev. and expanded. p. cm. – (Sixteenth century essays & studies ; v. 15). Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-94354-983-5 (alk. paper; Pbk) — ISBN 978-1-61248-041-1 (ebook) 1. Reformation. 2. Anabaptists. 1. Title. II Series. BR307 W5 270.6-dc20 92-6071 CIP No part of this work may be reproduced or transmitted in any format by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher. -

Broschüre 900 Jahre Weggis
aecclesiam sancte¸ Marie¸ cum villa Guategisso Erläuterung Titel: In der Urkunde vom 29. Januar 1116 bestätigt Papst Paschal II dem Kloster Pfäfers den Besitz «aecclesiam sancte¸ Marie¸ cum villa Guategisso» (der Kirche der heiligen Maria mit dem Hof Weggis). Dies ist die erste Erwähnung im ältesten noch erhaltenen schriftlichen Originaldokument über den Ort Weggis. Liebe Weggiserinnen und Weggiser, Sonderausstellung 900 Jahre Weggis geschätzte Gäste, Freundinnen und Freunde aus nah und fern Vor 900 Jahren wurde die Gemeinde Weggis zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Dies nimmt der Gemeinderat gerne zum Anlass, mit der Bevölkerung und Gästen im Jahr 2016 unter dem Motto «Weggis erleben» 900 Jahre Weggis zu feiern. Eine Arbeitsgruppe hat die Jubiläumsaktivitäten vorbereitet, welche am Freitag, 29. Januar 2016 mit dem Abholen der Ur- 1116 – 2016 kunde in Pfäfers beginnen und am Freitag, 16. Dezember 900 2016 mit einer Buchvernissage beendet werden. Ich freue mich, Sie an den einzelnen Anlässen begrüssen zu dürfen! Kaspar Widmer, Gemeindepräsident WEGGIS Erste urkundliche Erwähnung Die erste, auf ein konkretes Jahr bezogene Erwähnung von Weg- gis findet sich in einer Urkunde Samstag, 14. Mai, 16.00 Uhr, Vernissage Weggiser Tag im Regionalmuseum von Papst Paschalis II. Regionalmuseum Vitznau Am 29. Januar 1116 bestätigt Weggis feiert seinen 900. Geburtstag und das Museum feiert Papst Paschalis II. dem Kloster mit. Die Sonderausstellung beleuchtet spotartig Vergangen- Pfäfers unter anderem seine heit und Gegenwart, erzählt vom Dorfleben, den Menschen Rechte und Pflichten, darunter und ihrer Geschichte, von Glauben, Bildung, Arbeit, Freizeit « den Besitz aecclesiam sancte und Natur. Einen Blick in die Zukunft wagen Lernende der » Marie cum villa Guategisso (die Sekundarschule im Wahlfach Theater mit ihrem Beitrag zur Kirche der heiligen Maria mit Ausstellung. -
"Saubannerzug" Und "Ewiges Burgrecht"
Das "torechte Leben" in der bernischen Politik 1477 : "Saubannerzug" und "ewiges Burgrecht" Objekttyp: Chapter Zeitschrift: Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde Band (Jahr): 45 (1983) PDF erstellt am: 10.10.2021 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch 3. Das «torechte Leben» in der bernischen Politik 1477: «Saubannerzug» -

Stadt Luzern Protokoll Nr. 29
Stadt Luzern Grosser Stadtrat AB Vom Grossen Stadtrat Protokoll Nr. 29 genehmigt am über die Verhandlungen 13. November 2014 des Grossen Stadtrates von Luzern Donnerstag, 25. September 2014, 8.00–18.00 Uhr im Rathaus am Kornmarkt Vorsitz: Ratspräsident Jörg Krähenbühl Präsenz: Anwesend sind 46 bzw. 47 Ratsmitglieder Entschuldigt: Joseph Schärli (den ganzen Tag), Thomas Gmür (13.30–15.00 Uhr), Urban Frye (ab 15.30 Uhr) Der Stadtrat ist vollzählig anwesend. Verhandlungsgegenstände Seite 1. Mitteilungen des Ratspräsidenten 6 2. Genehmigung des Protokolls 26 vom 26. Juni 2014 8 3. Bericht und Antrag 18/2014 vom 9. Juli 2014: 8 Initiative „Die Bilder gehören auf die Kapellbrücke – Änderung der Zuständigkeit“ 4. Bericht und Antrag 13/2014 vom 14. Mai 2014: 18 Reglement über das Taxiwesen 5. Interpellation 176, Marcel Lingg und Jörg Krähenbühl namens 26 der SVP-Fraktion, vom 20. März 2014: Unruhe im Taxigewerbe 6. Geschäftsbericht des Grossen Stadtrates von Luzern 49 für das Amtsjahr 2013/2014 Stadt Luzern Sekretariat Grosser Stadtrat Hirschengraben 17 6002 Luzern Telefon: 041 208 82 13 Telefax: 041 208 88 77 E-Mail: [email protected] www.stadtluzern.ch 7. Bericht und Antrag 11/2014 vom 16. April 2014: 49 KKL Luzern Perspektive 2014–2028 8. Volksmotion 152, Markus Christen und Mitunterzeichner/innen, 56 vom 6. Februar 2014: Stopp dem Wildwuchs von Antennenanlagen in Wohnquartieren 9. Bericht und Antrag 1/2014 vom 5. Februar 2014: 61 Kultur-Agenda 2020 Planungsbericht des Stadtrates 10. Interpellation 204, Albert Schwarzenbach namens der CVP-Fraktion, 73 vom 4. Juni 2014: Offene Fragen zur „Salle Modulable“ 11. Postulat 211, András Özvegyi namens der GLP-Fraktion, vom 20. -

Zwischen Genf Und Aarau Der Helvetische Religionsfrieden
ZWISCHEN GENF UND AARAU Der helvetische Religionsfrieden Von Joëlle Kuntz m Nachmittag des 11. August 1712 erklingen an eine Miliz erinnert. Wenn die ganze Armee aus solchen Trompetenfanfaren in der Stadt Aarau: Vertreter Truppen bestünde, wäre sie einfacher zu befehligen». der Kantone Zürich und Bern einerseits sowie Die Genfer tragen dazu bei, die Kämpfe zu Gunsten der A der Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden Protestanten zu entscheiden. Der Preis sind zehn Tote und und Zug andererseits haben den nationalen Frieden sieben Verletzte – wenig im Vergleich zu den Verlusten unterzeichnet und damit einen rechtlichen Strich unter auf Seiten der Katholiken. In der Chronik befindet sich ein die unzähligen Schikanen gezogen, denen sich die beiden Brief an den Genfer Justizsekretär J.-J. Trembley, in dem ein Konfessionsgruppen gegenseitig ausgeliefert haben. Adliger und Teilnehmer der Schlacht schreibt: «Unsere Zwischen den katholischen und den reformierten Orten Deutschen haben mit viel Standhaftigkeit gekämpft, der Eidgenossenschaft wird die konfessionelle Parität die Waadtländer gut, die Neuenburger passabel und die eingeführt. Genfer wie die Löwen. Ihnen gebührt der ganze Ruhm an diesem Tag oder jedenfalls fast der ganze.» Bern zeigt Ein bisschen ist der Frieden von Aarau auch Genf sich dankbar. Trembley selbst berichtet: «Der Ehre und zu verdanken. Der vierte Landfrieden beendet einen Würdigung, die unseren Soldaten zuteil werden, lässt sich kurzen, heftigen Konflikt: Zwischen Frühling und nichts hinzufügen, man spricht nur von denen aus Genf, Sommer 1712 wütet der blutigste Religionskrieg, den welche die Berner Herrschaften seit dem Krieg als ihre die Schweiz je gekannt hat. In Villmergen stehen sich besten Verbündeten betrachten.» katholische Kantone und die zwei protestantischen Kantone, die am meisten Macht im Toggenburg Die Allianz wirkt in beide Richtungen. -

Bruderklausenweg
Bruderklausenweg Wegbeschreibung Stans - Flüeli-Ranft und Informationen Bruderklausenweg Geschichte Nach dem Sieg über Burgund konnten sich die Der Bruderklausenweg wurde 1981 eröff net und Städte und Länder der Acht Alten Orte der Eid- ermöglicht es dem Wanderer und Pilger, dem genossenschaft nicht einigen. Die Abgeordneten Weg des Stanser Pfarrers zu Bruder Klaus zu an der Tagsatzung zu Stans 1481 stritten über folgen. Auch die Jakobspilger benützen ihn auf die Aufnahme von Freiburg und Solothurn in den ihrem Weg nach Santiago. Zum 600 Jahr Jubiläum Bund, über die Verteilung der Kriegsbeute sowie 2017 wurde der Bruderklausenweg erneuert. Er über die künftige Staatsform der jungen Schweiz. ist nun wieder lückenlos mit den gelben Wegwei- Ein Bürgerkrieg drohte. Deshalb eilte der Pfarrer sern und dem Visionsbild sowie mit den grünen von Stans, Heimo am Grund, in der Nacht vom Routenfeldern von SchweizMobil als Nr. 571 21. auf den 22. Dezember 1481 zum Einsiedler beschildert. Bruder Klaus in den Ranft. Dort erhielt er Rat, kehrte schnell nach Stans zurück, rief die zur Abreise bereiten Boten nochmals zusammen und teilte ihnen die Ermahnungen von Bruder Klaus mit. Daraufhin einigte sich die Tagsatzung und besiegelte das Stanser Verkommnis (siehe auch die Kurzfassung des „Stanser Verkommnis 1481“ am Ende dieser Broschüre). 2 Aus «Wandern in Nidwalden+», 2016, ISBN 978-3-906997-77-3 3 Routenbeschreibung Von Stans zum Flüeli Ranft Stans – Murmatt Sitzplätzen, Feuerstelle, fl iessend Wasser und Ob dem Dorfplatz, zwischen Pfarrkirche und Toilette. Winkelrieddenkmal steigen wir die Knirigasse hin auf. Nach der Knirikapelle überschreiten wir Rastplatz Rohrnerberg - Halten – die Geleise der Stanserhornbahn und erreichen Oberhostett – Kantonsgrenze an saftigen Matten vorbei die Christenmatt, Ca.