Masterarbeit Der Fall Minusma
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Annual Report 2017-2018
US Governor Philip D. Murphy (New Jersey) Annette Riedel, Senior Editor, Deutschlandfunk Kultur Berlin Transatlantic Forum 2018: “Present at the New Creation? Tech. Power. Democracy.” October 16, 2018 3 4 PREFACE Dear Friends of Aspen Germany, In 2017, we also had three US mayors in quick succession as guests of Aspen Germany: Mayor Pete Buttigieg of 2017 and 2018 were years of world-wide political and South Bend, Indiana, Mayor Eric Garcetti of Los Angeles, economic changes. The international order, established and Mayor Rahm Emanuel from Chicago. All three events 70 years ago under US leadership after World War II, is attracted high-ranking transatlanticists from the Bundestag, now being challenged by the rise of populism, the rise of think tanks, and political foundations as well as business authoritarian regimes from Russia, China, Turkey, and representatives. The goal of these events was to facilitate a fundamental changes in US policy under President Donald transatlantic discussion about the future course of the Trump. United States after Trump’s election. In the last two years, we have seen an erosion in the core of Throughout both years, we have also continued our our transatlantic alliance. From NATO and our common transatlantic exchange programs. The Bundestag and security interests to our trade relations, from our approach &RQJUHVV6WD൵HUV([FKDQJH3URJUDPEURXJKWVWD൵HUVIURP to climate change to arms control – everything we have WKH86&RQJUHVVWR%HUOLQDQGVWD൵HUVIURPWKH*HUPDQ taken for granted as a stable framework of transatlantic Bundestag to Washington, D.C.. Over the years, we have relations is now being questioned. These dramatic changes built a robust network of young American and German did not go unnoticed by us. -

(Jens Spahn), Ralph Brinkhaus
Sondierungsgruppen Finanzen/Steuern CDU: Peter Altmaier (Jens Spahn), Ralph Brinkhaus CSU: Markus Söder, Hans Michelbach SPD: Olaf Scholz, Carsten Schneider Wirtschaft/Verkehr/Infrastruktur/Digitalisierung I/Bürokratie CDU: Thomas Strobl, Carsten Linnemann CSU: Alexander Dobrindt, Ilse Aigner, Peter Ramsauer SPD: Thorsten Schäfer-Gümbel, Anke Rehlinger, Sören Bartol Energie/Klimaschutz/Umwelt CDU: Armin Laschet, Thomas Bareiß CSU: Thomas Kreuzer, Georg Nüßlein, Ilse Aigner SPD: Stephan Weil, Matthias Miersch Landwirtschaft/Verbraucherschutz CDU: Julia Klöckner, Gitta Connemann CSU: Christian Schmidt, Helmut Brunner SPD: Anke Rehlinger, Rita Hagel Bildung/Forschung CDU: Helge Braun, Michael Kretschmer CSU: Stefan Müller, Ludwig Spaenle SPD: Manuela Schwesig, Hubertus Heil Arbeitsmarkt/Arbeitsrecht/Digitalisierung II CDU: Helge Braun, Karl-Josef Laumann CSU: Stefan Müller, Emilia Müller SPD: Andrea Nahles, Malu Dreyer Familie/Frauen/Kinder/Jugend CDU: Annegret Kramp-Karrenbauer, Nadine Schön CSU: Angelika Niebler, Paul Lehrieder SPD: Manuela Schwesig, Katja Mast Soziales/Rente/Gesundheit/Pflege CDU: Annegret Kramp-Karrenbauer, Hermann Gröhe, Sabine Weiss CSU: Barbara Stamm, Melanie Huml, Stephan Stracke SPD: Malu Dreyer, Andrea Nahles, Karl Lauterbach Migration/Integration CDU: Volker Bouffier, Thomas de Maizière CSU: Joachim Herrmann, Andreas Scheuer SPD: Ralf Stegner, Boris Pistorius Innen/Recht CDU: Thomas Strobl, Thomas de Maizière CSU: Joachim Herrmann, Stephan Mayer SPD: Ralf Stegner, Eva Högl Kommunen/Wohnungsbau/Mieten/ländlicher -

Drucksache 18/10796
Deutscher Bundestag Drucksache 18/10796 18. Wahlperiode 22.12.2016 Unterrichtung durch die Delegation der Bundesrepublik Deutschland in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 20. bis 24. Juni 2016 Inhaltsverzeichnis Seite I. Delegationsmitglieder ..................................................................... 2 II. Einführung ...................................................................................... 3 III. Ablauf der 3. Sitzungswoche 2016 ................................................. 4 III.1 Wahlen und Geschäftsordnungsfragen ............................................. 4 III.2 Schwerpunkte der Beratungen .......................................................... 4 III.3 Auswärtige Redner ............................................................................ 9 IV. Tagesordnung der 3. Sitzungswoche 2016 .................................... 10 V. Verabschiedete Empfehlungen und Entschließungen ................. 13 VI. Reden deutscher Delegationsmitglieder ........................................ 43 VII. Funktionsträger der Parlamentarischen Versammlung des Europarates ............................................................................... 51 VIII. Ständiger Ausschuss vom 27. Mai 2016 in Tallinn ....................... 53 IX. Mitgliedsländer des Europarates ................................................... 55 Drucksache 18/10796 – 2 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode I. Delegationsmitglieder Unter Vorsitz von Delegationsleiter -

An Den Parteitag 2019
Anträge an den Parteitag 2019 85. Parteitag der Christlich-Sozialen Union 18./19. Oktober 2019, München 2 Herausgeber: CSU-Landesleitung, Franz Josef Strauß-Haus Mies-van-der-Rohe-Str. 1, 80807 München Verantwortlich: Dr. Carolin Schumacher, Hauptgeschäftsführerin der CSU Redaktion: Werner Bumeder, Florian Bauer, Karin Eiden, Isabella Hofmann Auflage: Oktober 2019 (Stand: 04.10.2019) 3 4 Zusammensetzung der Antragskommission 2019 Stefan Müller, MdB Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Vorsitzender der Antragskommission Dr. Markus Söder, MdL Bayerischer Ministerpräsident, Vorsitzender der CSU Markus Blume, MdL Generalsekretär der CSU Florian Hahn, MdB Stellvertretender Generalsekretär der CSU, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Angelegenheiten der Europäischen Union in der CDU/CSU-Fraktion Dr. Carolin Schumacher Hauptgeschäftsführerin der CSU Dorothee Bär, MdB Stellvertretende Vorsitzende der CSU, Staatsministerin im Bundeskanzleramt, Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung Dr. Kurt Gribl Stellvertretender Vorsitzender der CSU, Oberbürgermeister der Stadt Augsburg Melanie Huml, MdL Stellvertretende Vorsitzende der CSU, Bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege Dr. Angelika Niebler, MdEP Stellvertretende Vorsitzende der CSU, Vorsitzende der CSU-Europagruppe Manfred Weber, MdEP Stellvertretender Vorsitzender der CSU, Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament 5 Alexander Dobrindt, MdB Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag, Erster Stellvertretender -

Beschlussempfehlung Und Bericht Des Innenausschusses (4.Ausschuss)
Deutscher Bundestag Drucksache 16/9112 16. Wahlperiode 07. 05. 2008 Beschlussempfehlung und Bericht des Innenausschusses (4. Ausschuss) 1. zu dem Antrag der Abgeordneten Ernst Burgbacher, Gisela Piltz, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP – Drucksache 16/8115 – Vorschlag für einen Rahmenbeschluss des Rates über die Verwendung von Fluggastdatensätzen zu Strafverfolgungszwecken 2. zu dem Antrag der Abgeordneten Silke Stokar von Neuforn, Volker Beck (Köln), Monika Lazar, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Drucksache 16/8199 – Keine Speicherung von EU-Fluggastdaten A. Problem Die Anträge der Fraktion der FDP sowie der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bezwecken, dass sowohl der Deutsche Bundestag als auch die Bundesregierung den Vorschlag zu einem EU-Rahmenbeschluss zur Einrichtung eines Systems zur Auswertung von Fluggastdaten ausdrücklich ablehnen. Aus- führlich begründen beide Anträge, dass die angestrebte Verarbeitung von Flug- gastdaten einen erheblichen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbst- bestimmung darstellt. B. Lösung Zu Nummer 1 Ablehnung des Antrags auf Drucksache 16/8115 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP und DIE LINKE. bei Stimmenthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Drucksache 16/9112 – 2 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode Zu Nummer 2 Ablehnung des Antrags auf Drucksache 16/8199 mit den Stimmen der Frak- tionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN C. Alternativen Annahme des Antrags der Fraktion der FDP auf Drucksache 16/8115 bzw. Annahme des Antrags der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Druck- sache 16/8199. D. Kosten Wurden nicht erörtert. -

Vorabfassung
Deutscher Bundestag Drucksache 19/14073 19. Wahlperiode 16.10.2019 Vorabfassung Antrag der Abgeordneten Ulrike Schielke-Ziesing, Marc Bernhard, Jürgen Braun, Marcus Brühl, Tino Chrupalla, Joana Cotar, Siegbert Droese, Peter Felser, Dr. Götz Frömming, Albrecht Glaser, Franziska Gminder, Mariana Harder-Kühnel, Verena Hartmann, Lars Herrmann, Martin Hess, Dr. Heiko Heßenkemper, Karsten Hilse, Martin Hohmann, Leif-Erik Holm, Jens Kestner, Stefan Keuter, Norbert Kleinwächter, Enrico Komning, Jörn König, Frank Magnitz, Jens Maier, Andreas Mrosek, Christoph Neumann, Ulrich Oehme, Frank Pasemann, Tobias Matthias - Peterka, Dr. Robby Schlund, Uwe Schulz, Detlev Spangenberg, Dr. Dirk Spaniel, wird Dr. Christian Wirth und der Fraktion der AfD durch Ostdeutsche Arbeitnehmer würdigen – Fondslösung mit Einmalzahlungen Der Bundestag wolle beschließen: die I. Der Deutsche Bundestag stellt fest: lektorierte Die Rentner der gesetzlichen Rentenversicherung, die Ihr Erwerbsleben im We- sentlichen in der DDR zurückgelegt haben, beziehen zumeist Renten, die sie vor klassischer Altersarmut bewahren. Das Versorgungsniveau der ostdeutschen Rentner liegt jedoch zum großen Teil deutlich unterhalb des Niveaus vergleich- barer westdeutscher Rentner. Ein weiterer Teil der ostdeutschen Rentner bezieht nur geringe Renten, häufig auch bedingt durch Brüche in der Erwerbsbiografie nach der Wende und anschlie- ßenden Verdiensten im Niedriglohnsektor; diese Rentner sind wiederum teilweise von Altersarmut betroffen. Fassung Bei der in den 90iger Jahren erfolgten Rentenüberleitung -

D) Frau Kollegin! Marlene Rupprecht (Tuchenbach) (SPD
23628 Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode – 217. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 23. April 2009 (A) Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt: b) Beratung des Antrags der Abgeordneten (C) Frau Kollegin! Wolfgang Neškovi , Ulla Jelpke, Ulrich Maurer, Bodo Ramelow und der Fraktion DIE LINKE Marlene Rupprecht (Tuchenbach) (SPD): Keine Schusswaffen in Privathaushalten – Än- Ich wünsche mir, dass die Ergebnisse der Auswertun- derung des Waffenrechts gen der Fachhochschule Coburg und des bayerischen Landgerichtstages betreffend die Wirkungen und die – Drucksache 16/12395 – Mängel im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes auf Überweisungsvorschlag: bayerischer Ebene berücksichtigt werden. Innenausschuss (f) Sportausschuss Rechtsausschuss Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt: Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Frau Kollegin! Verbraucherschutz Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Marlene Rupprecht (Tuchenbach) (SPD): ZP 8 Erste Beratung des von den Abgeordneten Wir haben festgestellt, dass die Mängel nicht im Ge- Hartfrid Wolff (Rems-Murr), Dr. Max Stadler, setz, sondern im Vollzug bestehen. Ich wünsche mir, Gisela Piltz, weiteren Abgeordneten und der dass wir dies bei den Beratungen und der Anhörung be- Fraktion der FDP eingebrachten Entwurfs eines rücksichtigen. Ich hoffe, dass wir alle in diesem Sinne Gesetzes zur Änderung des Waffengesetzes zusammenarbeiten werden. – Drucksache 16/12663 – (Beifall bei der SPD und der LINKEN) Überweisungsvorschlag: Innenausschuss (f) Entschuldigung, das kommt, wenn man als Letzte redet, Sportausschuss Frau Präsidentin. – Ich hoffe, dass wir dies schaffen. Rechtsausschuss Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt: Frau Kollegin, wollen Sie noch die Dinge mitnehmen, Nach einer interfraktionellen Verabredung ist für die die Sie auf dem Pult haben liegen lassen? Aussprache eine halbe Stunde vorgesehen, wobei die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fünf Minuten erhalten soll. -

Nicht Knechte Sondern Brüder • Jeder Flüchtling Hat Seine Geschichte
ISSN 1866-0843 HEFT 297/ 298 – 1_ / 2_2015 55. JAHRGANG technisch machbar! ethisch möglich? Flüchtlingsproblematik: GKS-Akademie Bundeskonferenz • Nicht Knechte Oberst Helmut Korn: GKS: sondern Brüder • Programm • Programm- • Jeder Flüchtling und Organisa- entwurf hat seine Geschichte tionshinweise • Gleichgültige EU? INHALT AUFTRAG 297 / 298 • 1_ / 2_2015 • 55. JAHRGANG EDITORIAL . 3 AUS DEN SACHAUSSCHÜSSEN SEITE DES BUNDESVORSITZENDEN . 4 SACHAUSSCHUSS INNERE FÜHRUNG SEITE GEISTLICHER BEIRAT . 5 „Neue Bundeswehr – neues Weißbuch“ Gast: Dr. Hans-Peter Bartels (MdB) SICHERHEIT UND FRIEDENSETHIK von Bertram Bastian . 46 „Nicht mehr Knechte, sondern Brüder“ „Bundeswehr 2030“ Friedensbotschaft des Papstes 2015 . 6 Gast: Agnieszka Brugger(MdB) „Jeder Flüchtling hat eine Geschichte“ von Bertram Bastian . 47 zur Flüchtlingsproblematik im Mittelmeerraum von Carl-H. Pierk . 10 SACHAUSSCHUSS SICHERHEIT UND FRIEDEN Arabische Welt im Umbruch auf dem Weg Frieden ist möglich und geboten zur Demokratie oder Marsch ins Ungewisse Gast: Florian Hahn (MdB) Bericht von Rainer Zink . 13 von Rufi n Mellentin . 48 Algerien – Bedeutung für die regionale Sicherheit AUS BEREICHEN, STANDORTEN UND GKS Bericht von Rainer Zink . 15 Für eine menschenwürdige Flüchtlingspolitik GKS-KREIS BAD NEUENAHR – AHRWEILER Erklärung des Zentralkomitees der deutschen „Abstimmung mit Füßen“ . 50 Katholiken . 16 „Technisch möglich – ethisch machbar?“ . 50 Gleichgültige Europäische Union? GKS-BEREICH WEST von Bertram Bastian . 17 Familienwerkwoche . 50 GESELLSCHAFT NAH UND FERN Bereichskonferenz I/15 . 52 Taliban in Afghanistan GKS-KREIS KOBLENZ von Seckin Sölyemez und Andreas Rauch . 18 „Gutes reden, gut denken, gut handeln“ BILD DES SOLDATEN Christen und Jesiden . 53 Fußwallfahrt Retzenbach von Rainer Zink . 23 GKS-KREIS MÜNCHEN Politikergespräch mit „Friede mit Gott und mit dem Nächsten“ Julia Obermeier (MdB) . 54 Weltfriedenstag in Köln von Bertram Bastian . -

Drucksache 19/22546
Deutscher Bundestag Drucksache 19/22546 19. Wahlperiode 16.09.2020 Antrag der Abgeordneten Roman Johannes Reusch, Marc Bernhard, Peter Boehringer, Jürgen Braun, Marcus Bühl, Petr Bystron, Tino Chrupalla, Joana Cotar, Peter Felser, Dr. Götz Frömming, Markus Frohnmaier, Albrecht Glaser, Franziska Gminder, Wilhelm von Gottberg, Armin-Paulus Hampel, Martin Hebner, Karsten Hilse, Martin Hohmann, Leif-Erik Holm, Johannes Huber, Jens Kestner, Jörn König, Enrico Komning, Steffen Kotré, Jens Maier, Dr. Lothar Maier, Andreas Mrosek, Christoph Neumann, Ulrich Oehme, Tobias Matthias Peterka, Paul Viktor Podolay, Jürgen Pohl, Stephan Protschka, Dr. Robby Schlund, Uwe Schulz, Detlev Spangenberg, Dr. Dirk Spaniel, René Springer, Dr. Harald Weyel, Stephan Brandner, Siegbert Dröse, Dr. Michael Espendiller, Dietmar Friedhoff, Kay Gottschalk, Verena Hartmann, Martin Hess, Dr. Marc Jongen, Dr. Birgit Malsack-Winkemann, Volker Münz, Gerold Otten, Frank Pasemann, Martin Reichardt, Thomas Seitz, Martin Sichert, Dr. Christian Wirth und der Fraktion der AfD Sofortige Beendigung der zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und Vertretern der katholischen und evangelischen Kirche am 24. Februar 2015 getroffenen Vereinbarung zum Kirchenasyl Der Bundestag wolle beschließen: I. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, dass der Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat gegenüber dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Weisung erteilt, die mit den Vertretern der katholischen und evangelischen Kirche am 24. Februar 2015 getroffene Vereinbarung zum Kirchenasyl mit sofortiger Wirkung zu beenden. Berlin, den 1. Februar 2019 Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gauland und Fraktion Drucksache 19/22546 – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode Begründung Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat mit Vertretern der katholischen und evangelischen Kirche am 24. -

Hinter Jedem Mann Gleichberechtigung Bei Der Kür Der Direktkandidaten Für Die Bundestagswahl Blieben Unions - Politikerinnen Auffallend Chancenlos
F I A L / K C E B M A L P N A I T S I R H C S N A H Weibliche Abgeordnete im Deutschen Bundestag: „Mit dem Wettkampf tun sich Männer leichter“ Hinter jedem Mann Gleichberechtigung Bei der Kür der Direktkandidaten für die Bundestagswahl blieben Unions - politikerinnen auffallend chancenlos. Frauenverbände beklagen Diskriminierung. Zu Recht? it der Parole „Frauen von heute lor auf der Nominierungsversammlung Merkels Appell an die Landes verbände, warten nicht auf Wunder. Wir ma - gegen einen Mann. Alois Karl, 66, möchte bei der Kandidatenaufstellung für die Bun - Mchen sie“ zog die CSU-Bundes - nach zwölf Jahren als Hinterbänkler im destagswahl auf einen an gemessenen Frau - tagsabgeordnete Barbara Lanzinger vor Parlament noch eine vierte Legislatur - enanteil zu achten, zeigte bislang wenig einem halben Jahr in den Kampf um das periode dranhängen. Nur einer ihrer drei Wirkung. „Wir haben da wieder große Pro - Bundestagsdirektmandat im oberpfälzi - Bundestagskolleginnen gelang der ange - bleme“, monierte Merkel beim Netzwerk - schen Wahlkreis Amberg. strebte Aufstieg vom Listling zur Direkt - treffen der Unionsfrauen im Februar. Eine Direktkandidatur zu ergattern ist at - kandidatin: der Hofer Juristin Silke Lau - Die Kasseler Professorin für Öffentliches traktiv für CSU-Politiker, weil sie den siche - nert, Mitglied im Parteivorstand. Insge - Recht Silke Ruth Laskowski sagt: „Frauen ren Einzug in den Bundestag garantiert: 2013 samt sind gerade mal 17 Prozent der haben bei der Kandidatenkür nicht die glei - holten die Christsozialen alle Wahlkreise in Direktkandidaten in den 46 bayerischen chen Chancen wie Männer.“ Die „subtile Bayern. Direkt vom Volk gewählt bedeutet Bundestagswahlkreisen Frauen. Diskriminierung“ von Frauen, die im Orts - auch einen höheren politischen Wert. -

Nein-Stimmen: 32 Enthaltungen: 13 Ungültige: 0
Deutscher Bundestag 89. Sitzung des Deutschen Bundestages am Freitag, 27.Februar 2015 Endgültiges Ergebnis der Namentlichen Abstimmung Nr. 1 Antrag des Bundesministeriums der Finanzen Finanzhilfen zugunsten Griechenlands; Verlängerung der Stabilitätshilfe Einholung eines zustimmenden Beschlusses des Deutschen Bundestages nach § 3 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 2 Nummer 2 des Stabilisierungsmechanismusgesetzes auf Verlängerung der bestehenden Finanzhilfefazilität zugunsten der Hellenischen Republik Drs. 18/4079 und 18/4093 Abgegebene Stimmen insgesamt: 586 Nicht abgegebene Stimmen: 45 Ja-Stimmen: 541 Nein-Stimmen: 32 Enthaltungen: 13 Ungültige: 0 Berlin, den 27.02.2015 Beginn: 11:05 Ende: 11:10 Seite: 1 Seite: 2 Seite: 2 CDU/CSU Name Ja Nein Enthaltung Ungült. Nicht abg. Stephan Albani X Katrin Albsteiger X Peter Altmaier X Artur Auernhammer X Dorothee Bär X Thomas Bareiß X Norbert Barthle X Günter Baumann X Maik Beermann X Manfred Behrens (Börde) X Veronika Bellmann X Sybille Benning X Dr. Andre Berghegger X Dr. Christoph Bergner X Ute Bertram X Peter Beyer X Steffen Bilger X Clemens Binninger X Peter Bleser X Dr. Maria Böhmer X Wolfgang Bosbach X Norbert Brackmann X Klaus Brähmig X Michael Brand X Dr. Reinhard Brandl X Helmut Brandt X Dr. Ralf Brauksiepe X Dr. Helge Braun X Heike Brehmer X Ralph Brinkhaus X Cajus Caesar X Gitta Connemann X Alexandra Dinges-Dierig X Alexander Dobrindt X Michael Donth X Thomas Dörflinger X Marie-Luise Dött X Hansjörg Durz X Jutta Eckenbach X Dr. Bernd Fabritius X Hermann Färber X Uwe Feiler X Dr. Thomas Feist X Enak Ferlemann X Ingrid Fischbach X Dirk Fischer (Hamburg) X Axel E. -
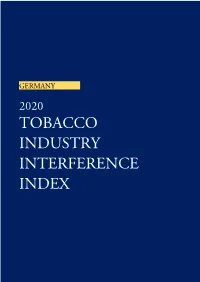
TOBACCO INDUSTRY INTERFERENCE INDEX September 2020
GERMANY 2020 TOBACCO INDUSTRY INTERFERENCE INDEX September 2020 Acknow e!"ements $%# report w&# written by L&)ra Graen. $e a)thor wo) ! l%ke to th&nk Katrin Sch& er and Ute Mons o- t+e Germ&n C&ncer Re#e&rch Center (DKF/0, Jo+&nne# Spatz o- Forum Smoke4Free, J&n Sch) 3 and Sonj& von Eichborn o- Unf&irtobacco1 M&rtina Pötsc+ke4(&nger o- the Germ&n Smoke-ree A %&nce (ABNR0 a# we a# Timo L&nge o- LobbyContro w+o pro6%!e! input and fee!back. $e a)thor wo) ! a #o like to e9pre## sincere gratitu!e to M&ry A##)nta o- t+e G oba Center for Goo! Go6ernance in Tobacco Contro (GGTC0 for her technica a!vice* $%# report i# f)nde! by B oomberg Ph% &nthropie# t+ro)"+ Stoppin" Tobacco Org&niz&tions &nd Pro!)cts (STO70* Endorse! by Germ&n Me!ica Action Gro)p Smoking or He& th (;ARG0, Germ&n NCD A %&nce (DANK), Germ&n Re#piratory Societ' (DG70, Germ&n C&ncer Re#e&rch Center (DKF/01 FACT e*<. – >omen A"&inst Tobacco1 Frie!en#band1 Institute for Therapy and He& th Re#e&rch (IFT Nord01 Center for A!!iction Prevention Ber in, R&)ch-rei Pl)# – He& th f&cilitie# for co)nse ing and tobacco ce##&tion, Unf&irtobacco1 V%6&nte# Ho#pita Ne)kö n 2 Table o- Content# B&ckgro)nd and Intro!)ction*****************************************************************************************************? Tobacco and H)m&n r%"+t#*****************************************************************************************************? (&ck o- Tobacco Contro Me&#)re# in Germ&ny D)e to Ind)#tr' Interference************************? Tobacco Ind)#tr' in Germ&ny*************************************************************************************************@