Masterarbeit/Master's Thesis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
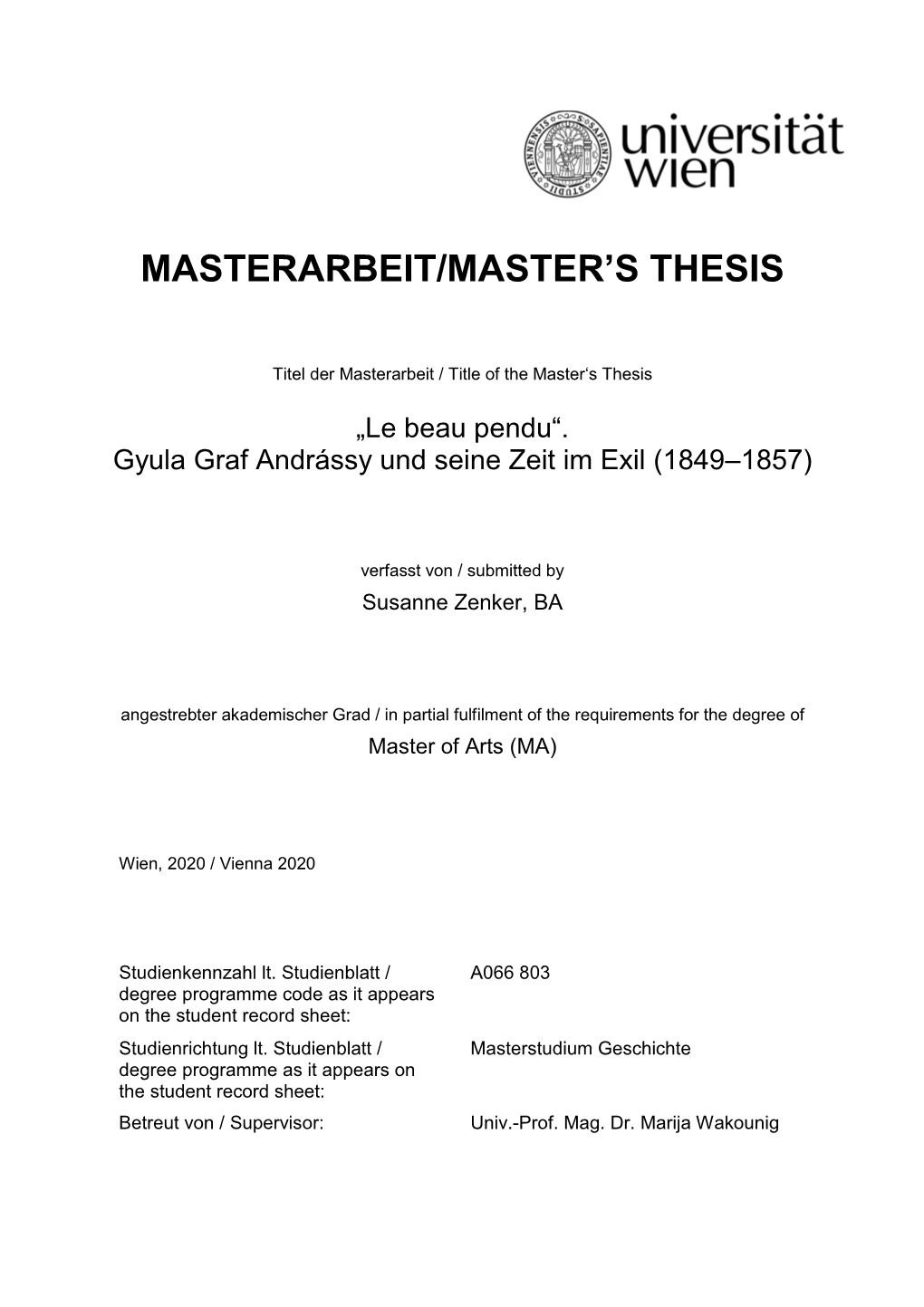
Load more
Recommended publications
-

Kmety Györgyre Kiművelt Emberfők Fullerének: Szépség És Hasznosság
Magyar Tudomány A Római Birodalom ökológiai hatásai Hetvenéves fehér folt Emlékezés Guyon Richárdra és Kmety Györgyre Kiművelt emberfők Fullerének: szépség és hasznosság 13•9511 Magyar Tudomány • 2013/9 A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata. Alapítás éve: 1840 174. évfolyam – 2013/9. szám TARTALOM Tanulmány Grüll Tibor: A Római Birodalom ökológiai hatásai ………………………………… 1026 Hargittai István: Hetvenéves fehér folt ……………………………………………… 1035 Hóvári János: Honvédtábornokok a késői oszmán haderőben. Főszerkesztő: Emlékezés Guyon Richárdra és Kmety Györgyre ……………………………… 1046 Csányi Vilmos Hermann Róbert: Két honvédtábornok, akikből török pasa lett – kétszáz éve született Guyon Richárd és Kmety György …………………………… 1056 Szerkesztőbizottság: Lovász László: Kiművelt emberfők ………………………………………………… 1071 Bencze Gyula, Bozó László, Császár Ákos, Hamza Gábor, Gángó Gábor: Eötvös József a „materialisták” ellen. Kovács Ferenc, Ludassy Mária, Solymosi Frigyes, A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének újraengedélyezése Spät András, Szegedy-Maszák Mihály, Vámos Tibor és a Gondolatok keletkezése ……………………………………………………… 1081 Gyarmathy Éva: Diszlexia, a tanulás/tanítás és a tudományok a digitális kultúrában. A lapot készítették: Egy tranziens korszak dilemmái ……………………………………………… 1086 Elek László, Gazdag Kálmánné, Halmos Tamás, Holló Virág, Baranyi József – Jóźwiak Ákos – Varga László – Mézes Miklós – Majoros Klára, Makovecz Benjamin, Matskási István, Beczner Judit – Farkas József: A hálózatkutatás, a bioinformatika Perecz László, Sipos Júlia, Szabados -

Hungary's Relations with the Ottoman Empire
HUNGARY’S RELATIONS WITH THE OTTOMAN EMPİRE GEZA FEHER* The paths of the Turkish and Hungarian peoples, from their prehistory to these days have been connected by hundreds of threads. An objective evaluation of the connection between Turkey and Hungary in the 16th-17th centuries /the Turkish occupation of Hungary/, as well as in the 18th-19th centuries /a generous relation, fruitful for both parties/ requires going back to the most ancient past common to them. As far as we know at present, the original home of the Hungarian na- tion /the Magyars/—whose way of life at that time was determined by fishing and hunting— might have been at the western ranges of the Ural, in the provinces around the rivers Volga and Kama. After migrating from the original home southward, the Hungarian nation lived, for centuries, in the neighbourhood of Iranian and Turkish-speaking tribes, in the northen region of the Eurasian steppes. Here the Hungarians, though at a slow pace, changed över to animal keeping. When their culture and economy had changed, their vocabulary became enriched with Iranian and Turkish words. However, the ansvvers to the questions that might be raised in con nection with this process, are given, as we have not any written sources, first of ali by the results of linguistics, archeology, and anthropology. In the second half of the 5th century, when, in a wave of the great invasions, the Turkish peoples dragged the Hungarian nation along with them, and, hence, the latter drifted to the south of its earlier settlement, to the coast of the Black Sea and the regions beside the river Kuban, the connection between the two nations became closer. -
James J. Reid I. Introduction: Reform and Related Concepts to Ask The
James J. Reid Was There A Tanzimat Social Reform? I. Introduction: Reform and Related Concepts To ask the question “Was there a Tanzimat Social Reform?” might seem like heresy to a devoted pro-Turkish or Turkish nationalist scholar. That social change occurred, one cannot doubt. But most of the changes occurred less as the result of any specific reform party, and simply through the processes of time. The exertions of groups or individuals limited to their own spheres of activity also had an effect upon social changes within the Ottoman Empire. Social reform has historically evolved either through the efforts of a reform party in a democratic or republican society —the abolitionists of the United States in the early to mid-19th-century, for example— or the mandate of an autocratic or to talitarian regime —national-Socialist and Communist social engineering in Germany and the Soviet Union respectively in the 20th century. In tention to reform is simply not enough to say that a reform occurred. Evidence for the Ottoman Empire suggests that even in the Tanzimat, liberal reformers who hoped to make substantive social changes often went into compulsory exile. Reformers who remained in place in the Ot toman state sought to implement a regime of social stasis without any effort to understand the very real changes gripping society at every level. What else could one expect in an era of Restoration? Scholars have generally associated the 19th-century Ottoman re forms collectively known as the Tanzimat in Ottoman and Turkish sources with an Enlightenment approach to society. A close examina tion of the sources at numerous levels indicates that the influence of the Enlightenment was almost nonexistent. -
Conversion and Apostasy in the Late Ottoman Empire Selim Deringil Index More Information
Cambridge University Press 978-1-107-00455-9 - Conversion and Apostasy in the Late Ottoman Empire Selim Deringil Index More information Index Abbot, Yanko, German consul, 99, 100 Ali Rıza/Kevork, 143, 250, 251 “Abdelhak”, 176 Aleppo, 7, 45, 165–166, 168, 229–232 Abdi Pas¸a, imperial chancellor, 46 “ambiguous belief systems”, 17–19 abduction, 40, 89, 224, 227; of women and Anderson, Benedict, 2–3 girls, 5, 89, 214, 224, 226, 239 Andreadis, Yorgo, 118–121, 139–140 Abdülhamid II (r. 1876–1909), 27, 64, 83, Anzelm, Albert, 168 102, 105, 124, 151, 167, 197, 199, apostasy, see also conversion, as martyrdom, 200–202, 204, 206, 208, 213, 233–236, 4; foreign protection of, 7; comparison 239, 242, 252; Islamist étatisme, 124; with earlier periods, 8–12; present-day responsibility for Armenian massacres, stigma attached to, 12; seen as treason, 13; 27, 83, 233–235 as “Imperial Headache”, 38–42; abolition Abdullah Hasib Bey (inspector of foreign of death penalty for, 20–23, 60–61; schools), 180 devaluation of, 249–251 Abdülmecid I (r. 1839–1861), 7, 24, 32, 33, “apostasy crisis” (1843), 69–75 36, 53, 73, 84, 85, 163, 166, 173; bans Arif Hikmet Efendi (S¸eyhülislam), 36, 53, execution of apostates, 7; role in 54, 65, 66, 76, 227, 228, 244 Tanzimat, 32 Armenian Apostolic Church, 148, 149 Aberdeen, Lord (British foreign Armenian Catholics, 7, 42, 63, 207, 21 secretary), 70 Armenian massacres, 27, 124, 134, 200–201, Abu Manneh, Butrus, 32–34, 38, 54, 73 202, 211, 213, 235, 236, 246, 249, Adanir, Fikret, 4, 11, 114 Armenian millet, 45–47, 48, 221, 239 -

18 More Than 120 Years Ago, in 1892, József Ambrus, the Parish Priest
MILITARY CLERGY IN THE DIOCESE OF CSANÁD IN 1848–1849 PÉTER ZAKAR ABSTRACT More than 120 years ago, in 1892, József Ambrus, the parish priest from the Diocese of Csanád in Kisorosz, published a volume on the military clergy participants in the Hungarian Revolution of 1848. In the midst of the church conflicts and national identity questions that were raging in the 1890s, the patriotism of Catholic priests was increasingly being called into question. Ambrus expressed his disappointment that “patriotism today is a matter of throat and pen”, and he condemned the kind of “small-minded view” that considered only Hungarian speakers to be Hungarians. In his work he aimed to prove the patriotism of the linguistically and culturally diverse Catholic clergy during the Revolution of 1848. “Those who, through a thousand dangers and storms, sacrificed their blood and lives, deserve not to be forgotten. We owe it to them to prove with facts and names, to the country and to the world, that the Catholic clergy, not only in the churches and on the pulpit, not only through words but through actions, on the battlefield, in fire and water, in the smoke of guns and cannonballs, was as patriotic and brave as anyone.” These were the words with which Ambrus in his preface summarized the task before him.1 One hundred and twenty years in itself would be a good enough reason to take into account the more recent literature, even if we restrict the research to the Diocese of Csanád, and taking advantage of the Roman Catholic Diocesan Archives of Temesvár, we take a look again at the history of the clergy in the army. -

2016 02 Delvideki Szemle.Pdf
Délvidéki Szemle Délvidéki Review 2016. III. évfolyam, 2. szám – Vol III. No 2. 2016. DÉLVIDÉKI SZEMLE Délvidéki Review Editor: Péter Zakar Editors: András Döbör, Sándor Fejõs, Lajos Forró Contributor: Bálint Petõ Language Assistants: András Csillag, Éva Csillag International Consultant Corporation: István Fodor (Zenta), Tibor Molnár (Zenta), János Szekernyés (Temesvár), Srðan Cvetkoviæ (Belgrád), Attila Kovács (Ljubljana) Readers: András Döbör, Péter Zakar Technical editor: Ildikó Veres On the cover: Policemen of Martonos. The persons who are marked with an X were killed in 1944. 11. 21. (Source: Archive of Délvidék Kutató Központ) The periodical is published twice a year: in autumn and in spring. The magazine publishes academic, peer-reviewed articles, source reviews and critiques on the past and present of the Southern Region (Délvidék) and the Danube- Körös-Maros-Tisza Euro-Region, as well as articles on public life in the Délvidék, interviews and conference lectures. The Délvidéki Szemle’s (“Délvidéki Review” – The Southern Region Review) “Academi Announcements” column publishes original academic articles, not yet published anywhere else, with their abstracts. The publication contains peer-reviewed studies from all areas of history and social sciences; research results, works processing and compiling new sources, analyses and comprehensive syntheses. The “Public Life” column publishes historical research about the Délvidék, journalism pieces relating to it as well as interviews and the transcripts of conference lectures to which the requirements of academic publications do not apply. In the “Téka” column of the Délvidéki Szemle one can read reviews and critiques of books, films, databases and other media in connection with the Délvidék. The main criterion for publishing academic works that have been submitted to the editors of the periodical is professional quality. -

İhtida Ve İrtidad SELİM DERİNGİL 19 Ağustos 1951’De Ottawa’Da Doğdu
SELİM DERİNGİL İhtida ve İrtidad SELİM DERİNGİL 19 Ağustos 1951’de Ottawa’da doğdu. İsviçre, Fransa ve İngil- tere’de eğitim gördü. 1978’de İngiltere’de University of East Anglia’da doktora derecesini aldı. 1979-2011 arasında Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde ders verdi. ABD, Fransa, İngiltere ve İsrail’de dersler verdi. Yayımlanan ilk kitabı Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikası’dır. Ayrıca Osmanlı son dönemi ve Cumhuriyet tarihi konusunda makaleleri vardır. İktidarın Sembolleri ve İdeoloji II. Abdülhamit Dönemi 1876-1909 (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayınları, 2002) başlıklı kitabın İngilizcesi olan The Well-Protected Domains, Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire 1876-1909, 2001’de “Turkish Studies Association Fuad Köprülü” ödülünü aldı. Simgeden Millete (İletişim Yayınları) 2007’de yayımlandı. Halen Beyrut’ta Lebanese American University’de (LAU) ders veriyor. Conversion and Apostasys in the Late Ottoman Empire © 2012 Selim Deringil Bu kitabın yayın hakları Cambridge University Press’ten alınmıştır. İletişim Yayınları 2538 • Araştırma-İnceleme Dizisi 419 ISBN-13: 978-975-05-2272-7 © 2017 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2017, İstanbul EDİTÖR Kerem Ünüvar DİZİ KAPAK TASARIMI Ümit Kıvanç KAPAK Suat Aysu KAPAK FOTOĞRAFI Kudüs’te Ortodoks cemaatin Noel töreni UYGULAMA Hüsnü Abbas DÜZELTİ Remzi Abbas DİZİN Berkay Üzüm BASKI Ayhan Matbaası · SERTİFİKA NO. 22749 Mahmutbey Mahallesi, Devekaldırımı Caddesi, Gelincik Sokak, No: 6/3 Bağcılar, İstanbul Tel: 212.445 32 38 • Faks: 212.445 05 63 CİLT Güven Mücellit · SERTİFİKA NO. 11935 Mahmutbey Mahallesi, Devekaldırımı Caddesi, Gelincik Sokak, Güven İş Merkezi, No: 6, Bağcılar, İstanbul, Tel: 212.445 00 04 İletişim Yayınları · SERTİFİKA NO. -

Hungarian Historical Review 1, No
Hungarian Historical Review 1, no. 3–4 (2012): 294–314 Heléna Tóth The Historian’s Scales: Families in Exile in the Aftermath of the Revolutions of 1848 This essay examines political exile in the aftermath of the 1848 revolutions from the perspective of the history of the family on the basis of case studies from the Habsburg Empire and the German lands. I focus on two processes: fi rst, the ways in which family members of political refugees (and political prisoners) became refugees themselves; and second, the role of family members of political refugees in obtaining amnesty for the entire family. Although offi cially most of the family members of political refugees were immigrants who went through the offi cial channels to obtain passports, they treated their own migration as a political matter and, equally importantly, they were treated by bureaucrats in their home countries as political migrants. These perceptions, in turn, had consequences when the family decided to return from abroad. An understanding of the process whereby families became unwilling migrants in the aftermath of the revolutions of 1848 sheds light on how amorphous the practice of political exile was in the middle of the nineteenth century, as well as on the breadth of the collective aspects of this punishment. keywords: political exile, 1848 revolutions, history of the family, Habsburg Empire, Germany, refugees There are many ways in which historians of migration think of political exile during the nineteenth century: we look at individual biographies, we study groups defi ned by political affi nities, or we choose a geographical approach and look at the home countries of émigrés and the countries in which they lived as exiles.1 We seem to alternate roughly between two levels of analysis: the individual biography and a politically or geographically defi ned prosopography. -

Lajos Kossuth Sent Word
LA JOS KOSSUTH SENT WORD... Papers delivered on the occasion of the bicentenary of Kossuth’s birth Edited by Laszlo Peter, Martyn Rady, Peter Sherwood Hungarian Cultural Centre London School of Slavonic and East European Studies University College London LAJOS KOSSUTH SENT WORD ... Papers delivered on the occasion of the bicentenary of Kossuth’s birth LAJOS KOSSUTH SENT WORD ... Papers delivered on the occasion of the bicentenary of Kossuth’s birth Edited by lASZLO PETER, MARTYN RADY, PETER SHERWOOD Hungarian Cultural Centre, London School of Slavonic and East European Studies, University College London LA JOS KOSSUTH SENT WORD ... Papers delivered on the occasion of the bicentenary of Kossuth’s birth EDITED BY LASZLO PETER, MARTYN RADY, PETER SHERWOOD © School of Slavonic and East European Studies 2003 SSEES Occasional Papers No. 56 ISBN: 0-903425-67-X All rights reserved. No part of this publication may be stored in a retrieval system or transmitted in any other form or by any means, electronic, mechanical, recording or otherwise, without the prior permission of the School of Slavonic and East European Studies. Copies of this publication and others in the School’s refereed series of Occasional Papers can be obtained from the Director’s Office, SSEES-UCL, Senate House, Malet Street, London WC1E 7HU Front Cover: Lajos Kossuth, with a deputation of the Hungarian diet, enters Vienna on 15th March 1848. Contemporary lithograph from the National Museum, Budapest Typeset and printed in Great Britain by Q3 Digital/Litho Queens Road, Loughborough, Leics. LEI 1 1HH Preface The Hungarian Cultural Centre in London and the Centre for the Study of Central Europe, School of Slavonic and East European Studies (SSEES), University College London organized a conference ‘Lajos Kossuth Sent Word to commemorate the bicentenary of his birth in March 2002 with both Hungarian and British participants. -

The Journal of South- Eastern European Studies Hakemli Dergi | Sayi /Issue 25 | Yil /Year 2014-1
THE JOURNAL OF SOUTH- EASTERN EUROPEAN STUDIES HAKEMLİ DERGİ | SAYI /ISSUE 25 | YIL /YEAR 2014-1 MACARISTAN’DA OSMANLI ÇALIŞMALARI –II OTTOMAN STUDIES IN HUNGARY – II İSTANBUL - 2017 Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi = The Journal for South-Eastern European Studies.--İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1972- c.: resim, harita, tablo; 24 cm. Yılda iki sayı. ISSN 0378-3863 Elektronik ortamda da yayınlanmaktadır: http://dergipark.gov.tr/iugaad 1. TARİH – AVRUPA – SÜRELİ YAYINLAR. 2. DIŞ SİYASET – AVRUPA. 3. BALKANLAR. Telif Hakları Kanunu çerçevesinde makale ILETIŞIM | CORRESPONDENCE sahipleri ve Yayın Kurulu’nun izni olmaksızın Prof. Dr. Mustafa H. SAYAR hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yazıların bilim, dil ve hukuk açısından Tarih Bölümü sorumluluğu yazarlarına aittir. POSTA ADRESI | POSTAL ADDRESS The contents of the journal are copyrighted and may not be copied or reproduced without İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi the permission of the publisher. The authors Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi bear responsibility for the statements or Ordu Cad. No: 196, 34459 Laleli/İstanbul opinions of their published articles. E-POSTA | E-MAIL [email protected] İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 34459 Beyazıt, İstanbul BASKI-CILT İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Kültür Sanat Basımevi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı www.kulturbasim.com tarafından bastırılmıştır. Sertifika No: 22032 Hakemli Dergi / Peer-Reviewed Journal YAYIN KURULU | EDITORIAL BOARD Prof. Dr. İdris BOSTAN Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR (Sorumlu) Prof. Dr. Mahir AYDIN Prof. Dr. Ebru ALTAN Prof. Dr. Birsel KÜÇÜKSİPAHİOĞLU Yrd. Doç. Dr. Neriman E. HACISALİHOĞLU THE JOURNAL OF SOUTH- Yrd. Doç. Dr. Metin ÜNVER EASTERN EUROPEAN STUDIES Yrd. Doç. Dr. -
Front Matter
Cambridge University Press 978-1-107-00455-9 - Conversion and Apostasy in the Late Ottoman Empire Selim Deringil Frontmatter More information Conversion and Apostasy in the Late Ottoman Empire The commonly accepted wisdom is that nationalism replaced religion in the age of modernity. In the nineteenth-century Ottoman Empire, the focus of Selim Deringil’s book, traditional religious structures crumbled as the empire itself began to fall apart. The state’s answer to schism was regulation and control, administered in the form of a number of edicts in the early part of the century. It is against this background that different religious communities and individuals negotiated survival by converting to Islam when their political interests or their lives were at stake. As the century progressed, however, and as this engaging study illustrates with examples from real-life cases, conversion was no longer sufficient to guarantee citizenship and property rights as the state became increas- ingly paranoid about its apostates and what it perceived as their “de- nationalization.” The book tells the story of the struggle for the bodies and the souls of people, waged between the Ottoman state, the Great Powers, and a multitude of evangelical organizations. Many of the stories shed light on current flash-points in the Arab world and the Balkans, offering alternative perspectives on national and religious iden- tity and the interconnections between the two. Selim Deringil is Professor of History at Bogaziçi University in Istanbul, Turkey. He is the author of The Well-Protected Domains: Ideology and the Legitimation of Power in the Ottoman Empire 1876–1909 (1999). -

Hungarian Turkophils in 19Th Century Istanbul and Their Bequests in the Library of the Hungarian Academy of Sciences
Hungarian Turkophils in 19th Century Istanbul and Their Bequests in the Library of the Hungarian Academy of Sciences Nándor Erik Kovács Eötvös Loránd University, Budapest “I did not know how great treasures I gained in the community of the real muminin: the Turks love me, really, intrinsically love me.”1 After the Ottoman withdrawal from the territory of Hun- gary in the end of the 17th century, a special scene of the Turk- ish-Hungarian interactions was opened. During the early 18th century Anti-Habsburg Hungarian emigrant leaders found shelter in the Ottoman Empire: Imre Thököly (1657–1705) in Izmit, Fer- enc Rákóczi II (1676–1735) in Tekirdağ. This new period of the 1 These enthusiastic passages were written by the renowned traveller, Orienta- list Ármin Vámbéry (1832–1913), in a letter in August 1861, to his fellow scholar, the linguist József Budenz, which expresses his experiences of the kindness and helpfulness of the Turks at the beginning of his career, in Istanbul. De- partment of Manuscripts and Rare Books in the Library and Information Centre of the Hungarian Academy of Sciences (henceforth DMRB), Ms 5450/204. 453 OSMANLI ó STANBULU IV relationship between the former enemies has also been marked by some individual efforts which resulted in significant contributions to the development of the Ottoman civilization. The Hungarian-born convert, Ibrahim Müteferrika (cca 1672–1747),2 founder of the first Turkish printing-house in Istanbul (and in the Islamic world at all) in the last years of the Tulip-period, and Ferenc Tóth alias Baron de Tott (1733–1793), a promoter of the modern Ottoman artillery and organizer of the defense system of the Dardanelles during the Rus- sian-Ottoman war between 1768 and 1774 are antitypes of the early Hungarian experts in the service of the Ottoman modernization.