Dissertation / Doctoral Thesis
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Heft Seckau Heute 850112 Heftlayout
SECKAUSECKAU HEUTEHEUTE 22. Jahrgang / No. 85 – 1/12 Jahrgang / No. 22. Inhalt Nr. 85 - 1/12 THEMA 3 Zum Geleit - Auf Christus schauen 5 Die Sehsucht ist der Anfang von allem ABTEI 16 Seckauer Rätsel 17 Rückblick auf das Jahr 2011 23 Ostern in Seckau (Programm zum Herausnehmen) 31 50 Jahre Klostereigentum - P. Leo Liedermann 45 Bücher Bücher Bücher 47 Anzeigen & Rätselauflösung ABTEIGYMNASIUM 33 Dr. Anton Auerböck - eine Institution tritt in den Ruhestand 35 Neue Gesichter in den alten Gemäuern des AGS ALT-SECKAU 38 Treffen in Wien, Leoben und Graz 41 Todesfälle SECKAU KULTUR 42 Programmvorschau 2012 IMPRESSUM: Herausgeber und Verleger. Benediktinerabtei Seckau, Verein Alt Seckau, Verein Seckau Kultur, Elternverein am Abteigymnasium Seckau. Redaktion: P. Dr. Othmar Stary und Dipl.Päd. Stefan Nöstelthaller, 8732 Seckau 1, e-mail: [email protected]. Grundlegende Richtung: Die Zeitschrift dient der Mitteilung aktu- eller Geschehnisse rund um die Benediktinerabtei Seckau. Druck: Druckhaus Thalerhof, 8073 Feldkirchen, Gmeinergasse 1-3. Redaktionsschluss für das nächste Heft: Freitag, 1. Juni 2012 BANKVERBINDUNGEN: Spendenkonto d er Abtei: Kto 8.000.002, BLZ 38346 RB Knittelfeld (IBAN AT353834600008000002 / BIC RZSTAT2G346) Auslandskonto der Abtei: Kto 4.500.725, BLZ 75090300 LIGA Bank TITELSEITE: Christus, Kreuzigungsgruppe in der Basilika Seckau, um 1260 (Foto: P. Severin Schneider) Seite 2 Zum Geleit Liebe Freunde von Seckau! uf Christus schauen“ - unter diesem Motto stand der Besuch von Papst Benedikt „AXVI. in Mariazell im September 2007. Als „Dauerauftrag“ soll dieses Leitwort auch in den kommenden Jahren richtunggebend für unsere Diözese sein. Auf Christus zu schauen lädt auch die Kreuzigungsgruppe in unserer Basilika ein. Wer den Kirchenraum betritt, wird gleichsam angezogen von der romanischen Darstellung des Gekreuzigten aus dem frühen 13. -

The Goalie's Anxiety at the Penalty Kick
THE GOALIE’S ANXIETY AT THE PENALTY KICK Arthur Brauss and Erica Pluhar in The Goalie’s Anxiety at the Penalty Kick (West Germany/Austria 1971) by Wim Wenders © Wim Wenders Stiftung 2014 Having remained commercially unavailable for over three decades, the new 4K restored and remastered version of Wim Wenders’ 1972 classic THE GOALIE’S ANXIETY AT THE PENALTY KICK receives its UK premiere at the historic Regent Street Cinema, London on 31st October 2017. Commissioned by the Wim Wenders Foundation and supervised by director Wim Wenders, this long-awaited remastered release comes to UK cinemas from January 2017 and will then be available on dual-format Blu-ray and DVD from 26th February with a comprehensive array of extras including an exclusive interview by Wim Wenders. The goalkeeper Josef Bloch (Arthur Brauss) is sent off after committing a foul during an away game. This causes him to completely lose his bearings. He wanders aimlessly through the unfamiliar town, spends the night with the box-office attendant of a movie theatre (Erika Pluhar) and strangles her the next morning. But instead of turning himself in or fleeing, Bloch then goes to his ex-girlfriend’s (Kai Fischer) place in the country and passively waits there for the police to come and arrest him. As Wenders himself has stated, the visual idiom of Hitchcock’s films provided the model for his debut film. He adheres minutely to the thoroughly “cinematic” source, a novella by Peter Handke. With his cameraman Robby Müller and his editor Peter Przygodda - both of whom had already worked with him on his film thesis at the HFF (Munich University of Television and Film) - in THE GOALIE’S ANXIETY AT THE PENALTY KICK, Wenders set forth a collaboration that would weld this team together for years. -

Wenders Has Had Monumental Influence on Cinema
“WENDERS HAS HAD MONUMENTAL INFLUENCE ON CINEMA. THE TIME IS RIPE FOR A CELEBRATION OF HIS WORK.” —FORBES WIM WENDERS PORTRAITS ALONG THE ROAD A RETROSPECTIVE THE GOALIE’S ANXIETY AT THE PENALTY KICK / ALICE IN THE CITIES / WRONG MOVE / KINGS OF THE ROAD THE AMERICAN FRIEND / THE STATE OF THINGS / PARIS, TEXAS / TOKYO-GA / WINGS OF DESIRE DIRECTOR’S NOTEBOOK ON CITIES AND CLOTHES / UNTIL THE END OF THE WORLD ( CUT ) / BUENA VISTA SOCIAL CLUB JANUSFILMS.COM/WENDERS THE GOALIE’S ANXIETY AT THE PENALTY KICK PARIS, TEXAS ALICE IN THE CITIES TOKYO-GA WRONG MOVE WINGS OF DESIRE KINGS OF THE ROAD NOTEBOOK ON CITIES AND CLOTHES THE AMERICAN FRIEND UNTIL THE END OF THE WORLD (DIRECTOR’S CUT) THE STATE OF THINGS BUENA VISTA SOCIAL CLUB Wim Wenders is cinema’s preeminent poet of the open road, soulfully following the journeys of people as they search for themselves. During his over-forty-year career, Wenders has directed films in his native Germany and around the globe, making dramas both intense and whimsical, mysteries, fantasies, and documentaries. With this retrospective of twelve of his films—from early works of the New German Cinema Alice( in the Cities, Kings of the Road) to the art-house 1980s blockbusters that made him a household name (Paris, Texas; Wings of Desire) to inquisitive nonfiction looks at world culture (Tokyo-ga, Buena Vista Social Club)—audiences can rediscover Wenders’s vast cinematic world. Booking: [email protected] / Publicity: [email protected] janusfilms.com/wenders BIOGRAPHY Wim Wenders (born 1945) came to international prominence as one of the pioneers of the New German Cinema in the 1970s and is considered to be one of the most important figures in contemporary German film. -

REFLECTIONS 148X210 UNTOPABLE.Indd 1 20.03.15 10:21 54 Refl Ections 54 Refl Ections 55 Refl Ections 55 Refl Ections
3 Refl ections DAS MAGAZIN DES ÖSTERREICHISCHEN Refl ections SONG CONTEST CLUBS MERCI CHÉRIE – MERCI, JURY! AUSGABE 2015 | ➝ Es war der 5. März 1966 beim Grand und belgischen Hitparade und Platz 14 in Prix d’Eurovision in Luxemburg als schier den Niederlanden. Im Juni 1966 erreichte Unglaubliches geschah: Die vielbeachte- das Lied – diesmal in Englisch von Vince te dritte Teilnahme von Udo Jürgens – Hill interpretiert – Platz 36 der britischen nachdem er 1964 mit „Warum nur war- Single-Charts. um?“ den sechsten Platz und 1965 mit Im Laufe der Jahre folgten unzähli- SONG CONTEST CLUBS SONG CONTEST 2015 „Sag‘ ihr, ich lass sie grüßen“ den vierten ge Coverversionen in verschiedensten Platz belegte – bescherte Österreich end- Sprachen und als Instrumentalfassungen. Wien gibt sich die Ehre lich den langersehnten Sieg. In einem Hier bestechen – allen voran die aktuelle Teilnehmerfeld von 18 Ländern startete Interpretation der grandiosen Helene Fi- der Kärntner mit Nummer 9 und konnte scher – die Versionen von Adoro, Gunnar ÖSTERREICHISCHEN schließlich 31 Jurypunkte auf sich verei- Wiklund, Ricky King und vom Orchester AUSSERDEM nen. Ein klarer Sieg vor Schweden und Paul Mauriat. Teilnehmer des Song Contest 2015 – Rückblick Grand Prix 1967 in Wien Norwegen, die sich am Podest wiederfan- Hier sieht man das aus Brasilien stam- – Vorentscheidung in Österreich – Das Jahr der Wurst – Österreich und den. mende Plattencover von „Merci Cherie“, DAS MAGAZIN DES der ESC – u.v.m. Die Single erreichte Platz 2 der heimi- das zu den absoluten Raritäten jeder Plat- schen Single-Charts, Platz 2 der deutschen tensammlung zählt. DIE LETZTE SEITE ections | Refl AUSGABE 2015 2 Refl ections 2 Refl ections 3 Refl ections 3 Refl ections INHALT VORWORT PRÄSIDENT 4 DAS JAHR DER WURST 18 GRAND PRIX D'EUROVISION 60 HERZLICH WILLKOMMEN 80 „Building bridges“ – Ein Lied Pop, Politik, Paris. -

Kollektion 2016
KOLLEKTION 2016 MAGAZIN DES INSTITUTS FÜR POPULARMUSIK UNIVERSITÄT FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST WIEN KOLLEKTION 2016 MAGAZIN DES INSTITUTS FÜR POPULARMUSIK UNIVERSITÄT FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST WIEN Impressum Inhalt 5 Universität für Musik 7 Editorial 46 Andreas Felber über Musik im Radio, und darstellende Kunst Wien nächtliche Moderationen und die Leitung >Institut für Popularmusik 8 Wolfgang Puschnig über das Sich-Hingeben der Ö1 Jazz-Redaktion Anton von Webern Platz 1 in der Musik, den wahren Spirit und die 1030 Wien Rolle des Zufalls im Karriereverlauf 53 Pop and Jazz Platform 2015 in Valencia Sekretariat: Von Harald Huber und Gerd Hermann Tel: +43-1-71155-3801 13 Neue Projektvariante des IGP Ortler Fax: +43-1-71155-3899 Masterstudiums [email protected] Von Harald Huber 55 Stephan Gleixner über Musizieren mit www.ipop.at moldawischen Kindern, Yves Klein, den 15 Markus Geiselhart über Big Bands & Unterhaltungsfaktor auf der Bühne und das Verantwortlicher Herausgeber: Orchester, Theorie & Praxis sowie Bleistift Klammern an Mozarts Balls Ao.Univ.-Prof. Dr. Harald Huber & Radiergummi Wissenschaftlicher Bereich 60 ipop cube Konzert - 9. Mai 2015 im Metternichgasse 8 24 Great Jazz Quintets Vol.1: „Shabozz“ - Radiokulturhaus 1030 Wien Gigi Gryce Tel: +43-1-71155-3810 Von Gerald Schuller 64 Martin Holter über „Bella“ bei „Das Fax: +43-1-71155-3799 Supertalent“, Deep House Remixes und den [email protected] 28 Mario Lackner über inspirierenden berühmten langen Atem Schlagzeugunterricht, Musikmachen in den Redakteur: USA und den Erfolgsfaktor bei Auditions 72 Workshops, Symposien und Vorträge am Mag. Günther Wildner ipop 2014 & 2015 Freundgasse 10-12/12 36 Notes on Wurst. -

BB-1971-12-25-II-Tal
0000000000000000000000000000 000000.00W M0( 4'' .................111111111111 .............1111111111 0 0 o 041111%.* I I www.americanradiohistory.com TOP Cartridge TV ifape FCC Extends Radiation Cartridges Limits Discussion Time (Based on Best Selling LP's) By MILDRED HALL Eke Last Week Week Title, Artist, Label (Dgllcater) (a-Tr. B Cassette Nos.) WASHINGTON-More requests for extension of because some of the home video tuners will utilize time to comment on the government's rulemaking on unused TV channels, and CATV people fear conflict 1 1 THERE'S A RIOT GOIN' ON cartridge tv radiation limits may bring another two- with their own increasing channel capacities, from 12 Sly & the Family Stone, Epic (EA 30986; ET 30986) month delay in comment deadline. Also, the Federal to 20 and more. 2 2 LED ZEPPELIN Communications Commission is considering a spin- Cable TV says the situation is "further complicated Atlantic (Ampex M87208; MS57208) off of the radiated -signal CTV devices for separate by the fact that there is a direct connection to the 3 8 MUSIC consideration. subscriber's TV set from the cable system to other Carole King, Ode (MM) (8T 77013; CS 77013) In response to a request by Dell-Star Corp., which subscribers." Any interference factor would be mul- 4 4 TEASER & THE FIRECAT roposes a "wireless" or "radiated signal" type system, tiplied over a whole network of CATV homes wired Cat Stevens, ABM (8T 4313; CS 4313) the FCC granted an extension to Dec. 17 for com- to a master antenna. was 5 5 AT CARNEGIE HALL ments, and to Dec. -
![And Theology in Post-Vatican II Germany », Histoire@Politique, [En Ligne], N° 30, Septembre-Décembre 2016](https://docslib.b-cdn.net/cover/7554/and-theology-in-post-vatican-ii-germany-%C2%BB-histoire-politique-en-ligne-n%C2%B0-30-septembre-d%C3%A9cembre-2016-1967554.webp)
And Theology in Post-Vatican II Germany », Histoire@Politique, [En Ligne], N° 30, Septembre-Décembre 2016
Claus Arnold, « Turbulent Priests : "Solidarity Groups", "Councils" and Theology in Post-Vatican II Germany », Histoire@Politique, [en ligne], n° 30, septembre-décembre 2016, www.histoire-politique.fr Turbulent Priests : “Solidarity Groups”, “Councils” and Theology in Post-Vatican II Germany Claus Arnold “Will no one rid me of these turbulent priests?” Quite a few German bishops between 1969 and 1973 may have thought so. The formation of radical priest groups was a pan-European phenomenon,1 which found expression in the famous Conference in Rome in October 1969, on the fringes of the Extraordinary General Synod of Bishops. The European dimension of this phenomenon was also stressed by the German-language documentation of the Conference, published by Patmos, Düsseldorf.2 The reception of Vatican II3 had entered a critical state in 1969. This was felt world-wide and led to a virtually simultaneous mobilization and a very keen international awareness within these groups. The general crisis of post-Vatican II reforms in the age of Paul VI, especially after Humanae Vitae,4 provided a common background for all such groups. To some extent, this extraordinary mobilization, which included around 10 % of all priests in Germany,5 had a special antecedent within (West) German Catholicism. “The Discovery of Conflict”: Developments in Post-WW II German Catholicism In contrast to the German Reich, Catholics were no longer a minority in the new West German Republic after 1949,6 and with the arrival of millions of refugees7 the 1 See, for instance, Denis Pelletier, La crise catholique. Religion, société, politique en France (1965-1978) (Paris: Payot & Rivages, 2005), 58-72 and passim. -
Caravaggio & Bernini
Wien-Programm 12 / 2019 Events www.wien.info Caravaggio & Bernini 15 OCTOBER 2019 – 19 JANUARY 2020 OPEN DAILY GET YOUR TIME SLOT TICKET NOW! CARAVAGGIO-BERNINI.KHM.AT Inhalt Contents Highlights & Tipps Highlights & Tips Musikfestivals & Livemusik Music festivals & Live music Ausstellungen Exhibitions Bühne Stage Konzerte Concerts Stadtspaziergänge & Führungen Guided City Walks & Tours Spanische Hofreitschule & Wiener Sängerknaben Spanish Riding School & Vienna Boys’ Choir Allgemeines · Explanations · Eintrittskarten erhalten Sie direkt beim Explications · Spiegazioni Ver anstalter, bei Ihrem Reise- oder Theaterkarten büro oder am Karten- Mo Montag · Monday · Lundi · Lunedì büro Jirsa-Schalter in der Tourist-Info. Di Dienstag · Tuesday · Mardi · Martedì ACHTUNG: Kaufen Sie keine Karten von Mi Mittwoch · Wednesday · Mercredi · Mercoledì Straßenverkäufern. Do Donnerstag · Thursday · Jeudi · Giovedì Tickets may be obtained from the Fr Freitag · Friday · Vendredi · Venerdì organizers directly, through your travel Sa Samstag · Saturday · Samedi · Sabato agent or ticket agency, or from the ticket So Sonntag · Sunday · Dimanche · Domenica office Jirsa counter at the Tourist-Info Ftg Feiertag · Holiday · Jour de fête · in Vienna. WARNING: Do not buy any Giorno festivo tickets from street vendors. Täglich daily · tous les jours · tutti i giorni Ab as of · à partir de · a decorrere da Außer except · excepté · eccetto Tourist Information Bis until · jusqu’à · fino al 1., Albertinaplatz/Ecke Maysedergasse Geöffnet open · ouvert · aperto täglich 9.00–19.00 Geschlossen closed · fermé · chiuso [email protected] Karten tickets · billets · biglietti Kartenbüro Jirsa-Schalter Siehe see · voir · vedere in der Tourist-Info täglich 9.00–19.00 Tel. +43 1 400 60 60 Günstiger mit der VIENNA CITY CARD www.wien.info Save money with the VIENNA CITY CARD yourstage.wien.info www.facebook.com/WienTourismus www.facebook.com/ViennaTouristBoard www.facebook.com/LGBTVienna www.youtube.com/Vienna #ViennaNow Alle Angaben ohne Gewähr. -

Ried 27.691 Stk
Ried 10.07.2019 / KW 28 / www.tips.at hohenzell Gadering 8 4921 hohenzell INFO 0664 99 18 64 40 hochburG bei burghausen Grund 7 • 5122 hochburg/ach INFO 0650 500 38 76 Playoffs erreicht Mit einem haushohen 35:0-Erfolg sicherten sich die Gladiators Ried in ihrer ersten offi ziellen www.heidelbeerland.at Saison die Teilnahme an den Playoffs um den Aufstieg in die 3. Division der Austrian Football League. Seite 32 / Foto: Josef Bernauer 27.691 Stk.27.691 | OÖ 690.344 Stk. | Gesamt 865.213 Stk. | Redaktion +43 (0)77 52 / 267 77 Rieder Busterminal offi ziell eröffnet Seite 2 Österreichische Post AG | RM 02A034593K | 4010 Linz | Auflage Ried NOCHMALS von 10. - 15.07. Aufbereitsreduzierte Markenmode 2 Land & Leute Ried 28. Woche 2019 VeRKeHRSPOLItIK Busterminal eröffnet: „Zweckmäßig und städtebaulich wertvoll“ RIed. Provisorisch in Betrieb (ohne die Überdachung) war er seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2018, jetzt wurde der mittlerweile fertiggestellte Bus- terminal Ried offi ziell eröffnet. Der Geschäftsführer von Schiene OÖ, Herbert Kubasta, wies darauf hin, dass sowohl das Budget als auch der Zeitplan eingehalten wur- den. Bürgermeister Albert Ortig hob hervor, dass der Busterminal nicht nur eine zukunftsgerechte Verbindung von Bus und Bahn er- mögliche, sondern auch architek- tonisch wertvoll sei. Infrastruktur-Landesrat Gün- ther Steinkellner erwähnte das Der Terminal umfasst zehn Buchten in sogenannter Sägezahnform für die Regionalbusse. Fotos: Tips/Horn 600-Millionen-Euro-Infrastruk- turpaket, das die Erhaltung aller ÖBB hatten im vergangenen Sep- Ried im Dezember 2018 wurde Regionalbahnen und den Ausbau tember den Fußgängersteg über die der Bahnhof zur Drehscheibe des Bahnhofes Ried enthalte. -
![Lightning Strikes St Peter's Basilica As Pope Resigns 2013 HQ [Video]](https://docslib.b-cdn.net/cover/8902/lightning-strikes-st-peters-basilica-as-pope-resigns-2013-hq-video-3588902.webp)
Lightning Strikes St Peter's Basilica As Pope Resigns 2013 HQ [Video]
Lightning Strikes St Peter's Basilica As Pope Resigns 2013 HQ [Video] http://www.disclose.tv/action/viewvideo/125241/Lightning_Strikes_St_P... Liked this page? Let Google know: ›‹ Like 22k Join 70929 members... | Create Account | Contact | Shop | Login 1 of 10 2/16/2013 9:12 PM Lightning Strikes St Peter's Basilica As Pope Resigns 2013 HQ [Video] http://www.disclose.tv/action/viewvideo/125241/Lightning_Strikes_St_P... You might like: Prophecy In The Amazing UFO Making: The Coming Footage Of A Object Black Pope Transforming Recommended by Disclose.tv Like 22,905 people like Disclose.tv . Facebook social plugin Lightning Strikes St Peter's Basilica as Pope Resigns 2013 HQ 2 of 10 2/16/2013 9:12 PM Lightning Strikes St Peter's Basilica As Pope Resigns 2013 HQ [Video] http://www.disclose.tv/action/viewvideo/125241/Lightning_Strikes_St_P... Like 459 Tweet 7 2 32 [4] 1 2 3 4 5 3 of 10 2/16/2013 9:12 PM Lightning Strikes St Peter's Basilica As Pope Resigns 2013 HQ [Video] http://www.disclose.tv/action/viewvideo/125241/Lightning_Strikes_St_P... PC Cleaner- Free Download Free-PC-Cleaner.sparktrust.com Clean PC, Boost Speed, Fix Errors. Free Download (Highly Recommended!) DestinationUnknown uploaded: Feb 12, 2013 Hits: 5557 Description: Pope Benedict has shocked a billion Roman Catholics around the world, and his closest advisers, by announcing that he will resign at the end of this month. Within hours of Pope Benedict announcing his resignation, lightning struck St Peter's Basilica. The Pope, who is 85 years old, has been the head of the Church since 2005ADG Facebook: http://www.facebook.com/pages/Alien-Disclosure- Group/189249627773146Follow ADG on Twitter: http://twitter.com/ADG_UK Tags: Pope Lightning Benedict Peters Basilica Categories: Other Mysteries 4 of 10 2/16/2013 9:12 PM Lightning Strikes St Peter's Basilica As Pope Resigns 2013 HQ [Video] http://www.disclose.tv/action/viewvideo/125241/Lightning_Strikes_St_P.. -
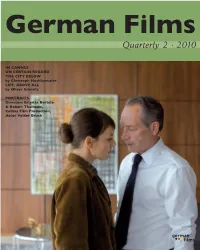
Quarterly 2 · 2010
German Films Quarterly 2 · 2010 IN CANNES: UN CERTAIN REGARD THE CITY BELOW by Christoph Hochhaeusler LIFE, ABOVE ALL by Oliver Schmitz PORTRAITS Directors Brigitte Bertele & Robert Thalheim, Collina Film Production, Actor Volker Bruch In Competition MY JOY by Sergei Loznitsa German Producer: ma.ja.de fiction/Leipzig World Sales: Fortissimo Film Sales/Amsterdam In Competition LA PRINCESSE DE MONTPENSIER by Bertrand Tavernier German Producer: Pandora Film/Cologne World Sales: StudioCanal/Paris In Competition TENDER SON – THE FRANKENSTEIN PROJECT by Kornél Mundruczó German Producer: Essential Filmproduktion/Berlin World Sales: Coproduction Office/Paris In Competition TOURNÉE by Mathieu Amalric German Producer: Neue Mediopolis Filmproduktion/Leipzig World Sales: Le Pacte/Paris In Competition UNCLE BOONMEE WHO CAN RECALL HIS PAST LIVES by Apichatpong Weerasethakul German Producers: Geissendoerfer Film- und Fernsehproduktion & The Match Factory/Cologne World Sales: The Match Factory/Cologne Out of Competition THE AUTOBIOGRAPHY OF NICOLAE CEAUSESCU by Andrei Ujicaˇ German Producer: Neue Mira Filmproduktion/Bremen World Sales: Mandragora International/Paris Out of Competition CARLOS THE JACKAL by Olivier Assayas German Producer: Egoli Tossell Film/Halle World Sales: StudioCanal/Paris Un Certain Regard AURORA by Cristi Puiu German Producer: Essential Filmproduktion/Berlin World Sales: Coproduction Office/Paris GERMAN FILMS AND CO-PRODUCTIONS 2010 FILM FESTIVAL THE CANNES AT Un Certain Regard THE CITY BELOW by Christoph Hochhaeusler Producer: Heimatfilm/Cologne -

Eigentumsverhältnisse an Corpshäusern Des Grünen
Eigentumsverhältnisse an Corpshäusern des grünen Kreises des Kösener Senioren-Convents- Verbandes seit 1933 und Restitutions- und Ent- schädigungsansprüche der grünen Corps Eine rechtshistorische Untersuchung Michael Feistl Eigentumsverhältnisse an Corpshäusern des grünen Kreises des Kösener Senioren-Convents-Verbandes seit 1933 und Restitutions- und Entschädigungsansprüche der grünen Corps Eine rechtshistorische Untersuchung Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Regensburg vorgelegt von Michael Feistl Erstberichterstatter: Prof. Dr. Hans-Jürgen Becker Zweitberichterstatter: Prof. Dr. Martin Löhnig Tag der mündlichen Prüfung: 15.6.2010 Meiner Leibfamilie Meinen Confüxen Meinem lieben Corps Franconia-Jena zu Regensburg Vorwort Ein „grünes“ „Kösener“ Corps ist eine unpolitische schlagende Studentenverbindung, basierend auf Werten wie Freundschaft, Freiheit, Demokratie, Toleranz und Ehre1. Als Gemeinschaft soll es den jungen Studenten im Studium fördern und auch zu diesen Werten erziehen, da diese Aufgabe meistens nicht von den Universitäten wahrgenommen werden kann. Ziel dieser Dissertation ist, die Eigentumsverhältnisse an Corpshäusern der grünen Corps des KSCV, deren Entwicklung in den verschiedenen Ländern und die verschiedenen Arten des Eigentumsverlustes seit 1933, der Rückgabe und der Entschädigung nach 1945 und 1989 darzustellen. Corps2 gab es vor 1933 in Deutschland, Österreich, der Schweiz, vereinzelt in der Tschechoslowakei (Brünn, Prag, beide heutiges Tschechien), Frankreich