Pdf-Dokument
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Rote Liste Spinner Und Schwärmer
HESSISCHES MINISTERIUM NATUR FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT IN HESSEN UND FORSTEN Rote Liste der Spinner und Schwärmer Hessens 1 Rote Liste der „Spinner und Schwärmer im weiteren Sinn” Hessens (Lepidoptera; „Bombyces et Sphinges” sensu lato) Hepialidae (Wurzelbohrer), Limacodidae (Schneckenspinner oder Assel- spinner), Sesiidae (Glasflügler), Cossidae (Bohrer), Thyrididae (Fenster- schwärmerchen), Lasiocampidae (Glucken), Endromidae (Scheckflügel), Saturniidae (Pfauenspinner), Lemoniidae (Herbstspinner), Sphingidae (Schwärmer), Drepanidae (Sichelflügler und Wollrückenspinner oder Eulenspinner), Notodontidae (Zahnspinner), Lymantriidae (Trägspinner), Nolidae (Kleinbären), Arctiidae (Bärenspinner) (Erste Fassung, Stand: 23.11.1998), Zusammengestellt im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten im Namen der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Lepidopterologen (Arge HeLep) von Andreas C. Lange und Jan T. Roth unter Mitwirkung von Mitarbeitern der Arge HeLep Anschrift der Autoren: Andreas C. Lange, Teutonenstraße 48, 65187 Wiesbaden Jan T. Roth, Westendstraße 49, 60325 Frankfurt/M. Red Data list of the ”Bombyces et Sphinges” sensu lato of Hesse (as of November, 23rd, 1998) Abstract: According to present knowledge 189 species of the ”Bombyces et Sphinges” sensu lato are recorded to occur presently or have been recorded in the past in the Federal State of Hesse, Federal Republic of Germany. The status of endangerment as defined by the criteria based on the IUCN-categories is considered as following: 0 ( = extinct) 16 species; 1 ( = nearly extinct) 8 species; 2 ( = highly endangered) 12 species; 3 ( = endangered) 24 species. In 11 species the data is not sufficent for classification, but endangerment is highly probable due to their confinement to endangered biotopes. 6 species are declining but not actually endangered. In 6 species data is deficient because of taxonomic or methodic difficulties. -

Redalyc.Catalogue of the Family Sesiidae in China
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Jin, Q.; Wang, S. X.; Li, H. H. Catalogue of the family Sesiidae in China (Lepidoptera: Sesiidae) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 36, núm. 144, diciembre, 2008, pp. 507-526 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45511220017 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative 507-526 Catalogue of the family 10/12/08 10:40 Página 507 SHILAP Revta. lepid., 36 (144), diciembre 2008: 507-526 CODEN: SRLPEF ISSN:0300-5267 Catalogue of the family Sesiidae in China (Lepidoptera: Sesiidae) Q. Jin, S. X. Wang & H. H. Li Abstract A catalogue of the family Sesiidae in China is provided based partially on the research of the previous literature and partially on the study of the specimens in our collection. A total of 108 species in 26 genera are listed, along with the available information of distribution and host plants. KEY WORDS: Lepidoptera, Sesiidae, catalogue, host plants, distribution, China. Catálogo de la familia Sesiidae en China (Lepidoptera: Sesiidae) Resumen Se presenta un catálogo de la familia Sesiidae en China basado parcialmente sobre las revisiones bibliográficas y parcialmente sobre el estudio de los especímenes en nuestra colección. Se da una lista de 108 especies en 26 géneros, así como la información disponible de su distribución y plantas nutricias. -

Schutz Des Naturhaushaltes Vor Den Auswirkungen Der Anwendung Von Pflanzenschutzmitteln Aus Der Luft in Wäldern Und Im Weinbau
TEXTE 21/2017 Umweltforschungsplan des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Forschungskennzahl 3714 67 406 0 UBA-FB 002461 Schutz des Naturhaushaltes vor den Auswirkungen der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln aus der Luft in Wäldern und im Weinbau von Dr. Ingo Brunk, Thomas Sobczyk, Dr. Jörg Lorenz Technische Universität Dresden, Fakultät für Umweltwissenschaften, Institut für Forstbotanik und Forstzoologie, Tharandt Im Auftrag des Umweltbundesamtes Impressum Herausgeber: Umweltbundesamt Wörlitzer Platz 1 06844 Dessau-Roßlau Tel: +49 340-2103-0 Fax: +49 340-2103-2285 [email protected] Internet: www.umweltbundesamt.de /umweltbundesamt.de /umweltbundesamt Durchführung der Studie: Technische Universität Dresden, Fakultät für Umweltwissenschaften, Institut für Forstbotanik und Forstzoologie, Professur für Forstzoologie, Prof. Dr. Mechthild Roth Pienner Straße 7 (Cotta-Bau), 01737 Tharandt Abschlussdatum: Januar 2017 Redaktion: Fachgebiet IV 1.3 Pflanzenschutz Dr. Mareike Güth, Dr. Daniela Felsmann Publikationen als pdf: http://www.umweltbundesamt.de/publikationen ISSN 1862-4359 Dessau-Roßlau, März 2017 Das diesem Bericht zu Grunde liegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit unter der Forschungskennzahl 3714 67 406 0 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autorinnen und Autoren. UBA Texte Entwicklung geeigneter Risikominimierungsansätze für die Luftausbringung von PSM Kurzbeschreibung Die Bekämpfung -

Klicken, Um Den Anhang Zu Öffnen
Gredleria- VOL. 1 / 2001 Titelbild 2001 Posthornschnecke (Planorbarius corneus L.) / Zeichnung: Alma Horne Volume 1 Impressum Volume Direktion und Redaktion / Direzione e redazione 1 © Copyright 2001 by Naturmuseum Südtirol Museo Scienze Naturali Alto Adige Museum Natöra Südtirol Bindergasse/Via Bottai 1 – I-39100 Bozen/Bolzano (Italien/Italia) Tel. +39/0471/412960 – Fax 0471/412979 homepage: www.naturmuseum.it e-mail: [email protected] Redaktionskomitee / Comitato di Redazione Dr. Klaus Hellrigl (Brixen/Bressanone), Dr. Peter Ortner (Bozen/Bolzano), Dr. Gerhard Tarmann (Innsbruck), Dr. Leo Unterholzner (Lana, BZ), Dr. Vito Zingerle (Bozen/Bolzano) Schriftleiter und Koordinator / Redattore e coordinatore Dr. Klaus Hellrigl (Brixen/Bressanone) Verantwortlicher Leiter / Direttore responsabile Dr. Vito Zingerle (Bozen/Bolzano) Graphik / grafica Dr. Peter Schreiner (München) Zitiertitel Gredleriana, Veröff. Nat. Mus. Südtirol (Acta biol. ), 1 (2001): ISSN 1593 -5205 Issued 15.12.2001 Druck / stampa Gredleriana Fotolito Varesco – Auer / Ora (BZ) Gredleriana 2001 l 2001 tirol Die Veröffentlichungsreihe »Gredleriana« des Naturmuseum Südtirol (Bozen) ist ein Forum für naturwissenschaftliche Forschung in und über Südtirol. Geplant ist die Volume Herausgabe von zwei Wissenschaftsreihen: A) Biologische Reihe (Acta Biologica) mit den Bereichen Zoologie, Botanik und Ökologie und B) Erdwissenschaftliche Reihe (Acta Geo lo gica) mit Geologie, Mineralogie und Paläontologie. Diese Reihen können jährlich ge mein sam oder in alternierender Folge erscheinen, je nach Ver- fügbarkeit entsprechender Beiträge. Als Publikationssprache der einzelnen Beiträge ist Deutsch oder Italienisch vorge- 1 Naturmuseum Südtiro sehen und allenfalls auch Englisch. Die einzelnen Originalartikel erscheinen jeweils Museum Natöra Süd Museum Natöra in der eingereichten Sprache der Autoren und sollen mit kurzen Zusammenfassun- gen in Englisch, Italienisch und Deutsch ausgestattet sein. -

Microlepidoptera in Nederland, Vooral in 2007-2010 Met Een Terugblik Op 30 Jaar Faunistisch Onderzoek
entomologische berichten 91 73 (3) 2013 Microlepidoptera in Nederland, vooral in 2007-2010 met een terugblik op 30 jaar faunistisch onderzoek K. J. (Hans) Huisman J. C. (Sjaak) Koster Tymo S.T. Muus Erik J. van Nieukerken TREFWOORDEN Faunistiek, nieuwe waarneming, provincies, areaaluitbreidingen Entomologische Berichten 73 (3): 91-117 In de jaren 2007-2010 werden maar liefst elf soorten kleine vlinders nieuw voor onze fauna gevonden: Infurcitinea teriolella, Bucculatrix ulmifoliae, Caloptilia fidella, Phyllonorycter issikii, Coleophora motacillella, Cochylis molliculana, Cnephasia sedana, Clepsis dumicolana, Lobesia botrana, Pseudococcyx tessulatana en Evergestis aenealis. Daarnaast werden drie soorten al elders gemeld: Caloptilia hemidactylella, Cydalima perspectalis en Bucculatrix ainsliella. Na 30 jaar van jaarlijsten geven we een evaluatie, met onder andere een totaal van 128 nieuw gemelde soorten. Dit zijn er minder dan in Denemarken, maar meer dan op de Britse Eilanden of in Zweden. We verklaren deze verschillen door het verschil in oppervlak van de landen: hoe kleiner het land, hoe meer kans dat er nieuwe soorten gevonden worden. Dit jaaroverzicht is het laatste dat in deze vorm verschijnt. Dit is het negentiende jaaroverzicht van de Nederlandse Micro- die beoordeeld konden worden door specialisten. We hopen dat lepidoptera sedert 1983. Een index van alle overzichten tot 2000 we een goed evenwicht gevonden hebben in het spanningsveld werd gegeven door Koster & Van Nieukerken (2003). tussen volledigheid en betrouwbaarheid. De jaren 2007–2010 waren wederom aan de warme kant met Door de snelle berichtgeving op internet wordt het voor het uitzondering van 2010, dat sinds 1996 het eerste jaar was met samenstellen van een gedrukte ‘jaarlijst’ steeds moeilijker om een temperatuur beneden het langjarige gemiddelde van 9,8°C voldoende actueel te blijven en toch de grens van een bepaald (jaargemiddelden 2007-2010 11,2; 10,6; 10,5; 9,1°C). -
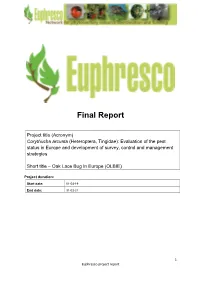
Final Report
Final Report Project title (Acronym) Corythucha arcuata (Heteroptera, Tingidae): Evaluation of the pest status in Europe and development of survey, control and management strategies Short title – Oak Lace Bug In Europe (OLBIE) Project duration: Start date: 01-04-19 End date: 31-03-21 1 Euphresco project report Contents 1. Research consortium partners ........................................................................................................ 3 2. Short project report......................................................................................................................... 5 2.1. Short executive summary ............................................................................................................ 5 2.2. Project aims ................................................................................................................................. 5 2.3. Description of the main activities ................................................................................................ 6 2.4. Main results ................................................................................................................................. 6 2.4.1. Review evidence of impacts .................................................................................................... 6 2.4.2. Prevention and detection ...................................................................................................... 10 2.4.2.1. Developing early detection and surveying techniques/protocols for Corythucha arcuata 10 2.4.2.2. -

Guidelines for the Capture and Management of Digital Zoological Names Information Francisco W
Guidelines for the Capture and Management of Digital Zoological Names Information Francisco W. Welter-Schultes Version 1.1 March 2013 Suggested citation: Welter-Schultes, F.W. (2012). Guidelines for the capture and management of digital zoological names information. Version 1.1 released on March 2013. Copenhagen: Global Biodiversity Information Facility, 126 pp, ISBN: 87-92020-44-5, accessible online at http://www.gbif.org/orc/?doc_id=2784. ISBN: 87-92020-44-5 (10 digits), 978-87-92020-44-4 (13 digits). Persistent URI: http://www.gbif.org/orc/?doc_id=2784. Language: English. Copyright © F. W. Welter-Schultes & Global Biodiversity Information Facility, 2012. Disclaimer: The information, ideas, and opinions presented in this publication are those of the author and do not represent those of GBIF. License: This document is licensed under Creative Commons Attribution 3.0. Document Control: Version Description Date of release Author(s) 0.1 First complete draft. January 2012 F. W. Welter- Schultes 0.2 Document re-structured to improve February 2012 F. W. Welter- usability. Available for public Schultes & A. review. González-Talaván 1.0 First public version of the June 2012 F. W. Welter- document. Schultes 1.1 Minor editions March 2013 F. W. Welter- Schultes Cover Credit: GBIF Secretariat, 2012. Image by Levi Szekeres (Romania), obtained by stock.xchng (http://www.sxc.hu/photo/1389360). March 2013 ii Guidelines for the management of digital zoological names information Version 1.1 Table of Contents How to use this book ......................................................................... 1 SECTION I 1. Introduction ................................................................................ 2 1.1. Identifiers and the role of Linnean names ......................................... 2 1.1.1 Identifiers .................................................................................. -

As Aves Dos Montados
O MONTADO E AS AVES BOAS PRÁTICAS PARA UMA GESTÃO SUSTENTÁVEL Título: O Montado e as Aves: Boas Práticas para uma Gestão Sustentável Autores: Pedro Pereira, Carlos Godinho, Inês Roque, João E. Rabaça Participação especial: Rui Alves Ilustrações © Pedro Pereira (Capítulos 4 e 8), Carlos Godinho (Capítulo 6) Fotografia da capa © Carlos Godinho Fotografia da contracapa © José Heitor Fotos dos capítulos © Barn Owl Trust, Carlos Godinho, Inês Roque, Marisa Gomes, Pedro Pereira Capa, Criação Gráfica e Paginação: Lúcia Antunes © Copyright Câmara Municipal de Coruche (Edifício dos Paços do Concelho, Praça da Liberdade, 2100-121 Coruche) Universidade de Évora (Largo dos Colegiais 2, 7004-516 Évora) 1ª Edição, Maio 2015 Depósito legal: 393739/15 ISBN: 978-989-8550-27-9 Impressão Gráfica e Acabamento: Rainho & Neves, Santa Maria da Feira Tiragem: 3000 exemplares Citação recomendada para a obra: Pereira, P., Godinho, C., Roque, I. & Rabaça, J.E. 2015. O montado e as aves: boas práticas para uma gestão sustentável. LabOr – Laboratório de Ornitologia / ICAAM, Universidade de Évora, Câmara Municipal de Coruche, Coruche. Citação recomendada para o capítulo 2: Alves, R. 2015. Novos e velhos desafios da gestão do montado, IN: Pereira, P., Godinho, C., Roque, I. & Rabaça, J.E. O montado e as aves: boas práticas para uma gestão sustentável. LabOr – Laboratório de Ornitologia /ICAAM, Universidade de Évora, Câmara Municipal de Coruche, Coruche. O MONTADO E AS AVES BOAS PRÁTICAS PARA UMA GESTÃO SUSTENTÁVEL PEDRO PEREIRA CARLOS GODINHO INÊS ROQUE JOÃO E. RABAÇA ÍndicE 07 INTRODUÇÃO 21 CAPÍTULO 1 O montado 26 CAIXA 1.1 As atividades no montado 33 CAPÍTULO 2 Novos e velhos desafios da gestão do montado 39 CAPÍTULO 3 As aves dos montados 47 CAIXA 3.1 Gaio: o grande promotor de regeneração natural no montado 49 CAIXA 3.2 As aves na certificação florestal: o exemplo da Companhia das Lezírias, S.A. -

Redalyc.New Records of Lepidoptera from the Iberian Peninsula for 2015
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Lastuvka, A.; Lastuvka, Z. New records of Lepidoptera from the Iberian Peninsula for 2015 (Insecta: Lepidoptera) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 43, núm. 172, diciembre, 2015, pp. 633-644 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45543699008 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative SHILAP Revta. lepid., 43 (172), diciembre 2015: 633-644 eISSN: 2340-4078 ISSN: 0300-5267 New records of Lepidoptera from the Iberian Peninsula for 2015 (Insecta: Lepidoptera) A. Lastuvka & Z. Lastuvka Abstract New records of Nepticulidae, Heliozelidae, Adelidae, Tischeriidae, Gracillariidae, Argyresthiidae, Lyonetiidae and Sesiidae for Portugal and Spain are presented. Stigmella minusculella (Herrich-Schäffer, 1855), S. tormentillella (Herrich-Schäffer, 1860), Parafomoria helianthemella (Herrich-Schäffer, 1860), Antispila metallella ([Denis & Schiffermüller], 1775), Nematopogon metaxella (Hübner, [1813]), Tischeria dodonaea Stainton, 1858, Coptotriche gaunacella (Duponchel, 1843), Caloptilia fidella (Reutti, 1853), Phyllonorycter monspessulanella (Fuchs, 1897), P. spinicolella (Zeller, 1846), Lyonetia prunifoliella -

Lepidoptera: Sesiidae)
Eur. J. Entomol. 108: 439–446, 2011 http://www.eje.cz/scripts/viewabstract.php?abstract=1635 ISSN 1210-5759 (print), 1802-8829 (online) Spatial distributions of European clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) WERNER ULRICH, MAREK BĄKOWSKI and ZDENċK LAŠTģVKA Nicolaus Copernicus University in ToruĔ, Department of Animal Ecology, Gagarina 9, 87-100 ToruĔ; Poland; e-mail: [email protected] Adam Mickiewicz University, Department of Systematic Zoology, Umultowska 89; 61-614 PoznaĔ; Poland; e-mail: [email protected] Mendel University in Brno, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apidology, ZemČdČlská 1, 613 00 Brno, Czech Republic; e-mail: [email protected] Key words. Lepidoptera, Sesiidae, endemics, widespread species, macro-ecology, spatial auto-regression, latitudinal gradient, longitudinal gradient, coherence, range size, postglacial colonization Abstract. Although the sizes of the geographical ranges of plant and animal species are of major interest to macroecologists, the spa- tial distributions and environmental correlates of only a small group of animals and plants are well studied. Here data on the spatial distributions of 116 European clearwing moths (Sesiidae) was used to determine the patterns in spatial distribution, postglacial colo- nization and endemism. The spatial distributions of sesiids are significantly more coherent and there are fewer isolated occurrences and unexpected absences than predicted by a random sample null model. After correcting for environmental correlates, islands and mainland countries did not differ significantly in the number of species with small ranges. Polyphagous wood attending species were more widespread than those with other life histories. Species of Siberian origin had wider ranges than those of Mediterranean origin. Nestedness and species co-occurrence analysis did not support a unidirectional postglacial colonization from a Southern European refuge but colonization from both Southern and Eastern Europe. -

Insect Egg Size and Shape Evolve with Ecology but Not Developmental Rate Samuel H
ARTICLE https://doi.org/10.1038/s41586-019-1302-4 Insect egg size and shape evolve with ecology but not developmental rate Samuel H. Church1,4*, Seth Donoughe1,3,4, Bruno A. S. de Medeiros1 & Cassandra G. Extavour1,2* Over the course of evolution, organism size has diversified markedly. Changes in size are thought to have occurred because of developmental, morphological and/or ecological pressures. To perform phylogenetic tests of the potential effects of these pressures, here we generated a dataset of more than ten thousand descriptions of insect eggs, and combined these with genetic and life-history datasets. We show that, across eight orders of magnitude of variation in egg volume, the relationship between size and shape itself evolves, such that previously predicted global patterns of scaling do not adequately explain the diversity in egg shapes. We show that egg size is not correlated with developmental rate and that, for many insects, egg size is not correlated with adult body size. Instead, we find that the evolution of parasitoidism and aquatic oviposition help to explain the diversification in the size and shape of insect eggs. Our study suggests that where eggs are laid, rather than universal allometric constants, underlies the evolution of insect egg size and shape. Size is a fundamental factor in many biological processes. The size of an 526 families and every currently described extant hexapod order24 organism may affect interactions both with other organisms and with (Fig. 1a and Supplementary Fig. 1). We combined this dataset with the environment1,2, it scales with features of morphology and physi- backbone hexapod phylogenies25,26 that we enriched to include taxa ology3, and larger animals often have higher fitness4. -

Heterocera Fauna of the Calabrian Black Pine Forest, Sila Massif (Italy) (Insecta: Lepidoptera) SHILAP Revista De Lepidopterología, Vol
SHILAP Revista de Lepidopterología ISSN: 0300-5267 ISSN: 2340-4078 [email protected] Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Scalercio, S.; Greco, S. Heterocera fauna of the Calabrian black pine forest, Sila Massif (Italy) (Insecta: Lepidoptera) SHILAP Revista de Lepidopterología, vol. 46, no. 183, 2018, April-June, pp. 455-472 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología España Available in: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45560340008 How to cite Complete issue Scientific Information System Redalyc More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America and the Caribbean, Spain and Journal's webpage in redalyc.org Portugal Project academic non-profit, developed under the open access initiative SHILAP Revta. lepid., 46 (183) septiembre 2018: 455-472 eISSN: 2340-4078 ISSN: 0300-5267 Heterocera fauna of the Calabrian black pine forest, Sila Massif (Italy) (Insecta: Lepidoptera) S. Scalercio & S. Greco Abstract In this paper we described the Heterocera fauna of the Calabrian black pine forest in the Sila Massif, southern Italy. We sampled 15 stands at 1270-1446 meters of altitude. One UV-Led light traps per stand was turned on once per month from May to November 2015 and from April to November 2016. We collected 18,827 individuals belonging to 367 species. Thaumetopoea pityocampa (Notodontidae) and Alcis repandata (Geometridae) were the most abundant species. Conifers are the main larval foodplant of 11 species and 4,984 individuals. Particularly interesting was the presence of Eupithecia indigata, discovered in Italy outside the Alps few years ago, abundant in pure Calabrian black pine stands. Also, the recently described Italian endemic Hylaea mediterranea was abundant, and together with E.