Kulturpreis Deutsche Sprache 2012 Ansprachen Und Reden
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Annual Report 2016 German Patent and Trade Mark Office Annual Report 2016Annual at a Glance
Annual Report 2016 German Patent and Trade Mark Office Annual 2016 Report At a glance Changes Industrial property rights 2015 2016 in % Patents Applications 1 66,897 67,898 + 1.5 Examination procedures concluded 33,495 35,673 + 6.5 - published decisions to grant 14,795 15,652 + 5.8 a patent Patents in force at the end of the year 2 129,550 129,511 - 0.0 Applications Trade marks 73,479 72,807 - 0.9 (national and international) National marks Applications 68,951 69,340 + 0.6 Registration procedures concluded 65,723 75,501 + 14.9 - with registration 46,526 52,194 + 12.2 Trade marks in force at the end of 797,317 804,618 + 0.9 the year International marks Requests for grant of protection 4,528 3,467 - 23.4 in Germany Grants of protection 3,743 3,426 - 8.5 Utility models Applications 14,274 14,024 - 1.8 Registration procedures concluded 14,199 14,324 + 0.9 - with registration 12,256 12,441 + 1.5 Utility models in force at the end of 85,162 83,183 - 2.3 the year Designs Designs applied for 57,741 54,588 - 5.5 Registration procedures concluded 54,417 52,966 - 2.7 - with registration 50,765 49,113 - 3.3 Registered designs in force at the end 313,696 313,296 - 0.1 of the year 1 Patent applications at the DPMA and PCT patent applications upon their entry into the national phase 2 Including patents granted by the European Patent Office (EPO) with effect in the Federal Republic of Germany, a total of 615,404 patents were valid in Germany in 2016. -
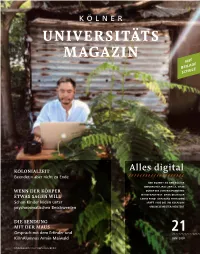
Digital Beendet – Aber Nicht Zu Ende
MIT BEILAGE SCHULE KOLONIALZEIT Alles digital Beendet – aber nicht zu Ende DER DOZENT AN DER KÖLNER UNIVERSITÄT, HAI LINH LE, SITZT WENN DER KÖRPER DURCH DIE CORONA-PANDEMIE IN VIETNAM FEST. DANK DIGITALER ETWAS SAGEN WILL LEHRE FAND SEIN KURS TROTZDEM Schon Kinder leiden unter STATT / WIE DIE UNI KÖLN DAS psychosomatischen Beschwerden ONLINESEMESTER MEISTERT DIE SENDUNG MIT DER MAUS 21 Gespräch mit dem Erfinder und KölnAlumnus Armin Maiwald Juni 2020 UNIMAGAZIN.UNI-KOELN.DE / 6 EURO WISSENSCHAFT IM ALLTAG Was wiegt die Erde? as Fliegen«, sagt der Reiseführer Per Anhalter er quer zur Fallrichtung an der Erde vorbei. Dies macht durch die Galaxis von Douglas Adams, »ist eine die Kreisbahn aus, auf der sich die ISS immer befindet. DKunst, oder vielmehr ein Trick. Der Trick be- Die notwendige Geschwindigkeit von 28.000 km/h steht darin, dass man lernt, wie man sich auf den Boden ist ein Hinweis, mit dem schmeißt, aber daneben. Such dir einen schönen Tag aus sich die Masse der Erde ES ANTWORTET PROFESSOR und probier’s.« bestimmen lässt. Denn die DR. ANDRÉ BRESGES VOM Wie viele Physiker-Witze hat auch dieser eine spezielle Masse eines Planeten be- INSTITUT FÜR PHYSIKDIDAKTIK. Eigenart: Erst schmunzelt man, dann denkt man dar- stimmt seine Anziehungs- über nach und und stellt schließlich fest – es stimmt kraft. Wäre die Erde leichter als sie ist, würde sie den sogar. Ein Satellit, oder die Internationale Raumstation Weg der ISS bei dieser Geschwindigkeit kaum noch ISS, tut den ganzen Tag nichts Anderes: sie fällt. Die ISS mit Anziehungskraft beeinflussen – und die ISS würde befindet sich im freien Fall, und mit ihr alles, was drin schnurgerade ins Weltall entfliehen. -

Communication
emiT foyrtsHBA gnikwaH n a i n v n e a L Black Hoeus J p. 41 » D ata V is u alis atio n A n d y K irk e t f u T . R d r a w d E The V isual DpyofQntveIrm e f i W s i H k o o t s i M n i w r a D A Shor o h s W ie n c a e p M S e t f took h His o s k or a Hat c ho Mis a e f er S W v if li O T n W O l i v e r S a c k s i His he Man ig selpicnrPT r fo Vri gol y or O t e h T of N y rly E ea . M a t r t i d v n e a L x e l skaerbtuO yldD A Suffering in Academia Against unnecessary pain in higher education v er t y ing ehT oH enoZ t h NeuroScience p. 24 » Wait, but Neuralink? The story of communicating a dense topic Communication 10 p. cns a newsletter brought to you by the International Graduate Program Medical Neurosciences Medical Program Graduate International the by you to brought newsletter a » Science Volume 13 • Issue 1 Issue • 13 Volume How to Visualize Data A go-to guide for picking the right graph MARCH 2020 MARCH Charité We first floated the combined theme of data visualization and science communication in late 2019, but we ended up choosing another theme we were excited about: music and the brain. -

2018 / 2019 Cover Photo: MINT-Mobile with the Staff and Ranga Yogeshwar
2018 / 2019 Cover Photo: MINT-Mobile with the staff and Ranga Yogeshwar DeDier OberbürgermeisterinOberbürgermeister Stadtbibliothek Editing/layout/design: Stadtbibliothek Köln Photos: © Stadtbibliothek Köln, unless otherwise indicated Printng: Druckhaus Süd, Köln Release: February 2019 Foreword from Dr. Hannelore Vogt “Tell me, and I will forget. Show me, and I may remember. Involve me, and I will understand.“ This quotation from Confucius is more pertinent than ever. For many years now, the Cologne Public Library has combined progress with participation, by inspiring and enabling involvement and doing. Two major new events occurred in 2018: first, the STEM-themed year (MINT: math, engineering, science and technology), and second, the opening of the innovatively redesigned Kalk Library branch. A drastic shortage of STEM specialists is forecast in the next few years. Mathematics, engineering, science, and technology are central cultural skills and will, in the future, become a location factor of increased value. In addition to imparting reading and media skills, the Library seeks to foster an interest in these subjects by young people from an early age. In this way, children and young adults are helped not only to perceive digital offerings from the consumer‘s perspective, but also to try them out for themselves and to experience the Lib- rary as an experimental knowledge zone. The Kalk Library, developed according to the Design Thinking method, has become a place to experience and learn by doing – a feel-good place with a high degree of comfort. The positive response to the branch is over- whelming, not only from the neighborhood, but from industry experts who are streaming through the doors. -

Die Maus Wird 50
O TV-PROGRAMM 6.3. - 12.3. Nr. 9/2021 09 4 192336 700009 Gewinnen Sie 10 000 € beim großen prisma-Rätsel! Seite 21 TATORT AUS KIEL Borowski und die Angst der weißen Männer Seite 15 Coolpix A1000 n 16,8 Megapixel n 35-fach Zoom DIE MAUS WIRD 50 n 4K-UHD-Videos n Touch-LCD Zum Geburtstag gibt‘s ein ganzes Heft 299.- voll mit der Maus, Gewinnspielen UVP.: 419.- € | Sie sparen 28 % Ihr Foto-Experte - Versand am gleichen Tag: und einem Interview mit Armin Seite 4 www.foto-erhardt.de Foto Erhardt GmbH · Gartenkamp 101 · 49492 Westerkappeln WILLKOMMEN! Die prisma mit der Maus prisma-Freizeittipp Das ist der Stephan. Stephan ist Moderator André Gatzke (Foto), regelmäßig für die Chefredakteur von prisma. Und Maus im Einsatz, ist gern im Freien unterwegs. Als Va- das auf seinem Arm ist – klar – die ter weiß er allerdings, dass ein einfacher Spaziergang Maus. Stephan kennt Kinder nicht immer ausnahmslos begeistert. Sein die „Sendung mit der Tipp: „Macht eine Rallye draus. In der Stadt kann man zum Beispiel den teuersten Artikel in einem Schau- Maus“ schon seit er fenster suchen oder gucken, wie viele Parteien in einem bestimmten Haus wohnen“, erklärt er. Wer mag, selbst ein Kind war. kann den Kindern auch eine Kamera in die Hand drücken und sie auf Fotosafari schicken, zum Beispiel mit Da haben ihn immer der Aufgabe, etwas Großes, etwas Kleines und etwas Lebendiges zu fotografieren. Im Wald kann mithilfe die Sachgeschichten eines Fieberthermometers die Temperatur des Wassers gemessen werden. Oder man nimmt eine Küchen- fasziniert. Und viel- waage mit und sucht Gegenstände, von denen man glaubt, sie würden ein Kilo wiegen. -
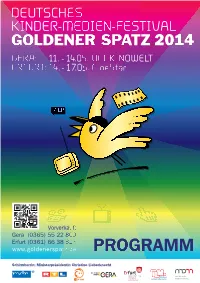
Programmheft 2014
UnsereUnsere Kinder- und JugendfJugendförderung:förörderung: GutGut fürfür die Jugend. GutGut für Mittelthüringen.MittMittelthüringen. DerDer KreativitätKreativitäteativität Flügel verleihen:verleihen: FürFür die EntwicklungEntwicklun unsererunsererr Gesellschaft sind KuKunst und KulturKultur entscheidend mitvmitverantwortlich.erantwortlich. Dazu brauchtbraauchtucht es krkreativeeative KöpfKöpfe,e, die ihrihree Schaffens-Schaffens - kraftkraft fürfür andereandere erlebbarbbarr machen. Deshalb engagieengagiert sich die SparkasSparkassese MittMittelthüringenelthüringenelthüringen für eineeine VielzahlVielzahl vonvoonn künstlerischen und kkulturellenulturellenellen PrProjektenojekten in unserunserererr RRegion.egion. www.sparkasse-mittelthueringen.dewww.sparkassse-mitte-mittelthueringen.de Inhalt Die Karten kosten: – SPATZ-Ticket: 3,00 Euro Kartenvorverkauf S. 3 – SPATZ-Ticket XL – BAHN: 4,00 Euro Dank + Impressum S. 4–5 – SPATZ-Dauerticket: 7,00 Euro Einleitende Worte zum Festival S. 6–7 – Zuschlag für 3D-Filmvorführungen: 1,00 Euro Die Wettbewerbskategorien + Informations- programm SPATZ-Ticket André Gatzke moderiert die Preisverleihung S. 9 Das SPATZ-Ticket berechtigt den Besitzer zum Besuch Filmprogramm ab 4 Jahre S. 10–13 einer Kinoveranstaltung und zur Hin- und Rückfahrt mit Die Kinderjurys S. 13 GVB bzw. EVAG. Filmprogramm ab 6 Jahre S. 14–19 SPATZ-Ticket XL Filmpatenschaften Mit dem SPATZ-Ticket XL – BAHN können Besucher Filmhefte für Pädagog/innen S. 15 mit den Zügen der DB Regio, Erfurter Bahn und Süd- Filmprogramm ab 8 Jahre S. -
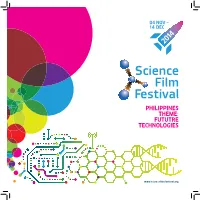
Philippines Theme: Fututre Technologies
04 NOV – 14 DEC 14 0 2 PHILIPPINES THEME: FUTUTRE TECHNOLOGIES www.sciencefilmfestival.org GREETING WORDS GREETING WORDS Message from the Goethe-Institut Philippinen DR. PETRA RAYMOND DIRECTOR After its founding in Bangkok 10 years ago, the Science Film The Goethe-Institut in Bangkok collected 277 films from 50 Festival gains more and more attention and success every year. different countries and out of it selected 78 films from 27 The main goal is to give the younger generation access to science countries to give to the local juries in each participating country. to awaken their interest and motivate them to pursue a career We are very proud that our proficient jury in the Philippines in this field. selected 32 movies out of 15 different countries. These especially selected films communicate scientific concepts in an easily In 2014 the Science Film Festival showcases the theme “Future digestible and enjoyable form, providing schools and institutions Technologies” – a logical next step from the theme “Renewable a non-traditional medium for science teaching and learning. Energy” in 2013. It’s the 5th time for the Philippines to participate in the festival. With the support of our partners, the 32 science films will be shown in over 200 schools and universities all over the This year’s festival highlights new technologies that will shape archipelago this year, and will cater to thousands and thousands our future. Technologies are developing with a breathtaking of viewers both young and old. pace and new scientific fields like gentech, nanotech, synthetic biology, graphene, algae fuel und quantum computers are taking Our thanks go to our valuable partners who continue to help us center stage. -

Grimme 2012: Uwe Kammann, E-Mail [email protected] Dr
grimmegrimme 48. 48. Grimme-Preis Grimme-Preis 2012 2012 Jury-Einblicke • Die Preise Die Inhalte • Begründungen Jury-Einblicke • Die Preise Porträts • Trends Die Inhalte • Begründungen Hintergrund • Die Künstler Porträts • Trends Hintergrund • Die Künstler | Foto: Thorsten Jander | NDR DER TATORTREINIGER Das prickelt! „Eindringlich, skurril, nachdenklich – so unterschiedlich die drei NDR Produktionen sind, die einen Grimme-Preis 2012 erhalten, eins haben sie gemeinsam: Sie stehen für Qualität. Allen Preisträgern gratuliere ich zu ihrem großen Erfolg.“ Lutz Marmor, NDR Intendant HOMEVIDEO (NDR/BR/ARTE) Jan Braren (Buch) | Kilian Riedhof (Regie) Benedict Neuenfels (Kamera) Jonas Nay, Sophia Boehme (Darsteller) DER TATORTREINIGER (NDR) Mizzi Meyer (Buch) | Arne Feldhusen (Regie) Bjarne Mädel (Darsteller) | Benjamin Ikes (Schnitt) DIE JUNGS VOM BAHNHOF ZOO (RBB/NDR) Rosa von Praunheim (Buch/Regie) xxxxx_ndr_AZ_grimme12.indd 1 02.03.12 13:15 GRIMME-PREIS ARTE GRATULIERT DEN PREISTRÄGERN 2012 4 48. GRIMME-PREIS 2012 48. GRIMME-PREIS 2012 DeFodi / Julia von Vietinghoff / Foto: picture alliance Foto: ARD Degeto Das große Ach und Ächzen von Uwe Kammann.......................................7 Homevideo (ARTE / NDR / BR).................................................................................60 Zwischen Krisen und großen Leiden von Silke Burmester......................8 Aus der Jury Fiktion Das Beste aus den Möglichkeiten von Patrick Bahners ..........................63 Eine Frage der Sichtweise von Johannes Hano.........................................10 -

Award Ceremony 2020
EDUARD RHEIN FOUNDATION 2020 EDUARD RHEIN STIFTUNG 2020 Table of Contents: The Foundation and its Committees . 4 Statutes . 6 Foundation Assets and Amount of Awards . 8 Nominations . 10 Award Winners . 11-25 The Eduard Rhein Ring of Honor . 27 The Founder . 28 Managing Chairman from 1990 until 2015. 30 Eduard Rhein Award Winners 2020 . 32– This brochure contains a number of photographs related to Eduard Rhein’s life and to his Foundation. The history of the Foundation on the Internet: www.Eduard-Rhein-Foundation.de Inhaltsverzeichnis: Die Stiftung und ihre Gremien . 5 Satzung . 7 Stiftungsvermögen und Preishöhe. 9 Nominierungen . 10 Preisträger . 11-25 Der Eduard-Rhein-Ehrenring . 27 Der Stifter . 29 Geschäftsführender Vorstand von 1990 bis 2015 . 31 Eduard-Rhein-Preisträger 2020 . 32– Diese Broschüre enthält einige Fotos zum Leben Eduard Rheins und zu seiner Stiftung. Die Geschichte der Stiftung im Internet: www.Eduard-Rhein-Stiftung.de 3 The Foundation and its Committees Die Stiftung und ihre Gremien Founded in 1976 Gründungsjahr 1976 Legal Seat Free and Hanseatic City of Hamburg Sitz der Stiftung Freie und Hansestadt Hamburg Foundation goals The promotion of scientific research and of learning, Stiftungszweck Förderung der wissenschaftlichen Forschung sowie der according to the the arts, and culture at home and abroad nach Neufassung Bildung, Kunst und Kultur im In- und Ausland statutory through monetary awards der Satzung 1989 durch Vergabe von Geldpreisen revision of 1989 Management Tannenfleckstraße 30 Headquarters 82194 Groebenzell, Germany Geschäftsführung Tannenfleckstraße 30 www.eduard-rhein-stiftung.de der Stiftung 82194 Groebenzell www.eduard-rhein-stiftung.de Executive Board Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim Grallert (Managing Chairman) Prof. -

O-TON NRW Geschäftsbericht 2014 GESCHÄFTSBERICHT 2014 We Stdeutscher Rundfunk Köln Anstalt Des Öffentlichen Rechts Geschäftsbericht 2014
WESTDEUTSCHER RUNDFUNK O-TON NRW GESCHÄFTSBERICHT 2014 GESCHÄFTSBERICHT 2014 WE STDEUTSCHER RUNDFUNK KÖLN ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS GESCHÄFTSBERICHt 2014 aufgestellt gemäß § 41 Abs. 5 WDR-Gesetz Köln, den 30. April 2015 Tom Buhrow Intendant Geprüft gemäß § 21 Abs. 2 Ziffer 4 Genehmigt gemäß § 41 Abs. 7 in Verbindung WDR-Gesetz in der 739. Sitzung des mit § 16 Abs. 2 Ziffer 9 WDR-Gesetz Verwaltungsrates am 12./13. Juni 2015 in der 569. Sitzung des Rundfunkrates 30. Juni 2015 Dr. Ludwig Jörder Ruth Hieronymi Vorsitzender des Verwaltungsrates Vorsitzende des Rundfunkrates Immer in Bewegung, immer wandlungsfähig, nie angepasst. in den bewegten Zeiten für die Medienbranche gerät auch beim WDR vieles Für Pilotprojekte und Experimente stehen jährlich drei Millionen Euro bereit. in Bewegung. Der Wandel in der Mediennutzung beschäftigt uns programm- Außerdem haben wir ein Kreativvolontariat eingerichtet, um junge Talente lich und organisatorisch. Gleichzeitig gilt es, große Haushaltslöcher zu stop- frühzeitig zu erkennen und an uns zu binden. Mit Formaten wie den »Unwahr- fen. Mit dynamischen und verschlankten Strukturen reagieren wir auf diese scheinlichen Ereignissen im Leben von …« und der »RebellComedy« wagen Situation und begreifen sie als Chance, die tradierten Werte des öffentlich- wir uns auf Neuland und signalisieren dem künstlerischen Nachwuchs: Auch rechtlichen Rundfunks in einer modernen Medienlandschaft zu etablieren und die jungen Wilden sind auf den Bühnen des WDR zu Hause. Unsere neue sie dem jungen Publikum nahezubringen. Unterhaltungsshow mit Carolin Kebekus ist zum Beispiel mit 1,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bundesweit und einem Marktanteil in NRW Um die Handlungsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig zu sichern, haben von insgesamt 10,6 Prozent sehr erfolgreich gestartet. -

Kinderfernsehen? Ja, Klar – Aber…
BACHELORARBEIT Frau Sarah Christine Farfsing KINDERFERNSEHEN? JA, KLAR – ABER… Eine Untersuchung zweier TV-Formate unter medienpädagogischen Gesichtspunkten, sowie ein neues Format . 2012 Fakultät: Medien BACHELORARBEIT KINDERFERNSEHEN? JA, KLAR – ABER… Eine Untersuchung zweier TV-Formate unter medienpädagogischen Gesichtspunkten, sowie ein neues Format Autorin: Frau Sarah Christine Farfsing Studiengang: Angewandte Medienwirtschaft- TV-Producing/ TV-Journalismus Seminargruppe: AM09wT1-B Erstprüfer: Prof. Peter Gottschalk Zweitprüfer : Cornelia Göbel Einreichung: Mittweida, 23.07.2012 Faculty of Media BACHELOR THESIS CHILDREN`S TELEVISION? YES, SURE – BUT… An examination of two TV-Programs in terms of educa tional media, as well as a new Program author: Ms. Sarah Christine Farfsing course of studies: Applied Media Business- TV-Producing/ TV-Journalism seminar group: AM09wT1-B first examiner: Prof. Peter Gottschalk second examiner: Cornelia Göbel Submission: Mittweida, 23.07.2012 Bibliografische Angaben Farfsing, Sarah: KINDERFENSEHEN? JA, KLAR – ABER… Eine Untersuchung zweier TV-Formate unter medienpädagogischen Gesichtspunkten, sowie ein neues Format. CHILDREN`S TELEVISION? YES, SURE – BUT… An examination of two TV-Programs in terms of educational media, as well as a new program. 74 Seiten, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences, Fakultät Medien, Bachelorarbeit, 2012 Inhaltsverzeichnis V Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis ............................................................................................................. -

A Comparative Analysis of Children Tv Shows in the Philippines and in Germany
The Online Journal of Communication and Media – October 2017 Volume 3, Issue 4 YOUTH MEDIA IN TWO WORLDS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF CHILDREN TV SHOWS IN THE PHILIPPINES AND IN GERMANY May Belle GUILLERGAN-SCHOTT Division of Humanities University of the Philippines Visayas Miagao, Iloilo, Philippines [email protected] ABSTRACT This research analysed media products that have withstood time and are well-recognised by their target audience within the country they are produced. The observations generated systematic comparisons of the products’ formats, contents, visual characteristics and combination of educational and entertaining elements, leading to a discovery of the inherent and specific influence media products (namely, Goin’ Bulilit vs. Die Sendung mit der Maus, and Batibot vs. Unser Sandmännchen) have towards young audiences. It was inferred that: TV formats of the same genre are similar despite cultural divergence. The differences lie on the cultural philosophies, viewpoints, and values conveyed by the show. TV productions of different cultures present divergent social values. The presentation of these values is unique to each other’s cultural context. The results pinpoint which areas a Filipino immigrant child can possibly experience difficulty when integrating into the German community because media focus on different values in different countries. It can be said that children who grew up in different media environments will have developed different media literacy skills. Keywords: Children’s TV content, genre, and format, cultural diversity, media literacy INTRODUCTION Television has become indispensable in most homes and has evolved into a daily pastime activity. Quite understandably out of sincere concern for their children, parents cannot seem to stop asking whether television has good or bad effects on the growth and development of a child.