Der Biberkäfer Platypsyllus Castoris RITSEMA, 1869 (Ins., Coleoptera)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
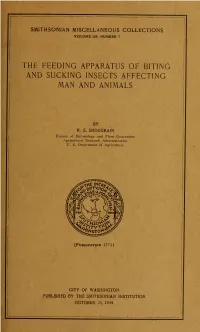
Smithsonian Miscellaneous Collections
SMITHSONIAN MISCELLANEOUS COLLECTIONS VOLUME 104, NUMBER 7 THE FEEDING APPARATUS OF BITING AND SUCKING INSECTS AFFECTING MAN AND ANIMALS BY R. E. SNODGRASS Bureau of Entomology and Plant Quarantine Agricultural Research Administration U. S. Department of Agriculture (Publication 3773) CITY OF WASHINGTON PUBLISHED BY THE SMITHSONIAN INSTITUTION OCTOBER 24, 1944 SMITHSONIAN MISCELLANEOUS COLLECTIONS VOLUME 104, NUMBER 7 THE FEEDING APPARATUS OF BITING AND SUCKING INSECTS AFFECTING MAN AND ANIMALS BY R. E. SNODGRASS Bureau of Entomology and Plant Quarantine Agricultural Research Administration U. S. Department of Agriculture P£R\ (Publication 3773) CITY OF WASHINGTON PUBLISHED BY THE SMITHSONIAN INSTITUTION OCTOBER 24, 1944 BALTIMORE, MO., U. S. A. THE FEEDING APPARATUS OF BITING AND SUCKING INSECTS AFFECTING MAN AND ANIMALS By R. E. SNODGRASS Bureau of Entomology and Plant Quarantine, Agricultural Research Administration, U. S. Department of Agriculture CONTENTS Page Introduction 2 I. The cockroach. Order Orthoptera 3 The head and the organs of ingestion 4 General structure of the head and mouth parts 4 The labrum 7 The mandibles 8 The maxillae 10 The labium 13 The hypopharynx 14 The preoral food cavity 17 The mechanism of ingestion 18 The alimentary canal 19 II. The biting lice and booklice. Orders Mallophaga and Corrodentia. 21 III. The elephant louse 30 IV. The sucking lice. Order Anoplura 31 V. The flies. Order Diptera 36 Mosquitoes. Family Culicidae 37 Sand flies. Family Psychodidae 50 Biting midges. Family Heleidae 54 Black flies. Family Simuliidae 56 Net-winged midges. Family Blepharoceratidae 61 Horse flies. Family Tabanidae 61 Snipe flies. Family Rhagionidae 64 Robber flies. Family Asilidae 66 Special features of the Cyclorrhapha 68 Eye gnats. -

Beaver Management Technical Paper #3 Beaver Life History and Ecology Best Science Review
Beaver Management Technical Paper #3 Beaver Life History and Ecology Best Science Review April 2020 Alternate Formats Available Beaver Management Technical Paper #3 Beaver Life History and Ecology Best Science Review Submitted by: Jen Vanderhoof King County Water and Land Resources Division Department of Natural Resources and Parks Beaver Life History and Ecology Best Science Review Acknowledgements Extensive review and comments were provided by Bailey Keeler on the “Diet” and “Territoriality & Scent Mounds” sections, and she wrote a portion of the “Predation” section. Review and comments were provided by Bailey Keeler, Brandon Duncan, Matt MacDonald, and Kate O’Laughlin of King County. Dawn Duddleson, librarian for Water and Land Resources Division, obtained the majority of the papers cited in this report. Tom Ventur provided technical support and formatting for this document. Citation King County. 2020. Beaver management technical paper #3: beaver life history and ecology best science review. Prepared by Jen Vanderhoof, Water and Land Resources Division. Seattle, Washington. King County Science and Technical Support Section i April 2020 Beaver Life History and Ecology Best Science Review Table of Contents 1.0 Introduction .....................................................................................................................1 2.0 Beaver Populations .........................................................................................................3 2.1 History .........................................................................................................................3 -

Ectoparasitic Insects Genera of Veterinary Importance and Some Aspects of Their Control
American Journal of Economics, Finance and Management Vol. 4, No. 4, 2018, pp. 116-123 http://www.aiscience.org/journal/ajefm ISSN: 2381-6864 (Print); ISSN: 2381-6902 (Online) Ectoparasitic Insects Genera of Veterinary Importance and Some Aspects of Their Control Muhammad Sarwar 1, *, Arfa Rauf 2 1National Institute for Biotechnology & Genetic Engineering (NIBGE) , Faisalabad, Punjab, Pakistan 2Allied Hospital- Punjab Medical College, Faisalabad, Punjab, Pakistan Abstract Agricultural animals (those used for production of food and fibre- livestock) and companion animals (pets such as dogs and cats) may be affected by arthropod pests. Insects as veterinary ectoparasites have a significant impact on the health, wellbeing and productivity of their animal vertebrate hosts. These impacts can be either direct, through tissue damage and blood loss, or indirect, through their role as vectors of viral, bacterial, protozoa and helminth pathogens. A second category of indirect effects are those that result from the alteration of host behaviour induced by arthropod attack and blood-feeding activity. So, the present article aims to contribute fundamental scientific knowledge in the areas of insects as veterinary ectoparasites and also the processes ensuring to the public for underlying the protection from biting and diseases borne. The insect ectoparasites include flies (Diptera), lice (Mallophaga), fleas (Siphonaptera) and bugs (Hemiptera). These insects have a profound impact on the health of animals by causing annoyance, inflicting bites and stings, and transmitting of diseases. Animals can be greatly annoyed by the presence and activity of certain insects. For example, cattle will bunch up and put their lowered heads together to seek relief when fly strike is severe; scratching may be symptoms of fleas or lice; and head shaking may indicate the presence of insects in ear. -

A New Record of the Parasitic Beaver Beetle (Platypsyllus Castoris) (Coleoptera: Leiodidae) from Stavropol Territory (Russia)
Available online at www.easletters.com Entomology and Applied Science ISSN No: 2349-2864 Letters, 2014, 1, 4:1-3 A new record of the parasitic beaver beetle (Platypsyllus Castoris) (Coleoptera: Leiodidae) from Stavropol Territory (Russia) S.V. Pushkin North Caucasian Federal University, Institute of Live Systems, Botany, Zoology and General Biology Department; 355009 (Stavropol), Russia Correspondence: [email protected] (Received: 12/8/14 ) (Accepted:2/10/14) _____________________________________________________________________________________________ ABSTRACT Platypsyllus castoris Ritsema, 1869 previously noted only in Voronezh Region is found in Stavropol area (Russia) for the first time. This species was collected not on beaver, for which it was cited earlier, but on river otter ((Lutra lutra meridionalis (Ognev 1931)) – rare species of the North Caucasian region. Key words : Coleoptera, Leiodidae, Platypsyllus castoris , Stavropol area Russia. _____________________________________________________________________________________________ INTRODUCTION In 2013, the hairline Caucasian otter ((Lutra lutra meridionalis (Ognev, 1931)) collected near Budennovska, Pyatigorsk; Stavropol Krai (Kuban river) were collected 2 female beaver beetles Platypsyllus castoris Ritsema, 1869. This is the third discovery of this interesting parasitic insect with the European part of the former USSR, distant to the south for 300 km from the first [12] and about 100 from the second [1]. Particular interest is the fact that this is the second in the European part of the finding of this species parasitic on the otter, and not on traditional host – beaver. MATERIALS AND METHODS The material gathered the standard zoological methods. In total 2 females of a species are collected. 5 otters are examined. During researches any animal has not suffered. The account of number of an otter in territory of Stavropol territory is in passing spent. -

Parasitic Fauna of Eurasian Beavers (Castor Fiber) in Sweden (1997–1998)
Åhlen et al. Acta Vet Scand (2021) 63:23 https://doi.org/10.1186/s13028-021-00588-w Acta Veterinaria Scandinavica RESEARCH Open Access Parasitic fauna of Eurasian beavers (Castor fber) in Sweden (1997–1998) Per‑Arne Åhlen1,3, Göran Sjöberg1* and Margareta Stéen2 Abstract Background: The parasitic fauna of beavers (Castor fber and C. canadensis) has been well studied in many parts of their respective areas of distribution. In Scandinavia there have, however, been limited investigations conducted on the parasites of beavers in recent times. The present study is the frst quantitative survey of parasites on beavers living in Sweden and elsewhere in Scandinavia. We investigated the parasitic fauna of the Eurasian beaver (C. fber) in a North–South gradient in Sweden. The aim of the study was to investigate parasite distribution and prevalence in particular, related to average yearly air temperature and diferent age groups of beavers. A total of 30 beavers were sampled at eight localities, spanning a 720 km North–South gradient during the springs of 1997 and 1998. Results: Five parasite taxa were identifed. Four of these were present in all of the examined beavers, Stichorchis subtriquetrus (trematode), Travassosius rufus (nematode), Platypsyllus castoris (coleopteran), and Schizocarpus spp. (arachnid). A higher number of new infections of S. subtriquetrus, and more adults of T. rufus, were seen in beavers in southern Sweden where temperatures are higher. One‑year old beavers had a higher infestation of S. subtriquetrus, but not of T. rufus, than older individuals. Conclusions: The parasite fauna of Swedish beavers mirrored the impoverished parasite fauna of the original Norwe‑ gian population, and the high prevalence of parasites could be due to low major histocompatibility complex (MHC) polymorphism. -
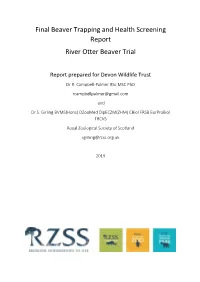
Final Beaver Trapping and Health Screening Report River Otter Beaver Trial
Final Beaver Trapping and Health Screening Report River Otter Beaver Trial Report prepared for Devon Wildlife Trust Dr R. Campbell-Palmer BSc MSC PhD [email protected] and Dr S. Girling BVMS(Hons) DZooMed DipECZM(ZHM) CBiol FRSB EurProBiol FRCVS Royal Zoological Society of Scotland [email protected] 2019 ROBT Final Health Report Summary • Full health screening of the original founder beavers did not demonstrate any evidence of significant zoonotic disease, including Giardia spp., Salmonella spp., Campylobacter spp., Yersinia spp., Cryptosporidium parvum, Echinococcus multilocularis, Franciscella tularensis and Mycobacterium spp. • Exposure and seroconversion to Leptospira spp. was evident in one of the founder beavers and three others over the five-year trial. Subsequent testing showed waning of the antibody response with no clinical disease being evident suggesting these animals were not persistently infected. • No evidence of significant clinical disease in the beavers on the River Otter during the 5 years with overall good body condition being maintained from one year to the next. Campbell-Palmer & Girling 2019 2 ROBT Final Health Report Contents Summary .................................................................................................................................................. 2 Contents ................................................................................................................................................... 3 1. Introduction .................................................................................................................................... -

Eurasian Beaver (Castor Fiber)
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/349031376 Eurasian beaver (Castor fiber) health surveillance in Britain: Assessing a disjunctive reintroduced population Article in The Veterinary record · February 2021 DOI: 10.1002/vetr.84 CITATIONS READS 0 29 12 authors, including: Róisín Campbell-Palmer Frank Rosell Self-employed University of South-Eastern Norway 52 PUBLICATIONS 326 CITATIONS 182 PUBLICATIONS 3,529 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Adam Naylor Georgina Cole Royal Zoological Society of Scotland (RZSS) Royal Zoological Society of Scotland (RZSS) 16 PUBLICATIONS 16 CITATIONS 13 PUBLICATIONS 87 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: BVR Project - Beavers.Voyageurs.Research. View project Species Action Framework View project All content following this page was uploaded by Frank Rosell on 11 February 2021. The user has requested enhancement of the downloaded file. Received: 28 April 2020 Revised: 20 December 2020 Accepted: 10 January 2021 DOI: 10.1002/vetr.84 ORIGINAL RESEARCH Eurasian beaver (Castor fiber) health surveillance in Britain: Assessing a disjunctive reintroduced population Róisín Campbell-Palmer1 Frank Rosell2 Adam Naylor3 Georgina Cole3 Stephanie Mota3 Donna Brown3 Mary Fraser4 Romain Pizzi3 Mark Elliott5 Kelsey Wilson6 Martin Gaywood7 Simon Girling3 1 Independent Consultant, Edinburgh, UK Abstract 2 Faculty of Arts and Sciences, Department of Background: Numerous translocations of Eurasian beavers have occurred Environmental Health Studies, University of with little implementation of standardised health screening. Pre-release Southeast Norway, Bø, Norway health screening enables the selection of individuals with the best survival 3 Veterinary Department, Royal Zoological prospects and reduces potential health risks, but this is by-passed during Society of Scotland, Scotland, UK unofficial releases. -
SNH Commissioned Report 815; a Review Of
Scottish Natural Heritage Commissioned Report No. 815 A review of beaver (Castor spp.) impacts on biodiversity, and potential impacts following a reintroduction to Scotland COMMISSIONED REPORT Commissioned Report No. 815 A review of beaver (Castor spp.) impacts on biodiversity, and potential impacts following a reintroduction to Scotland For further information on this report please contact: Martin Gaywood Scottish Natural Heritage Great Glen House INVERNESS IV3 8NW Telephone: 01463 725230 E-mail: [email protected] This report should be quoted as: Stringer, A.P., Blake, D. & Gaywood, M.J. 2015. A review of beaver (Castor spp.) impacts on biodiversity, and potential impacts following a reintroduction to Scotland. Scottish Natural Heritage Commissioned Report No. 815. This report, or any part of it, should not be reproduced without the permission of Scottish Natural Heritage. This permission will not be withheld unreasonably. The views expressed by the author(s) of this report should not be taken as the views and policies of Scottish Natural Heritage. © Scottish Natural Heritage 2015. COMMISSIONED REPORT Summary A review of beaver (Castor spp.) impacts on biodiversity, and potential impacts following a reintroduction to Scotland Commissioned Report No. 815 Project No: 15442 Year of publication: 2015 Keywords Castor spp; biodiversity; meta-analysis; Scotland; ecosystem engineer; species; habitats. Background This report has been published to help inform the Scottish Government on its decision on the future of beavers within Scotland (see Gaywood, 2015). Beavers are widely considered to be ‘ecosystem engineers’. This term is reserved for those species that have a large impact on an environment, fundamentally changing ecosystems, and creating highly unusual habitats, often considered unique. -
Reintroducing Beavers Castor Fiber to Britain: a Disease Risk Analysis Simon J
bs_bs_banner Mammal Review ISSN 0305-1838 REVIEW Reintroducing beavers Castor fiber to Britain: a disease risk analysis Simon J. GIRLING* Veterinary Department, Royal Zoological Society of Scotland, 134 Corstorphine Road, Edinburgh, EH12 6TS, UK. Email: [email protected] Adam NAYLOR Veterinary Department, Royal Zoological Society of Scotland, 134 Corstorphine Road, Edinburgh, EH12 6TS, UK. Email: [email protected] Mary FRASER G&F Training and Consultancy, Perthshire, PH2 9QD, UK. Email: [email protected] Róisín CAMPBELL‐PALMER Edinburgh, EH7 6NH, UK. Email: [email protected] Keywords ABSTRACT Castor fiber, Eurasian beaver, health screening, reintroduction, species restoration 1. Eurasian beavers Castor fiber are potential hosts for a range of infectious diseases and parasites, including those typical of common European rodents. *Correspondence author. A number of infectious organisms are potentially zoonotic and may be no- tifiable under animal health legislation. The official trial beaver reintroductions Submitted: 21 February 2019 to Scotland, the retrospectively licensed releases in England, and the increas- Returned for revision: 23 April 2019 ingly obvious presence of large numbers of unlicensed illegally released animals Revision accepted: 26 April 2019 have highlighted potential disease risks. Editor: DR doi: 10.1111/mam.12163 2. We aimed to conduct a disease risk analysis, based on peer reviewed publica- tions, for selection and health screening of Eurasian beavers prior to release into the wild in Britain. 3. Adapted from the International Union for the Conservation of Nature’s ‘Guidelines for Disease Risk Analysis’, a four‐step process was used to for- mulate a disease risk analysis: 1) problem description; 2) hazard identification based on literature review; 3) risk assessment, which resulted in categorisation of pathogens into low, medium, and high risk; and 4) risk management: identification of mitigating measures, followed by risk re‐evaluation in light of the reported effectiveness of the mitigation measures. -

Volume 55, Number 3
ALGONQUIN PARK IS BLACK BEAR COUNTRY “Maddie” the Map Turtle Vol. 55, No. 3 • August 1, 2014 For most Park visitors, seeing a by Patrick Moldowan Black Bear in its natural environment BIG news from the Turtle Lab! Over the to a Painted Turtle. Not wasting any time, she The is an exciting experience. However, 43 years of the Algonquin Turtle Project there dove off her log and headed for deep water. the excitement diminishes when that have been a lot of firsts. Each and every year Turtle Researchers followed close and after Black Bear is rummaging through brings something new to discover and the 2014 much splashing, hollering, and excitement your cooler or tent, searching for food. field season is no exception. We are ecstatic “Maddie” the Map Turtle was in hand! As visitors camping in bear country, to announce the first capture of a Northern As the first of her kind on the west side of aven you have a responsibility to follow Map Turtle (Graptemys geographica) in Algonquin Park, Maddie has a lot to teach us. A Natural and Cultural History Digest Algonquin Provincial Park! the bear rules and to know what to There is still a lot of speculation about this Reports of a Map Turtle in Algonquin turtle’s past. Where did she come from? Is this do if you encounter a bear. first circulated during the summer of 2012 R a case of range expansion, natural dispersal when Park Naturalist Justin Peter snapped into new habitat, or relocation by humans? a photo of an individual basking in the We look forward to following up with Maddie Think inside the lodge by David LeGros Madawaska River, near Lake of Two Rivers. -

Distribution and Biology of the Ectoparasitic Beaver Beetle Platypsyllus Castoris Ritsema in North America (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae)
University of Nebraska - Lincoln DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln Center for Systematic Entomology, Gainesville, Insecta Mundi Florida March 2006 Distribution and biology of the ectoparasitic beaver beetle Platypsyllus castoris Ritsema in North America (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae) Stewart B. Peck Carleton University, Canada Follow this and additional works at: https://digitalcommons.unl.edu/insectamundi Part of the Entomology Commons Peck, Stewart B., "Distribution and biology of the ectoparasitic beaver beetle Platypsyllus castoris Ritsema in North America (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae)" (2006). Insecta Mundi. 108. https://digitalcommons.unl.edu/insectamundi/108 This Article is brought to you for free and open access by the Center for Systematic Entomology, Gainesville, Florida at DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. It has been accepted for inclusion in Insecta Mundi by an authorized administrator of DigitalCommons@University of Nebraska - Lincoln. INSECTA MUNDI, Vol. 20, No. 1-2, March-June, 2006 85 Distribution and biology of the ectoparasitic beaver beetle Platypsyllus castoris Ritsema in North America (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae) Stewart B. Peck Department of Biology, Carleton University, 1125 Colonel By Drive, Ottawa K1S 5B6 Canada Abstract: The distribution and biology of the beaver beetle, Platypsyllus castoris Ritsema, are summarized for North America. In light of the fact that the beetle uses two beaver species as hosts which have seemingly been separated for some five million years on two continents, it is asked if the Nearctic and Palearctic beetle populations are really the same species. Introduction from an ancestor which was a scavenger in small mammal nests or burrow systems (Waage 1979, The beetle family Leiodidae contains 335 known Wood 1965) and Cholevinae would be the most likely species in America north of Mexico, and these have candidate for this habit. -

0003 Insecta Mundi
INSECTA MUNDI A Journal of World Insect Systematics 0003 Distribution and biology of the ectoparasitic beetles Leptinillus validus (Horn) and L. aplodontiae Ferris of North America (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae) Stewart B. Peck Department of Biology Carleton University 1125 Colonel By Drive Ottawa K1S 5B6 Canada Date of Issue: 25 April 2007 CENTER FOR SYSTEMATIC ENTOMOLOGY, INC., Gainesville, FL Stewart B. Peck Distribution and biology of the ectoparasitic beetles Leptinillus validus (Horn) and L. aplodontiae Ferris of North America (Coleoptera: Leiodidae: Platypsyllinae) Insecta Mundi 0003: 1-7 Published in 2007 by Center for Systematic Entomology, Inc. P. O. Box 147100 Gainesville, FL 32604-7100 U. S. A. http://www.centerforsystematicentomology.org/ Insecta Mundi is a journal primarily devoted to insect systematics, but articles can be pub- lished on any non-marine arthropod taxon. Manuscripts considered for publication include, but are not limited to, systematic or taxonomic studies, revisions, nomenclatural changes, faunal studies, book reviews, phylogenetic analyses, biological or behavioral studies, etc. Insecta Mundi is widely distrib- uted, and referenced or abstracted by several sources including the Zoological Record, CAB Abstracts, etc. As of 2007, Insecta Mundi is published irregularly throughout the year, not as a quarterly issues. As manuscripts are completed they are published and given an individual number. Manuscripts must be peer reviewed prior to submission, after which they are again reviewed by the editorial board to insure quality. One author of each submitted manuscript must be a current member of the Center for Systematic Entomology. Managing editor: Paul E. Skelley, e-mail: [email protected] Production editor: Michael C.