1. Die Musikliturgischen Handschriften Des Supplementum Graecum
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Oktoechos and Multipart Modality. Oral Traditions of Italo-Albanian Communities in Sicily and Calabria by Oliver Gerlach
IMS-RASMB, Series Musicologica Balcanica 1.1, 2020. e-ISSN: 2654-248X Oktoechos and Multipart Modality. Oral Traditions of Italo-Albanian Communities in Sicily and Calabria by Oliver Gerlach Click here for musical examples or see the online Abstract page of the article → left column, Article Tools → Supplementary files DOI: https://doi.org/10.26262/smb.v1i1.7758 ©2020 The Author. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Non- Commercial NoDerivatives International 4.0 License https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ (CC BY-NC-ND 4.0), which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided that the articles is properly cited, the use is non- commercial and no modifications or adaptations are made. The copyright for eventually included manuscripts belongs to the manuscript holders. Gerlach, Oktoechos and Multipart Modality… Oktoechos and Multipart Modality. Oral Traditions of Italo-Albanian Communities in Sicily and Calabria1 Oliver Gerlach Abstract: The main difference with respect to the Balkans is that Italo-Greek as well as Arbëresh communities had been rural throughout the centuries. Hence, the community itself did the job of the choir during Orthodox celebrations, which became only possible in certain communities belonging to two Archdioceses of the Byzantine rite: Lungro in Calabria and Piana degli Albanesi on Sicily. Within the catholic church they were allowed to celebrate the Greek rite, but this became possible due to a new law in church administration which existed since the 18th century. The question if there did really exist a continuous oral transmission since the arrival of Albanian emigrants during the last decades of the 15th century, and in as far they adapted to local customs of the Italo-Byzantine tradition which had survived around the Archimandritates in Italy, has not been an issue of historical research yet. -
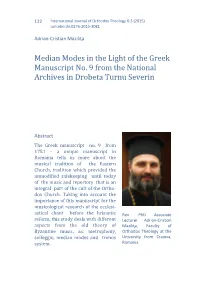
Median Modes in the Light of the Greek Manuscript No. 9 from the National Archives in Drobeta Turnu Severin
122 International Journal of Orthodox Theology 6:3 (2015) urn:nbn:de:0276-2015-3081 Adrian-Cristian Maziliţa Median Modes in the Light of the Greek Manuscript No. 9 from the National Archives in Drobeta Turnu Severin Abstract The Greek manuscript no. 9 from 1751 – a unique manuscript in Romania tells us more about the musical tradition of the Eastern Church, tradition which provided the unmodified safekeeping until today of the music and repertory that is an integral part of the cult of the Ortho- dox Church. Taking into account the importance of this manuscript for the musicological research of the ecclesi- astical chant before the hrisantic Rev. PhD Associate reform, this study deals with different Lecturer Adrian-Cristian aspects from the old theory of Maziliţa, Faculty of Byzantine music, as: metrophony, Orthodox Theology at the solfeggio, median modes and trohos University from Craiova, system. Romania Median Modes in the Light of the Greek Manuscript No. 9 from the 123 National Archives in Drobeta Turnu Severin Keywords Greek manuscript, Byzantine chant, old notation, median modes, trohos system, Saint Ioannes Koukouzeles, Ioannes Plousiadinos 1 Median Modes A particularly important element presented in the Greek manuscript no. 9 at the National Archives in Drobeta Turnu - Severin1, is the median modes about which, until now, we have few accounts. 1 The Greek manuscript no. 9 at the National Archives in Drobeta Turnu- Severin, includes excerpts from the theoretical work of Saint Ioannes Koukouzeles, hermeneia of St. Ioan Damaschin, hermeneia of Manuel Chrysaphes about requirements of psaltic music and about phtorals, of the monk Pahomie and hermeneia about trills, together with musical- theological explanation written by Nikolaos Malaxos. -

Course Listing Hellenic College, Inc
jostrosky Course Listing Hellenic College, Inc. Academic Year 2020-2021 Spring Credit Course Course Title/Description Professor Days Dates Time Building-Room Hours Capacity Enrollment ANGK 3100 Athletics&Society in Ancient Greece Dr. Stamatia G. Dova 01/19/2105/14/21 TBA - 3.00 15 0 This course offers a comprehensive overview of athletic competitions in Ancient Greece, from the archaic to the hellenistic period. Through close readings of ancient sources and contemporary theoretical literature on sports and society, the course will explore the significance of athletics for ancient Greek civilization. Special emphasis will be placed on the Olympics as a Panhellenic cultural institution and on their reception in modern times. ARBC 6201 Intermediate Arabic I Rev. Edward W. Hughes R 01/19/2105/14/21 10:40 AM 12:00 PM TBA - 1.50 8 0 A focus on the vocabulary as found in Vespers and Orthros, and the Divine Liturgy. Prereq: Beginning Arabic I and II. ARTS 1115 The Museums of Boston TO BE ANNOUNCED 01/19/2105/14/21 TBA - 3.00 15 0 This course presents a survey of Western art and architecture from ancient civilizations through the Dutch Renaissance, including some of the major architectural and artistic works of Byzantium. The course will meet 3 hours per week in the classroom and will also include an additional four instructor-led visits to relevant area museums. ARTS 2163 Iconography I Mr. Albert Qose W 01/19/2105/14/21 06:30 PM 09:00 PM TBA - 3.00 10 0 This course will begin with the preparation of the board and continue with the basic technique of egg tempera painting and the varnishing of an icon. -

National Inventory of Intangible Cultural Heritage of Greece
NATIONAL INVENTORY OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF GREECE I. BRIEF PRESENTATION OF THE ELEMENT OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (ICH) 1. Name : Chant. Other names : Byzantine Music, Eastern Orthodox Church Music, Art of Chanting, Chant of Constantinople, Psaltic Art, Psalmody, Hymnody 2. Identification : The mnemotechnics of the rendering of chants in Church services (practitioners, Liturgical Typikon, planning of concerts, resources, manuals, training and its characteristic cultural constitutive elements and idioms). 3. Domain represented by the element • Oral traditions and expressions. The fundamental subject of chanting is bound by specific techniques and theoretical knowledge on many levels provided exclusively in church staged rites. These components require long studies and systematic exercise in church choirs, where trainees specialize in specific levels and areas of expertise (rising from the lower roles of Anagnostis [Reader], Canonarch [who intones the verses of the hymns], Isokratis [who holds the fundamental note of a given melodic section] or Melodist, to the higher offices of Domestikos B and Domestikos A [Assistants to the Leaders of the Left and Right Choirs, respectively], Lampadarios [Leader of the Left Choir] or Protopsaltis [First Cantor, Leader of the Right Choir]). In this manner, the knowledge of chanting is transmitted orally from the older masters to the younger. Moreover, mnemonic, practical methods and insignificant phrases or words or even mnemonic verses capture and summarize the basic practical knowledge (interpretations, “ananes” for an intonation, or “neanes”, “nana”, “agia” etc.). • Liturgical arts as cultural means of self-determination. In conjunction with church poetry (psalms, hymns), chant is the liturgical art par excellence within the framework of Holy Services in Orthodox churches. -

Publications Monographs and Books 1
ANASTASIA SIOPSI [email protected] Anastasia Siopsi is Professor in “Aesthetics of Music”, Music Department, Ionian University; she is also tutor of a course entitled “History of the Arts in Europe” (degree in “European Culture”), Greek Open University (since 2004). Apart from her studies in music, she has studied architecture (Aristotle University of Thessaloniki, Department of Architecture, Thessaloniki, 1989). Her PhD dissertation is entitled Richard Wagner’s «Der Ring des Nibelungen»: The Reforging of the Sword or, Towards a Reconstruction of the People’s Consciousness, U.E.A., U.K., 1996); supervisors: Professor David Charlton, Professor John Deathridge. She is co-editor of an electronic international journal entitled Hellenic Journal of Music, Education and Culture (HeJMEC), with Prof. G. Welsh (Univ. of London). She is also member of the editorial team of the musicological journal entitled Mousikos Logos [Greek], published by the Music Department of Ionian University. She has been a reviewer for the musicological journal entitled Nineteenth-century Music Review. She is a peer reviewer for the international Journal of History Research (ISSN 2159-550X) (David publishing company). Scholarships Academy of Athens, scholarship for postgraduate studies abroad in the field of Musicology and History of Music (duration: 3 years). Main research interests ♪ Issues on aesthetics of music, focused on 19th-century aesthetic theories. ♪ German romantic music, especially Richard Wagner’s music dramas. ♪ Greek art music, especially Manolis Kalomiris’s work and aesthetic and ideological issues in the era of the National School of Music. ♪ Music in productions of ancient Greek drama in modern Greece. ♪ Greek women composers. PUBLICATIONS MONOGRAPHS AND BOOKS 1. -

3 Cappella Romana Presents VENICE in the EAST: Renaissance Crete
Cappella Romana presents VENICE IN THE EAST: Renaissance Crete & Cyprus Wednesday, 8 May 2019, 7:30 p.m. Touhill Performing Arts Center, University of Missouri, Saint Louis Friday, 10 May 2019 at 7:30 p.m. Alexander Lingas Christ Church Cathedral, Vancouver, British Columbia Founder & Music Director Presented by Early Music Vancouver Saturday, 11 May 2019 at 8:00 p.m. St. Ignatius Parish, San Francisco Spyridon Antonopoulos John Michael Boyer Kristen Buhler PROGRAM Aaron Cain Photini Downie Robinson PART I David Krueger Emily Lau From the Byzantine and Venetian Commemorations of the Paschal Triduum Kerry McCarthy The Crucifixion and Deposition Mark Powell Catherine van der Salm Venite et ploremus Johannes de Quadris David Stutz soloists: Aaron Cain, Mark Powell Liber sacerdotalis (1523) of Alberto Castellani Popule meus Liber sacerdotalis soloist: Kerry McCarthy Sticherón for the Holy Passion: Ἤδη βάπτεται (“Already the pen”) 2-voice setting (melos and “ison”) Manuel Gazēs the Lampadarios (15th c.) soloists: Spyridon Antonopoulos, MS Duke, K. W. Clark 45 John Michael Boyer Traditional Melody of the Sticherarion Mode Plagal 4 Cum autem venissent ad locum de Quadris Liber sacerdotalis soloists: Aaron Cain, Mark Powell O dulcissime de Quadris Liber sacerdotalis soloists: Photini Downie Robinson, Kerry McCarthy Verses of Lamentation for the Holy Passion “Corrected by” Angelos Gregoriou MS Duke 45, Mode Plagal 2 Sepulto Domino de Quadris Liber sacerdotalis The Resurrection Attollite portas (“Lift up your gates”) Liber sacerdotalis celebrant: Mark Powell Ἄρατε πύλας (“Lift up your gates”) Anon. Cypriot (late 15th c.?), MS Sinai Gr. 1313 Attollite portas … Quem queritis … Liber sacerdotalis Χριστὸς ἀνέστη (“Christ has risen”) Cretan Melody as transcribed by Ioannis Plousiadenós (ca. -

A Byzantine Christmas
VOCAL ENSEMBLE 26th Annual Season October 2017 Tchaikovsky: All-Night Vigil October 2017 CR Presents: The Byrd Ensemble November 2017 Arctic Light II: Northern Exposure December 2017 A Byzantine Christmas January 2018 The 12 Days of Christmas in the East February 2018 Machaut Mass with Marcel Pérès March 2018 CR Presents: The Tudor Choir March 2018 Ivan Moody: The Akáthistos Hymn April 2018 Venice in the East A Byzantine Christmas: Sun of Justice 1 What a city! Here are just some of the classical music performances you can find around Portland, coming up soon! JAN 11 | 12 FEB 10 | 11 A FAMILY AFFAIR SOLO: LUKÁŠ VONDRÁCˇEK, pianist Spotlight on cellist Marilyn de Oliveira Chopin, Smetana, Brahms, Scriabin, Liszt with special family guests! PORTLANDPIANO.ORG | 503-228-1388 THIRDANGLE.ORG | 503-331-0301 FEB 16 | 17 | 18 JAN 13 | 14 IL FAVORITO SOLO: SUNWOOK KIM, pianist Violinist Ricardo Minasi directs a We Love Our Volunteers! Bach, Beethoven, Schumann, Schubert program of Italy’s finest composers. n tns to our lol volunteers o serve s users ste re o oe ersonnel osts PORTLANDPIANO.ORG | 503-228-1388 PBO.ORG | 503-222-6000 or our usns or n ottee eers n oe ssstnts Weter ou re ne to JAN 15 | 16 FEB 21 us or ou ve een nvolve sne te ennn tn ou or our otent n nness TAKÁCS QUARTET MIRÓ QUARTET WITH JEFFREY KAHANE “The consummate artistry of the Takács is Co-presented by Chamber Music Northwest ou re vlue rt o te O l n e re rteul simply breathtaking” The Guardian and Portland’5 Centers for the Arts FOCM.ORG | 503-224-9842 CMNW.ORG | 503-294-6400 JAN 26-29 FEB 21 WINTER FESTIVAL: CONCERTOS MOZART WITH MONICA Celebrating Mozart’s 262nd birthday, Baroque Mozart and Michael Haydn string quartets DEC 20 concertos, and modern concertos performed by Monica Huggett and other PDX VIVALDI’S MAGNIFICAT AND GLORIA CMNW.ORG | 503-294-6400 favorites. -

City Research Online
City Research Online City, University of London Institutional Repository Citation: Lingas, A. ORCID: 0000-0003-0083-3347 (2008). The Divine Liturgy of St John Chrysostom according to the Byzantine Tradition: A New Musical Setting in English. Portland, USA: Cappella Romana. This is the published version of the paper. This version of the publication may differ from the final published version. Permanent repository link: http://openaccess.city.ac.uk/21533/ Link to published version: Copyright and reuse: City Research Online aims to make research outputs of City, University of London available to a wider audience. Copyright and Moral Rights remain with the author(s) and/or copyright holders. URLs from City Research Online may be freely distributed and linked to. City Research Online: http://openaccess.city.ac.uk/ [email protected] CAPPELLA ROMANA THE DIVINE LITURGY OF OUR FATHER AMONG THE SAINTS JOHN CHRYSOSTOM IN ENGLISH IN BYZANTINE CHANT 2 CDS: THE COMPLETE SERVICE the DIVINE LITURGY • CAPPella Romana The Very Revd Archimandrite Meletios (Webber), priest · The Revd Dr John Chryssavgis, deacon DISC ONE: the LITURGY DISC TWO: the LITURGY of the CATECHUMENS 46:55 of the FAITHFUL 60:5 Opening Blessing, Litany of Peace, Cherubic Hymn in Mode Plagal IV, after and Prayer of the First Antiphon 5:4 Petros Peloponnesios (d. 1778) : First Antiphon :4 Opening Section 7:59 3 Short Litany and The Great Entrance : Prayer of the Second Antiphon :6 3 After the Entrance 3:0 4 Second Antiphon 3:00 4 Litany of the Precious Gifts and Kiss of Peace -

20. Yüzyılın İlk Yarısında Modalite
T.C İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı Kompozisyon Sanat Dalı Kompozisyon Programı Yüksek Lisans Tezi 20. YÜZYILIN İLK YARISINDA MODALİTE Dilara Gözde Araz 2501050672 Tez Danışmanı Begüm Çelebioğlu İstanbul Mayıs 2008 ÖZ Bu tezin ana konusu ilkçağlardan beri var olan ve 20. yüzyıl müziğinin özellikle ilk 50 yılının önemli bir kısmını oluşturan ses dizileri mod’ların, tarihsel oluşumunu, coğrafya ve kültürlere göre farklılıklarını ve bu farklılıklardan doğan birikimle yeniden gündeme geldikleri 20. yüzyıl müziğindeki kullanım biçimini incelemektir. Birinci bölüm kapsamlı olarak mod kavramını tasvir ederken, tarih boyunca var olan gelişimini de konu edinmiştir. İkinci bölümde ise mod’ların 20. yüzyıldaki kullanımı müzik akımlarına göre incelenmiş ve örneklenmiştir. Üçüncü ve son bölüm ise 20. Yüzyıl müziğindeki modal eserlere örnekler ve bu örneklerin analizlerini içerir. Bu araştırma projesinde, örnekleme, sınıflandırma ve analiz gibi bilimsel araştırma metodları kullanılmıştır. ABSTRACT The main theme of this research project is modal scales that had existed from the ancient ages until the first 50 years of 20th century. I have examined the historical formation of modal scales, their historical, geographical and cultural differantiation, the aggregation which these differantations brought to 20th century music when the modal scales had been current again. The first part defines the mode concept and the historical development in second part, the usage of modes in 20th century reffering to musical currencies are explained. The third and the last part gives examples of modal pieces from 20th century and their analysis. Scientific methods like examplication, classification, analysis are used in this research project. iii ÖNSÖZ Müzik Tarihi’nin çok büyük bir kısmında kullanılmış temel müzikal malzeme olan mod’lar, bir başka deyişle Antik Yunan uygarlığından günümüze kadar gelen eski ses dizileri, ne yazık ki 17. -

A Journey of the Vocal Iso(N)
A Journey of the Vocal Iso(n) A Journey of the Vocal Iso(n) By Eno Koço A Journey of the Vocal Iso(n) By Eno Koço This book first published 2015 Cambridge Scholars Publishing Lady Stephenson Library, Newcastle upon Tyne, NE6 2PA, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2015 by Eno Koço All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-7067-6 ISBN (13): 978-1-4438-7067-2 This book is dedicated to the memory of my mother, Albanian soprano Tefta Tashko Koço (1910–1947), who has been a mentor, an inspiration, and a guardian angel throughout my whole life and to whom I shall be eternally grateful TABLE OF CONTENTS List of Music Examples: Notation and Audio ........................................... ix List of Illustrations .................................................................................... xi Preface ..................................................................................................... xiii Acknowledgements ................................................................................ xvii Introduction ............................................................................................. xix Part I: Synthesis Chapter One ................................................................................................ -

Makams – Rhythmic Cycles and Usûls
https://doi.org/10.5771/9783956506734, am 26.09.2021, 20:13:18 Open Access - http://www.nomos-elibrary.de/agb https://doi.org/10.5771/9783956506734, am 26.09.2021, 20:13:18 Open Access - http://www.nomos-elibrary.de/agb Post-Byzantine Music Manuscripts as a Source for Oriental Secular Music (15th to Early 19th Century) © 2016 Orient-Institut Istanbul https://doi.org/10.5771/9783956506734, am 26.09.2021, 20:13:18 Open Access - http://www.nomos-elibrary.de/agb ISTANBULER TEXTE UND STUDIEN HERAUSGEGEBEN VOM ORIENT-INSTITUT ISTANBUL BAND 28 © 2016 Orient-Institut Istanbul https://doi.org/10.5771/9783956506734, am 26.09.2021, 20:13:18 Open Access - http://www.nomos-elibrary.de/agb Post-Byzantine Music Manuscripts as a Source for Oriental Secular Music (15th to Early 19th Century) by Kyriakos Kalaitzidis Translation: Kiriaki Koubaroulis and Dimitri Koubaroulis WÜRZBURG 2016 ERGON VERLAG WÜRZBURG IN KOMMISSION © 2016 Orient-Institut Istanbul https://doi.org/10.5771/9783956506734, am 26.09.2021, 20:13:18 Open Access - http://www.nomos-elibrary.de/agb Umschlaggestaltung: Taline Yozgatian Umschlagabbildung: Gritsanis 8, 323 (17th c.): “From here start some songs and murabba’s” Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the Internet at http://dnb.d-nb.de. ISBN 978-3-95650-200-2 ISSN 1863-9461 © 2016 Orient-Institut Istanbul (Max Weber Stiftung) Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. -

Grammenos Karanos), Dormition of the Virgin Mary Greek Orthodox Church, Somerville, MA, March 2016
REV. DR. ROMANOS (GRAMMENOS) KARANOS 76 Gerry Road, Brookline, MA 02467-3138 Telephone: 617-850-1236 E-mail: [email protected] Curriculum Vitae Last updated January 26, 2021 Education National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece School of Philosophy, Department of Musical Studies • Ph.D. in Byzantine Musicology and Psaltic Art (2011) • Dissertation: Τὸ Καλοφωνικὸν Εἱρμολόγιον [The Kalophonic Heirmologion] • Advisors: Gregorios Stathis, Achilleus Chaldaeakes, Demetrios Balageorgos Boston University, Boston, MA Graduate School of Management • Master of Business Administration (2004) Harvard University, Cambridge, MA Harvard-Radcliffe Colleges • Bachelor of Arts cum laude in Government (1997) • Senior Thesis: The Concept of Moderation in the Theories of Plato and Aristotle • Advisor: Petr Lom Greek Orthodox Metropolis of Boston, Boston, MA School of Byzantine Music • Certificate of Byzantine Music with highest distinction (2002) • Studied under Professor Photios Ketsetzis, Archon Protopsaltis of the Greek Orthodox Archdiocese of America. Teaching Experience / Appointments Hellenic College/Holy Cross Greek Orthodox School of Theology, Brookline, MA Assistant Professor of Byzantine Liturgical Music (September 2011 – present) Mathimata, Kratimata, and Deinai Theseis The Kalophonic Heirmologion History of Western Music History of Byzantine Music Directed Study in Byzantine Chant to American Sign Language Directed Study in Byzantine Music Instruction for Beginners Directed Study in Advanced Ecclesiastical Composition in English Service Rubrics Byzantine Music for Clergy Byzantine Music X – Papadike, Old Sticherarion, and Kalophonic Heirmoi CV of Fr. Romanos Karanos Byzantine Music IX – Papadike and Old Sticherarion Byzantine Music VIII – Divine Liturgy Byzantine Music VII – Doxastarion & Slow Heirmologion Byzantine Music VI – Holy Week Byzantine Music V – Prosomoia and Music for Sacraments Byzantine Music IV – Anastasimatarion: Modes II, Pl.