Die Ursprünge Der Nibelungensage 1V2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
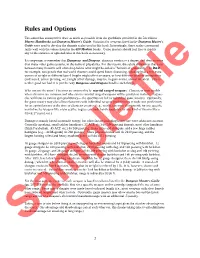
Rules and Options
Rules and Options The author has attempted to draw as much as possible from the guidelines provided in the 5th edition Players Handbooks and Dungeon Master's Guide. Statistics for weapons listed in the Dungeon Master's Guide were used to develop the damage scales used in this book. Interestingly, these scales correspond fairly well with the values listed in the d20 Modern books. Game masters should feel free to modify any of the statistics or optional rules in this book as necessary. It is important to remember that Dungeons and Dragons abstracts combat to a degree, and does so more than many other game systems, in the name of playability. For this reason, the subtle differences that exist between many firearms will often drop below what might be called a "horizon of granularity." In D&D, for example, two pistols that real world shooters could spend hours discussing, debating how a few extra ounces of weight or different barrel lengths might affect accuracy, or how different kinds of ammunition (soft-nosed, armor-piercing, etc.) might affect damage, may be, in game terms, almost identical. This is neither good nor bad; it is just the way Dungeons and Dragons handles such things. Who can use firearms? Firearms are assumed to be martial ranged weapons. Characters from worlds where firearms are common and who can use martial ranged weapons will be proficient in them. Anyone else will have to train to gain proficiency— the specifics are left to individual game masters. Optionally, the game master may also allow characters with individual weapon proficiencies to trade one proficiency for an equivalent one at the time of character creation (e.g., monks can trade shortswords for one specific martial melee weapon like a war scythe, rogues can trade hand crossbows for one kind of firearm like a Glock 17 pistol, etc.). -

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM CELURIT ( Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan Nomor: 364/Pid.Sus/2018/PN.Bkl )
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM CELURIT ( Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan Nomor: 364/Pid.Sus/2018/PN.Bkl ) SKRIPSI OLEH : HUSNUL HOTIMAH NIM. C93216128 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam Surabaya 2020 PERNYATAAN KEASLIAN Yang bertanda tangan di bawah ini Nama : Husnul Hotimah NIM : C93216128 Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Kepemilikan Senjata Tajam Celurit(Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan Nomor: 364/Pid.Sus/2018/PN.Bkl) Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Surabaya, 10 Maret 2020 Saya yang menyatakan Husnul Hotimah NIM. C93216128 i PERSETUJUAN PEMBIMBING Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM CELURIT (Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bangkalan Nomor: 364/Pid.Sus/2018/PN.Bkl) “ yang ditulis oleh Husnul Hotimah NIM. C93216128 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan. Surabaya, 10 Maret 2020 Pembimbing Skripsi, M.Romdlon SH, M.Hum NIP. 196212291031003 ii PENGESAHAN Skripsi yang ditulis oleh Husnul Hotimah NIM. C93216128 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari jumat 6 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum. Majelis Munaqosah Skripsi Penguji I, M.Romdlon S.H M Hum NIP. 196212291031003 Penguji III, A.Kemal Reza, S.Ag., M.A NIP. -

Perencanaan Tata Guna Lahan Desa Balaroa Pewunu
Perencanaan Tata Guna Lahan Desa Balaroa Pewunu Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Desa Balaroa Pewunu merupakan desa baru yang memisahkan diri dari desa induk Pewunu pada tahun 2012, berdirinya desa ditetapkan pada 20 november 2012 melaui Perda Kabupaten Sigi Nomor 41 tahun 2012 tentang Pemekaran Desa Balaroa Pewunu Kecamatan Dolo Barat Sigi Sulawesi Tengah. Secara geografis, desa Balaroa Pewunu berada di sebelah barat ibu kota kabupaten Sigi dengan melalui jalan poros Palu-Kulawi, untuk kedudukan atronomisnya terdapat pada titik koordinat S 1 °01’37" Lintang Selatan dan E 119°51'37 Bujur Timur. Luas desa Balaroa Pewunu (indikatif) 217,57 Ha berdasarkan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh warga pada tahun 2019 dengan topografi atau rupa bumi umumnya dalam bentuk daratan yang kepadatan penduduk mencapai 374 jiwa/Km² pada tahun 2019. Berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun 2019 (IDM)1 yang dikeluarkan oleh kementrian desa dengan nilai total 0,5987 maka desa Balaroa Pewunu dapat dikategorikan sebagai desa tertinggal atau bisa disebut sebagai desa pra-madya, Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Seperti pada umumnya desa di Dolo Barat, komoditas tanaman padi sawah selain sebagai pemenuhan kebutuhan pangan juga merupakan tumpuhan petani dalam menambah pendapatan keluarga, varitas padi sawah (irigasi) yang dibudidayakan petani antara lain 1http://idm.kemendesa.go.id/idm_data?id_prov=72&id_kabupaten=7210&id_kecamatan=721011&id_desa=7210112011&tahu n=2019, Rumusan IDM berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 2 tahun 2016 Tentang Indek Desa Membangun. -
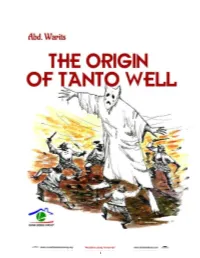
The Origin of Tanto Well
1 THE ORIGIN OF TANTO WELL Abdul Warits The arid condition of Madura island barely provides water. A long time ago, wells were dug hundreds of metres for water in the valley and mountainside, but only few spouted out water. Some holes were open without any water. In fact, the wells that had water would run dry when the drought came. In a small village in Maddupote—an area between Batang-Batang and Batuputih—there lived a husband and wife, Mattali and Sunima. They led a loving life despite not having any children in their old age. They had been married for twenty five years, but no child was born to bring more joy and completeness in their life. Sunima tirelessly prayed and fasted to ask God for a child. So did Mattali. He even willingly went to some shamans for help so that they would have a baby soon. He had done all the advice, from the simplest to the most difficult one such as sleeping out in Rongkorong Hill forty days, but with no success. Mattali and Sunima had spent their wealth to visit shamans and pay for the ritual expenses in order to have a child. Moreover, their wealth was all gone because they had fines to pay to a cruel and stubborn king. The king was widely known with the name King Dulkemmek Banakeron who ruled Maddupote. Maddupote was actually a rebellious kingdom whose illegal authority was still under the leadership of Panembahan Joharsari, the King of Sumenep. King Dulkemmek gave an order that every childless family must pay 400 cent fine each month. -

PEDOMAN GURU WARNA Untuk Siswa Kelas V SD/MI
BERDASARKAN KURIKULUM 2013 PEDOMAN GURU WARNA Untuk Siswa Kelas V SD/MI 5 KATA PENGANTAR Puji syukur atas rahmat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan untuk menyelesaikan Pedoman Guru ini yang merupakan salah satu bagian penting dalam keterterapan modul komik Tematik Berbasis Multiple Intelegensi. Modul ini berisikan petunjuk atau cara pemanfaatan untuk siswa kelas V semester 2. Pedoman ini dimaksudkan untuk memandu guru kelas V membelajarkan siswa pada tema Lingkungan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, dukungan, serta motivasi atas pembuatan pedoman guru. Semoga pedoman guru ini bermanfaat bagi guru sekolah dasar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa pedoman guru ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dari pembaca terutama pada guru demi penyempurnaan pedoman ini. Malang, Agustus 2017 Penulis ii PEDOMAN GURU Pedoman guru ini disusun agar guru mendapatkan mendapat gambaran yang jelas dan rinci dalam melaksanakan setiap pembelajaran. Pedoman guru ini berisi: 1. jaringan tema yang memberi gambaran kepada guru tentang suatu tema yang melingkupi beberapa kompetensi dasar (KD) dan indikator dari berbagai mata pelajaran, 2. kegiatan pembelajaran tematik untuk menggambarkan kegiatan pembelajaranyang menyatu. 3. pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap positif, penguasaan konsep, keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, kreaktvitas dan pribadi reflektif, 4. kegiatan belajar yang disajikan -

Bab Ii Studi Pustaka
BAB II STUDI PUSTAKA 2.1. Penelitian Terdahulu Demi kelancaran penelitian ini, maka dicarilah refrensi penelitian terdahulu untuk mendapatkan informasi-informasi yang penting. Dan beberapa dari penelitian terdahulu tersebut dapat digunakan sebagai inspiratif. 2.1.1 Penelitian Victorianto Aditya Johan dan Adi Chandra Syarif. (2015) Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Atma Jaya makassar pada tahun 2015 dengan judul penerapan augmented reality sebagai media pembelajaran budaya rumah adat Sulawesi selatan. Aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia dan membantu masyarakat Indonesia mengatasi kendala dalam mempelajari budaya Indonesia. Gambar 2.1 Tampilan Objek 3D Rumah adat Balla Lompoa 2.1.2 Penelitian Endah Sudarmilah (2015) Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2015 yang berjudul augmented reality edugame senjata tradisional Indonesia. Aplikasi ini berfokus pada adventure game untuk mencari sebuah senjata tradisional dari sebuah pulau yang telah dipilih. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan materi tentang senjata adat Indonesia yang dapat menarik perhatian siswa agar siswa lebih mudah mengingat dan memahami senjata adat Indonesia. Kelebihan aplikasi ini mempunyai informasi tentang senjata tradisional didalamnya, namun pada aplikasi tidak terdapat menu kuis. 5 6 Gambar 2.2 Halaman Augmented reality 2.1.3 Penelitian Meylisa Rasjid, Rizal Sengkey dan Stanley Karouw (2016) Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa universitas Sam Ratulangi yang berjudul rancang bangun aplikasi alat musik kulintang menggunakan augmented reality berbasis android. Aplikasi ini dibuat agar dapat menumbuhkan keinginan atau ketertarikan pada alat musik tradisional kulintang sebagai warisan budaya minahasa. Aplikasi ini dibuat menggunakan software unity 3D, blender dan Vuforia SDK. Gambar 2.3 Tampilan kulintang melodi 3D 2.2 Budaya Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. -

Editors Issue 4
ISSUE 4 EDITORS Summer 2017 Paul Bowman ISSN 2057-5696 Benjamin N. Judkins MARTIAL ARTS STUDIES IS MARTIAL ARTS FIGHTING WORDS: FOUR NEW DOCUMENT FINDS STUDIES TRIVIAL? REIGNITE OLD DEBATES IN TAIJIQUAN HISTORIOGRAPHY Bowman & JUDKINS DOUGLAS WILE VIRTUALLY LEGITIMATE: USING DISEMBODIED MEDIA TO POSITION ONESELF IN AN EMBODIED COMMUNITY LAUREN MILLER GRIFFITH TRANS-REGIONAL CONTINUITIES OF FIGHTING TECHNIQUES IN MARTIAL RITUAL INITIATIONS OF THE MALAY WORLD GABRIEL FACAL FROM REALISM TO REPRESENTATIVENESS: CHANGING TERMINOLOGY TO INVESTIGATE EFFECTIVENESS IN SELF-DEFENCE STALLER, ZAISER & Körner ABOUT THE JOURNAL Martial Arts Studies is an open access journal, which means that all content is available without charge to the user or his/her institution. You are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from either the publisher or the author. The journal is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. C b n d Original copyright remains with the contributing author and a citation should be made when the article is quoted, used or referred to in another work. Martial Arts Studies is an imprint of Cardiff University Press, an innovative open-access publisher of academic research, where ‘open-access’ means free for both readers and writers. cardiffuniversitypress.org Journal DOI 10.18573/ISSN.2057-5696 Issue DOI 10.18573/n.2017.10182 Accepted for publication 30 June 2017 Martial Arts Studies Journal design by Hugh Griffiths MARTIAL issue 4 ARTS STUDIES SUMMER 2017 1 Editorial Is Martial Arts Studies Trivial? Paul Bowman and Benjamin N. -

Trans-Regional Continuities of Fighting Techniques in Martial Ritual Initiations of the Malay World Gabriel Facal
After obtaining a Master of Social Anthropology at the École des CONTRIBUTOR Hautes Études en Sciences Sociales in Paris (2009), Gabriel Facal completed his doctoral thesis (2012) at Aix-Marseille University as a member of the Institut de recherches Asiatiques (IrAsia, Marseille) under the supervision of Professor Jean-Marc de Grave. He carried out a dozen fieldwork expeditions for a total duration of thirty-seven months in Southeast Asia. His research initially focused on ritual initiation groups and their links with religious organizations and political institutions in the West of Java and the South of Sumatra (Indonesia). Since 2013, he has completed several additional trips in different regions of Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam to establish a comparative perspective. TRANS-REGIONAL CONTINUITIES OF FIGHTING TECHNIQUES IN MARTIAL RITUAL INITIATIONS OF THE MALAY WORLD GABRIEL FACAL DOI ABSTRACT 10.18573/j.2017.10186 This article explores continuities in fighting techniques of martial ritual initiations found across the Malay world (Dunia Melayu). Comparison with other neighboring Asian and Southeast Asian regions shows that these techniques follow patterns and principles that can be considered as ‘properly KEYWORDs Malay’. I argue that ‘Malayness’ is socially and politically consolidated through these initiations, not least because Techniques, initiation, ritual, martial the techniques mobilize local cosmologies and notions of practice, purity, efficacy. the ‘person’. These cosmologies and notions are mainly articulated through conceptions of space and time, an aspect that is underlined by the transmission processes themselves. Transmission steps show parallels with life processes such as CITATION maturation, growing and purification. The correspondences between these processes are also expressed through a specific Facal, Gabriel. -

Daftar Kode Barang
DAFTAR KODE BARANG MILIK DAERAH 01.01.01.01.01 Kampung 01.01.01.01.02 Tanah Kampung Lain-lain 01.01.01.02.01 Emplasmen 01.01.01.02.02 Emlasemen Lainnya 01.01.01.03.01 Islam 01.01.01.03.02 Kristen 01.01.01.03.03 Cina 01.01.01.03.04 Hindu 01.01.01.03.05 Budha 01.01.01.03.06 Makam Pahlawan 01.01.01.03.07 Tempat Benda Bersejarah 01.01.01.03.08 Makam Umum/Kuburan Umum 01.01.01.03.09 Kuburan Lainnya 01.01.02.01.01 Padi 01.01.02.01.02 Palawija 01.01.02.01.03 Sawah Ditanami Tebu 01.01.02.01.04 Sawah Ditanami Sayuran 01.01.02.01.05 Sawah Ditanami Tembakau 01.01.02.01.06 Sawah Ditanami Roselia 01.01.02.01.07 Sawah Lain-lain 01.01.02.02.01 Buah-buahan 01.01.02.02.02 Tembakau 01.01.02.02.03 Jagung 01.01.02.02.04 Ketela Pohon 01.01.02.02.05 Kacang Tanah 01.01.02.02.06 Kacang Hijau 01.01.02.02.07 Kedelai 01.01.02.02.08 Ubi Jalar 01.01.02.02.09 Kedelai 01.01.02.02.010 Tegalan Lain-lain 01.01.02.03.01 Padi 01.01.02.03.02 Jagung 01.01.02.03.03 Ketela Pohon 01.01.02.03.04 Kacang Tanah 01.01.02.03.05 Kacang Hijau 01.01.02.03.06 Kedelai 01.01.02.03.07 Ubi Jalar 01.01.02.03.08 Keladi 01.01.02.03.09 Bengkuang 01.01.02.03.010 Apel 01.01.02.03.011 Kentang 01.01.02.03.012 Jeruk 01.01.02.03.013 Ladang Lainnya 01.01.03.01.01 Karet 01.01.03.01.02 Kopi 01.01.03.01.03 Kelapa 01.01.03.01.04 Randu 01.01.03.01.05 Lada 01.01.03.01.06 Teh 01.01.03.01.07 Kina 01.01.03.01.08 Coklat 01.01.03.01.09 Kelapa Sawit 01.01.03.01.010 Sereh 01.01.03.01.011 Cengkeh 01.01.03.01.012 Pala 01.01.03.01.013 Sagu 01.01.03.01.014 Jambu Mente 01.01.03.01.015 Tengkawang 01.01.03.01.016 Minyak -

Basic Motions of Pattern Formation (Source: Gell 1998: 78 Fig
Appendix A Basic Motions of Pattern Formation (Source: Gell 1998: 78 Fig. 6.4/I.) 1. REFLECTION 2. TRANSLATION 3. ROTATION 4. GLIDE REFLECTION 271 Appendix B Naqshbandi Silsilah: The Golden Chain (1) Sayyidina Muhammad, salla-lahu’alayhi wa salam (2) Abu Bakr Siddiqi Khalifat-Rasuli-lah (3) Salman al Farsi (4) Qasim Bin Muhammad Bin Abu Bakr as Siddiq (5) Imam Abu Muhammad Ja’far as Sadiq (6) Sultan-ul ‘Arifin Abu Yazid Al Bistami (7) Abu-1 Hassan al Kharaqani (8) Abu ‘Ali Ahmad Bin Muhammad al Farmadi ar Rudhabari (9) Khwaja Abu Yaqoub Yusuf al Hamadani (10) Abu-1 ‘Abbas, Sayyidina Khidr ‘Alayhi-salam (11) Khwaja ‘Ala’u-d Dawlah ‘Abdu-1 Khaliq al Ghujdawani (12) Khwaja ‘Arif ar Riwgarawi (13) Khwaja Mahmoud al Faghnawi (14) Khwaja ‘Azizan ‘Ali ar Rarnitani (15) Khwaja Muhammad Baba as Sammasi (16) Khwaja Sayyid Amir al Kulali (17) Imamu-Tariqati Baha’d Din an Naqshbandi (18) Khwaja ‘Ala’u-Din Attar al Bukhari (19) Khwaja Ya’qoub al Charkhi (20) Hadrat Ishan Khwaja-i Ahrar ‘Baydu-llah (21) Muhammad az Zahid al Bukhari (22) Darvish Muhammad (23) Maulana Alanad Kil Amkanaki as Samarkandi (24) Muhammad al Baqil’i-lah Berang as Simaqi (25) Ahmad al Farouqi Sirhindi Mujaddidu-l Alfi Thani (26) Muhammad Ma’soum Bin Ahmad al Farouqi Sirhindi (27) Sayfu-d Din’ Arif (28) Sayyid Nour Muhammad al Bada’uru (29) Shamsu-d Din Habibu-lah Jan-i Janan (30) Abdu-lah ad Dihlawi (31) Shaykh Khalid Diya’u-Din al Baghdadi (32) Shaykh Isma’il (33) Khas Muhammad 273 274 Appendix B (34) Shaykh Muhammad Effendi Yaraqhi (35) Sayyid Jamalu-din al Ghumuqi al Husayi -

Seni Silat Haqq: a Study in Malay Mysticism
SENI SILAT HAQQ: A STUDY IN MALAY MYSTICISM DOUGLAS STEPHEN FARRER (B.A. (Hons.), M.A.) A THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF SOCIOLOGY NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE 2006 Acknowledgements This research project was sponsored by The Department of Sociology at The National University of Singapore who awarded me a research scholarship, teaching assistant post, and a resident fellowship between 2001 and 2007. Being based in Singapore facilitated several bursts of intensive field work into Malaysia and promoted access to the Singaporean Malay community. Special thanks are due to my principal supervisor, A/P Roxana Waterson, for her patient guidance, amusing anecdotes, and loans of rare books. A/P Farid Alatas and Professor Mutalib Hussin were my second and third supervisors and I thank them for their useful suggestions and comments on my work. A/P Hing Ai Yun gave important early suggestions. A/P Maribeth Erb was a continual source of encouragement and insight. Dr. Todd and Anne Ames extended much needed friendship. The administrative staff, especially Choon Lan, Rajah, and Brenda were a great help. Thanks also to A/P John Miksik and Dr. Kyle Latinis. Professor Jim Fox encouraged my focus upon the Naqshbandi Sufi Order. Dr. Geoffrey Benjamin and Dr. Vivienne Wee provoked stimulating discussions on Malay topics. Dr. Michael Roberts encouraged me to think about silat and death. Dr. Ellis Finkelstein taught me the ethnographic method. This thesis is the outcome of a montage of individually provided information and I must extend my thanks to all the people that have helped me to undertake it. -

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terus Berkembang Dan Terus Meningkat Mengikuti Perkembangan Za
BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Pemanfaatan sumber daya alam terus berkembang dan terus meningkat mengikuti perkembangan zaman yang kian hari semakin kompleks, demikian pula pada dunia teknik, pemanfaatan sumber daya alam sangat dibutuhkan, contohnya seperti pemanfaatan logam, bahan ini sering di pakai pada proses metalurgi untuk pembuatan berbagai macam alat-alat perkakas maupun komponen mesin. Pengembangan berbagai macam bahan logam serta proses pembentukannya menjadi barang berguna, mendorong manusia memasuki dunia teknologi. Dalam proses pembentukan logam ada berbagai cara, antara lain proses pengecoran, proses penempaan, proses ekstrusi, pengeloran dan sebagainya. Penempaan (forging) ialah pemberian bentuk terhadap benda kerja yang terbuat dari logam dan mudah diregangkan dengan pemukulan atau penekanan dengan keadaan pijar. Penempaan termasuk kerajinan tangan yang paling tua didalam pemberian bentuk terhadap logam, penempaan dengan tangan akan tetap memegang peranannya, juga pada masa mendatang, misalnya untuk penempaan barang kesenian seperti contohnya keris badik, golok, celurit dan karambit (Schönmetz et.al, 1985). Pada jurnal Akhmad Syarief yang berjudul analisa kekerasan pisau potong (parang) pada proses penempaan (forging) dan jurnal Beta Hartono yang berjudul cara pembuatan keris, disebutkan bahwa keris terbuat dari baja perkakas, baja strip karbon rendah dan nikel sedangkan parang menggunakan bahan dasar baja pegas. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan percobaan menggunakan baja bekas gergaji (baja HSS) dan stainless steel guna meningkatkan nilai jual, nilai guna dan memberikan nilai seni terhadap barang bekas sebagai bahan dasar pembuatan Senjata Tajam dengan proses penempaan kemudian dilakukan pengujian kekerasan (rockwell) dan pengujian mikrostruktur. Metode pengambilan data dengan menggunakan metode uji kekerasan (rockwell) dan uji mikrostruktur, dengan 1 variasi pelapisan yang memadukan antara baja dengan tumpang 4,6,8 dan stainless steel.