GVV Mittlere Fils - Lautertal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Liste Ambulante Pflegedienste Im Landkreis Göppingen
Ambulante Pflegedienste im Landkreis Göppingen Stand Mai 2021/ Angaben ohne Gewähr Gemeinde Pflegedienst Kontakt Einzugsgebiet Bad Boll Diakoniestation Raum Bad Boll Telefon: Aichelberg, Bad Boll, Dürnau, Gammelshausen, Blumhardtweg 30 07164/2041 Hattenhofen, Zell unter Aichelberg. 73087 Bad Boll www.diakoniestation-badboll.de E-Mail: [email protected] Bad Überkingen Pflegedienst Mirjam Care GmbH & Co. Telefon: Bad Ditzenbach und Teilorte, Bad Überkingen KG 07331/951520 und Teilorte, Deggingen mit Reichenbach, Amtswiese 2 Drackenstein, Geislingen und Teilorte, 73337 Bad Überkingen E-Mail: Gruibingen, Hohenstadt, Kuchen, Mühlhausen, www.mirjam-care.de [email protected] Wiesensteig Böhmenkirch Pflegedienst Mirjam Care Böhmenkirch Telefon: Böhmenkirch und Teilorte, Donzdorf und GmbH 07332/9247203 Teilorte, Geislingen und Teilorte, Lauterstein Buchenstraße 44 89558 Böhmenkirch E-Mail: www.mirjam-care-boehmenkirch.de info@mirjam-care- boehmenkirch.de 1 Gemeinde Pflegedienst Kontakt Einzugsgebiet Deggingen Sozialstation Oberes Filstal Telefon: Bad Ditzenbach und Teilorte, Deggingen mit Am Park 9 07334/8989 Reichenbach, Drackenstein, Gruibingen, 73326 Deggingen Hohenstadt, Mühlhausen, Wiesensteig www.sozialstation-deggingen.de E-Mail: sozialstation-deggingen@t- online.de Donzdorf Sozialstation St. Martinus Telefon: Böhmenkirch und Teilorte, Donzdorf und Hauptstraße 60 07162/912230 Teilorte, Lauterstein 73072 Donzdorf www.sozialstation-donzdorf.de E-Mail: [email protected] Ebersbach Dienste für Menschen gGmbH Telefon: -

Baumaßnahmen RB 16 Zwischen Ulm Und Stuttgart 21
Baumaßnahmen RB 16 zwischen Ulm und Stuttgart 21. bis 25. März 2020 Aufgrund von Bauarbeiten im Abschnitt Geislingen (Steige) – Eislingen (Fils) vom 21.03. 23:00 Uhr – 25.03. 03:00 Uhr wird die Filstalbahn gesperrt. Aus diesem Grund wird es im genannten Zeitraum Änderungen hinsichtlich der Ankunfts- und Abfahrtszeiten zwischen Stuttgart und Ulm geben. Zwischen Geislingen (Steige) und Eislingen (Fils) findet außerdem ein Schienen-Ersatzverkehr statt! Weitere Informationen: https://www.go-ahead-bw.de/unterwegs-mit-go-ahead/fahrplanabweichungen.html Legende: entfällt spätere Lage SEV-Bus NEU SEV-Haltestellen Plochingen Bussteig 1 Reichenbach (Fils) Bahnhofsvorplatz Ebersbach (Fils) Bahnhofsvorplatz Uhingen Bahnhofsstraße Faurndau Stuttgarter Straße Göppingen Bussteig O und P Eislingen (Fils) Hauptstraße (Fils-Brücke) Salach Hauptstr. / Marktplatz Süßen Bussteig F Gingen (Fils) Mühlgasse Kuchen Hauptstr. „Löwen“ / „Heinkel“ Geislingen West Ecke Gutenbergstr. / Rheinlandstr. Geislingen (Steige) Bussteig F Baumaßnahmen RB 16 zwischen Ulm und Stuttgart 21. bis 25. März 2020 Legende: entfällt spätere Lage SEV-Bus NEU SEV-Haltestellen Plochingen Bussteig 1 Reichenbach (Fils) Bahnhofsvorplatz Ebersbach (Fils) Bahnhofsvorplatz Uhingen Bahnhofsstraße Faurndau Stuttgarter Straße Göppingen Bussteig O und P Eislingen (Fils) Hauptstraße (Fils-Brücke) Salach Hauptstr. / Marktplatz Süßen Bussteig F Gingen (Fils) Mühlgasse Kuchen Hauptstr. „Löwen“ / „Heinkel“ Geislingen West Ecke Gutenbergstr. / Rheinlandstr. Geislingen (Steige) Bussteig F Baumaßnahmen RB 16 zwischen Ulm und Stuttgart 21. bis 25. März 2020 Legende entfällt spätere Lage NEU SEV-Bus Go-Ahead Baden-Württemberg www.go-ahead-bw.de Kundenservice: +49 711 400 53444 Baumaßnahmen RB 16 zwischen Ulm und Stuttgart 21. bis 25. März 2020 SEV-Haltestellen Plochingen Bussteig 1 Reichenbach (Fils) Bahnhofsvorplatz Ebersbach (Fils) Bahnhofsvorplatz Uhingen Bahnhofsstraße Faurndau Stuttgarter Straße Göppingen Bussteig O und P Eislingen (Fils) Hauptstraße (Fils-Brücke) Salach Hauptstr. -

Umzüge Und Arbeitslosengeld II
Angemessene Heizkosten: Im Gegensatz zur Bruttokaltmiete sind die Heizkosten nicht wohnortbezogen sondern für den Landkreis Göppingen ein- heitlich. Hierbei ist lediglich nach der Art des Heizmittels zu unterscheiden. Personen Heizöl Gas Pellets im Haushalt 1 67,91 € 63,79 € 51,41 € 2 90,55 € 85,05 € 68,55 € 3 113,19 € 106,31 € 85,69 € 4 135,83 € 127,58 € 102,83 € 5 158,46 € 148,84 € 119,96 € 6 181,10 € 170,10 € 137,10 € 7 203,74 € 191,36 € 154,24 € 8 226,38 € 212,62 € 171,38 € Personen Strom / Wärme- im Fernwärme pumpe Haushalt 1 84,79 € 84,41 € 2 113,05 € 112,55 € 3 141,31 € 140,69 € Umzüge und 4 169,58 € 168,83 € Arbeitslosengeld II 5 197,84 € 196,96 € 6 226,10 € 225,10 € 7 254,36 € 253,24 € Sie möchten umziehen? In dieser Bro- 8 282,62 € 281,38 € schüre erfahren Sie alles Wichtige. Herausgeber CDDCCA Jobcenter Landkreis Göppingen Wichtiger Hinweis: Mörikestr. 15 73033 Göppingen Sollten Sie ein Anliegen zu einem Umzug haben, nehmen Stand: Januar 2021 Sie bitte zuerst Kontakt zu unserer Service-Hotline unter www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/ der 07161/9770-751* (Jobcenter Göppingen) bzw. Goeppingen 07331/9570-66* (Jobcenter Geislingen) auf. Viele Fragen lassen sich so bereits im Vorfeld klären. *Die Telefongebühren richten sich nach Ihrem jeweiligen Anbieter. Landkreis Göppingen Landkreis Göppingen Publication name: Gr01_Flyer Umzug 2021 - 1.0 generated: 2020-11-03T14:31:16+01:00 Was können Sie tun? Miethöchstgrenzen des Mietstufe III: Göppingen (Stadtgebiet) , Eislingen, Süßen, Uhingen Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass Sie vom künftig Landkreises Göppingen für Sie zuständigen Träger eine Zusicherung zu den laufen- Die Miethöchstgrenzen des Landkreises Göppingen setzen Personen Brutto- den Aufwendungen (Gesamtmiete) der neuen Unterkunft sich aus der Summe der angemessenen Bruttokaltmiete (= im kaltmiete einholen. -

Contents Chapter 2
General Family Topics n 42 CONTENTS CHAPTER 2 GENERAL FAMILY TOPICS IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS/EMERGENCY CALLS Page 43 2.1 PEDAGOGICAL TOPICS Page 44 2.2 LEGAL ISSUES Page 50 2.3 MISCELLANEOUS Page 53 IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS/EMERGENCY NUMBERS POLICE 110 FIREFIGHTERS Europewide 112 EMERGENCY DOCTORS/RESCUE SERVICES 112 PEDIATRIC EMERGENCY 0180 3011250 POISON EMERGENCY 0761 19240 PATIENT TRANSPORT SERVICE if mobile phone use the code number 19222 Medical stand-by for emergency* Telephone Other services Telephone Emergency number Baden-Württemberg 116117 Nursing services Emergency surgery – Helfenstein Klinik 07331 23-130 Home help Emergency surgery – Klinik am Eichert 07161 64-4080 Car pool/voluntary companion/taxi Dental emergency surgery finder 0711 7877766 Community-/municipally administration Pharmacy emergency finder 0800 0022833 Directory enquiries (home country) 11833 (free from dues) Police Telephone * On weekends and on free days Eislingen an der Fils 07161 851 – 0 Göppingen 07161 63 – 0 Hospitals Telephone ALB Fils Hospitals – Helfenstein Clinics 07331 23-0 Geislingen an der Steige 07331 9327 – 0 ALB FILS Hospitals – Clinic at the Eichert 07161 64-0 Uhingen 07161 9381 – 0 Hospital CHRISTOPHSBAD 07161 601-0 Own telephone numbers Telephone Office mother Personal medical care Telephone Family doctor Handy mother Dentist Father‘s office Pharmacy Handy father Medical specialist Medical specialist Relatives, Neighbours, Friends Telephone Doctor and therapist search in the internet Countrywide database www.arztsuche-bw.de Countrywide -

Auswirkungsanalyse Zur Geplanten Verlagerung Eines Rewe Lebensmittelmarktes in Der Gemeinde Kuchen
Auswirkungsanalyse zur Verlagerung eines Rewe-Marktes in Kuchen Auswirkungsanalyse zur geplanten Verlagerung eines Rewe Lebensmittelmarktes in der Gemeinde Kuchen Auftraggeber: KIZ GmbH Projektleitung: Dipl.‐Geogr. Gerhard Beck M. Eng. Stadtplanung Arian Zekaj Ludwigsburg, am 23.12.2019 Gesellschaft für Markt‐ und Absatzforschung mbH 1 Auswirkungsanalyse zur Verlagerung eines Rewe-Marktes in Kuchen Urheberrecht Das vorliegende Dokument unterliegt dem Urheberrecht gemäß § 2 Abs. 2 sowie § 31 Abs. 2 des Gesetzes zum Schutze der Urheberrechte. Eine Vervielfältigung, Weitergabe oder (auch auszugs‐ weise) Veröffentlichung ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung der GMA und des Auf‐ traggebers unter Angabe der Quelle zulässig. Gesellschaft für Markt‐ und Absatzforschung mbH Ludwigsburg | Dresden, Hamburg, Köln, München Hohenzollernstraße 14 71638 Ludwigsburg Geschäftsführer: Dr. Stefan Holl Telefon: 07141 / 9360‐0 Telefax: 07141 / 9360‐10 E‐Mail: [email protected] Internet: www.gma.biz 2 Auswirkungsanalyse zur Verlagerung eines Rewe-Marktes in Kuchen Vorbemerkung Im November 2019 erteilte die KIZ GmbH, der GMA, Gesellschaft für Markt‐ und Absatzforschung mbH, Ludwigsburg, den Auftrag zur Erstellung einer Auswirkungsanalyse für die geplante Verla‐ gerung eines Rewe‐Marktes in Kuchen. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die städtebau‐ lichen Auswirkungen des Vorhabens. Für die Bearbeitung der Untersuchung standen der GMA Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes, des Statistischen Landesamtes Baden‐Württemberg sowie des Auftraggebers zur Verfügung. Darüber hinaus wurden im November 2019 eine intensive Standortbesichtigung so‐ wie eine Erhebung der Einzelhandelsbetriebe im Einzugsgebiet und im näheren Umland vorge‐ nommen. Die vorliegende Untersuchung dient der Entscheidungsvorbereitung und ‐findung für kommunal‐ politische und bauplanungsrechtliche Entscheidungen der Gemeinde Kuchen. Alle Informationen im vorliegenden Dokument sind sorgfältig recherchiert; der Bericht wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. -

Chronik-TSG 1 02.04.2007 10:24 Uhr Seite 1
Chronik-TSG_1 02.04.2007 10:24 Uhr Seite 1 Chronik der Turn- und Sportgemeinde Salach e.V. 17 Chronik-TSG_1 02.04.2007 10:24 Uhr Seite 2 Die ersten Seiten des Gründungsprotokolls von 1882 18 Chronik-TSG_1 02.04.2007 10:24 Uhr Seite 3 19 Chronik-TSG_1 02.04.2007 10:24 Uhr Seite 4 20 Chronik-TSG_1 02.04.2007 10:24 Uhr Seite 5 21 Chronik-TSG_1 02.04.2007 10:24 Uhr Seite 6 Vereinsgeschichte der TSG Salach 1882 Gründung des Vereins 1888 Gauturnfest in Eislingen 1890 Fahnenweihe 1892 10-jähriges Stiftungsfest 1894 Erstes Gauturnfest in Salach 1901 Gründung des Athletenclubs Salach 1905 Eigene Fahne für Zöglinge 1907 25-jähriges Vereinsfest 1909 Fahnenweihe des Athletenclubs 1910 Bezirksfest im Filstal - Gründung des 1.FC Salach 1911 Eintrag ins Vereinsregister Bau der Turnhalle 1912 Einweihung der Turnhalle Erstes Kinderfest in Salach Leichtathletik-Kreisfest 1913 Karl Schwalb gewann die Süddeutsche Meisterschaft im 400-m-Lauf 1919 Zusammenschluss des Turnvereins Salach, des Athletenclubs und des 1910 gegründeten Fußballclubs unter dem Namen Verein für Leibesübungen (VfL). 1922 Die Turner kündigten den Zusammenschluss auf und nannten sich wieder Turnverein Salach 1923 Aufstieg der Fußballer in die A-Klasse 1924 Gründung der Damenriege 1926 Gründung einer Boxerriege und einer Schneeschuhabteilung 1928 Gründung der Handballmannschaft 1931 Karl Burkhardt wurde Deutscher Meister im 800-m-Lauf und 2. Sieger über 1500 m sowie Württ. Meister im Gewichtwerfen und im 800-m-Lauf. 1932 50-jähriges goldenes Vereinsjubiläum 1933 Konrad Bader wurde Württ. Meister im Hochsprung 1937 Zusammenschluss der Salacher Sportvereine zur Turn- und Sportgemeinde Salach 1939 Neue Satzung eingetragen im Vereinsregister 1946 Wiederaufnahme des Sportbetriebes nach Freigabe durch die Besatzungsmacht 1947 Gründung der Rundgewichtsriege 1948 Gründung der Schachabteilung 22 Chronik-TSG_1 02.04.2007 10:25 Uhr Seite 7 Vereinsgeschichte der TSG Salach 1949 1. -
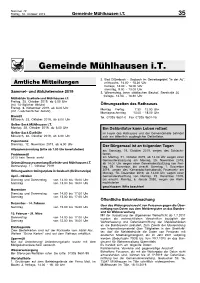
Oberer-Fils-Bote KW42 Internet.Pdf
Nummer 42 Freitag, 18. Oktober 2019 Gemeinde Mühlhausen i.T. 35 Gemeinde Mühlhausen i.T. 2. Bad Ditzenbach - Gosbach im Gewerbegebiet "In der Au", Amtliche Mitteilungen mittwochs, 16.00 - 18.30 Uhr freitags, 13.00 - 18.00 Uhr samstag, 8.00 - 13.00 Uhr Sammel- und Abfuhrtermine 2019 3. Wiesensteig, beim städtischen Bauhof, Seestraße 26 freitags, 12.30. - 16.30 Uhr Müllabfuhr Eselhöfe und Mühlhausen i.T. Freitag, 25. Oktober 2019, ab 6.00 Uhr (mit 14-täglicher Abfuhr) Öffnungszeiten des Rathauses Freitag, 8. November 2019, ab 6.00 Uhr Montag - Freitag 7.30 - 12.00 Uhr (mit 4-wöchentlicher Abfuhr) Montagnachmittag 14.00 - 18.00 Uhr Biomüll Tel. 07335 9601-0 Fax 07335 9601-25 Mittwoch, 23. Oktober 2019, ab 6.00 Uhr Gelber Sack Mühlhausen i.T. Montag, 28. Oktober 2019, ab 6.00 Uhr Ein Defibrillator kann Leben retten! Gelber Sack Eselhöfe Im Foyer des Rathauses und der Gemeindehalle befindet Mittwoch, 30. Oktober 2019, ab 6.00 Uhr sich ein öffentlich zugänglicher Defibrillator. Papiertonne Dienstag, 12. November 2019, ab 6.00 Uhr Der Bürgersaal ist an folgenden Tagen Altpapiersammlung (bitte ab 7.00 Uhr bereitstellen) am Samstag, 19. Oktober 2019, wegen des Schlacht- Problemmüll festes 2019 kein Termin mehr! am Montag, 21. Oktober 2019, ab 14.00 Uhr wegen einer Gemeinderatssitzung am Montag, 25. November 2019, Grünmüllmassesammlung Eselhöfe und Mühlhausen i.T. ab 14.00 Uhr wegen einer Gemeinderatssitzung von Frei- Donnerstag, 17. Oktober 2019 tag, 29. November, bis einschl. Sonntag, 1. Dezember Öffnungszeiten Grüngutplatz in Gosbach (Krähensteige) 2019, wegen des Kameradschaftsabends Feuerwehr am Montag, 16. Dezember 2019, ab 14.00 Uhr wegen einer April - Oktober Gemeinderatssitzung von Montag, 23. -

Betreutes Wohnen Im Landkreis Göppingen
Betreutes Wohnen im Landkreis Göppingen Stand April 2020/ Angaben ohne Gewähr An einem Pflegeheim angegliederte Wohnanlagen Gemeinde Wohnanlage Kontakt Beschreibung Albershausen Evangelische Heimstiftung Telefon: insg. 11 Wohnungen "Haus im Wiesengrund" 07161/15659-0 2- und 1-Zi-Wohnungen Uhinger Straße 10/1 Wohnfläche zw. 42 und 67qm 73095 Albershausen E-Mail: Hausnotruf, Dachterrasse www.ev-heimstiftung.de haus-im-wiesengrund@ev- zusätzliche Angebote: Mittagstisch, heimstiftung.de hauswirtschaftl. Service und kulturelle Veranstaltungen Ebersbach Wohnstift Ebersbach Telefon: insg. 28 Wohnungen Büchenbronnerstraße 55-57 07163/102-0 Wohnungen aufgeteilt in 7 Häuser 73061 Ebersbach/Fils Mittagstisch www.udfm.de E-Mail: Veranstaltungen des Pflegeheims [email protected] Geislingen Seniorenwohnanlage Telefon: Insg. 24 Wohnungen "Bronnenwiesen" Altenstadt 07171/92757-53 Bronnenwiesen 14 und 18 73312 Geislingen E-Mail: www.siedlungswerk.de [email protected] 1 Gemeinde Wohnanlage Kontakt Beschreibung Geislingen Seniorenwohnanlage Telefon: ins. 37 Wohnungen "Kaisheimer Hof" Geislingen 07171/92757-0 oder -53 Schillerstraße 6 73312 Geislingen E-Mail: www.siedlungswerk.de [email protected] Geislingen DRK-Seniorenzentrum Geislingen Telefon: insg. 14 Wohnungen Liebknecht Straße 23 07161/6739-13 2,5- 3,5 Zi-Wohnungen 73312 Geislingen Wohnfläche zw. 54 und 81 qm www.seniorenzentrum-geislingen.de E-Mail: a.sparhuber@drk- goeppingen.de Göppingen Wohnen für Senioren Telefon: insg. 50 Wohnungen mit Einbauküche Wilhelmshilfe e.V. 07161/6726-1889 2- und 3-Zi-Wohnungen Hohenstaufenstraße 2/1 und Wohnfläche zw. 44-75 qm Poststraße 3 E-Mail: Zwei Seniorenappartments mit ca. 32 qm 73033 Göppingen [email protected] Wohnfläche www.wilhelmshilfe.de im Stadtzentrum, Bushaltestelle 2 Gemeinde Wohnanlage Kontakt Beschreibung Göppingen- Wohnen für Senioren Telefon: insg. -

Liste Der Ortsvorsteher Im Landkreis Göppingen
Liste der Ortsvorsteher im Landkreis Göppingen Erstellt von: Oliver Knur, Ebersbach an der Fils–Weiler ob der Fils, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Ortsvorsteher (Stand Oktober 2020) Böhmenkirch Teilort Name Anschrift und Telefon Schnittlingen Herr 89558 Böhmenkirch-Schnittlingen Johannes Kaiser Sonnenstraße 2 Tel.: 07332/4854 Steinenkirch Herr 89558 Böhmenkirch-Steinenkirch Günter Mayer Ravensteiner Weg Tel.: 07332/922353 Treffelhausen Herr 89558 Böhmenkirch-Treffelhausen Marco Kühn Waldstraße 4 Tel.: 07332/924370 Deggingen Teilort Name Anschrift und Telefon Reichenbach im Frau 73326 Deggingen-Reichenbach im Täle Täle Klothilde Maier-Brandt Birkenweg 3 Tel.: 07334/3140 Donzdorf Teilort Name Anschrift und Telefon Reichenbach unter Herr 73072 Donzdorf-Reichenbach unter Rechberg Dietmar Rieger Rechberg Am Mannriedshof 1 Tel.: 0176/41358680 Winzingen Herr 73072 Donzdorf-Winzingen Benjamin Heilig Körner straße 3 Tel.: 07162/946852 Ebersbach an der Fils Teilort Name Anschrift und Telefon Bünzwangen Frau 73061 Ebersbach an der Fils-Bünzwangen Dagmar Reyer Alemannenstraße 11 Tel.: 07163/52571 Roßwälden Herr 73061 Ebersbach an der Fils-Roßwälden Klaus Herrmann Quellweg 17 Tel.: 07163/6772 Weiler ob der Fils Herr 73061 Ebersbach an der Fils-Weiler ob der Oliver Knur Fils Weilerstr. 30/1 Tel.: 07163/165666 Geislingen an der Steige Teilort Name Anschrift und Telefon Aufhausen Herr 73312 Geislingen an der Steige-Aufhausen Helmut Wörz Blessgasse 5 Tel.: 07334/9233299 Eybach Herr 73312 Geislingen an der Steige-Eybach Arno Braunschmid Rösgasse -

Kra GP Findbuch
INVENTARE DES KREISARCHIVS GÖPPINGEN Bestand Oberamt/Landkreis Göppingen I Kreisarchiv Göppingen Bestand Landratsamt Hauptregistratur C 6 Bauen und Wohnungswesen (1863-1980) II Inhaltsverzeichnis I Allgemeine Bauangelegenheiten, Bauverwaltung I 1Bauwirtschaft 1 I 2 Kreisbauamt 2 I 3 Hochbauamt 3 II Raumordnung, Landesplanung, Städtebau II 1 Raumordnung 4 II 2 Städtebau 23 II 3 Sicherung der Bauleitplanung, Enteignung 26 II 4 Umlegung, Grenzregelung 32 II 5 Grundstückswertermittlung 35 III Bauordnungsrecht, Baugenehmigung III 1 Bauordnungsrecht 36 III 2 Baugenehmigung 45 IV Vermessungswesen IV 1 Vermessungsangelegenheiten 56 V Wohnungs- und Siedlungswesen V 1 Allgemeines über den Wohnungsbau 64 V 2 Wohnungsbauförderung durch Bund, Land und Kreis 67 V 3 Wohnungsbauförderung durch die Gemeinde 68 V 4 Gemeinnützige Bauträger und andere Wohnungsbauunternehmen 73 V 5 Siedlungs- und Kleingartenrecht 73 V 6 Wohnraumbewirtschaftung, Wohnungsaufsicht 73 III V 7 Mietrecht, Mieterschutz 73 VI Straßen, Wege, Brücken VI 1 Bauhof, Fuhrpark 73 VI 2 Allgemeine und gemeinsame Strassenangelegenheiten 73 VI 3 Bundesfernstraßen 73 VI 4 Landes- und Kreisstrassen 73 VI 5 Gemeindestrassen 73 VI 6 Brücken, Stege, Über- und Unterführungen 73 VI 7 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 73 VII Wasserbau, Gewässerschutz VII 1 Wasserrecht 73 VII 2 Bau und Unterhalt öffentlicher Gewässer 73 VII3 Benutzung öffentlicher Gewässer, Gewässerschutz 73 Ortsindex 73 Personenindex 73 Zeitungsindex 73 IV I 1 Bauwirtschaft I 1 Bauwirtschaft C 6 - 1 1945 Wiedergründung des Lehrstuhls für Städtebau und Siedlungswesen an der Technischen Hochschule Stuttgart, 1 Fasz. 600.1 (3001/6) C 6 - 2 1948 - 1967 Architekten, Allgemeines, 1 Büschel 600.3 (3001/5) C 6 - 3 1942, 1943 Nachwuchsmangel an technischen Dienstkräften im gemeindlichen Dienst, 1 Fasz. -

1. Nachbarschaftshilfen in Den Städten Und Gemeinden
1. Nachbarschaftshilfen in den Städten und Gemeinden Hilfsangebot Kontakt Für wen Was Wo Adelberg Telefon: 07166 910110 Für Menschen mit erhöhtem Einkaufen Adelberg Rathaus Adelberg gesundheitlichem Risiko und Apothekengänge Montag, Mittwoch: 8:00 - 12:00 Uhr für ältere Menschen Dienstag: 10:00 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr Donnerstag: 10:00 - 12:00 Uhr und 16:00 - 18:00 Uhr Freitag: 10:00 - 12:00 Uhr E-Mail: [email protected] Aichelberg Telefon: 07164 9199344 Für alle, die im Moment nicht Einkäufe aller Art, weitere Aichelberg Evangelische Jugend in selber einkaufen können Besorgungen nach der Kirchengemeinde Montag - Samstag: 10:00 - 14:00 Uhr Absprache Zell u.A. / Aichelberg Albershausen Telefon: 07161 309310 Für Menschen mit erhöhtem Einkäufe aller Art, weitere Albershausen Gemeinde in gesundheitlichen Risiko und für Besprechungen nach Zusammenarbeit mit den Mo, Di, Do 8:00-12:00 Uhr ältere Menschen Di 15:00-18:00 Uhr Absprache Royal Rangers und Do 14:00-16:00 Uhr weiteren Ehrenamtlichen Fr 8:00-11:30 Uhr Email: [email protected] siehe: www.albershausen.de 1 Hilfsangebot Kontakt Für wen Was Wo Bad Boll Telefon: 07164 9279812 Für Menschen, die aus Einkaufen von Ware aus Bad Boll Bad Boller gesundheitlichen Gründen - dem Bad Boller Dorfladen Dorfladen e.G. am besten zwischen 13:30 - 15:00 Uhr entweder weil sie chronisch (auch frankierte Post kann werktäglich, da Kolleginnen im Laden in der krank sind oder zur mitgenommen werden) übrigen Zeit sehr beschäftigt sind Risikopersonengruppe gehören, nicht aus dem Haus können Bestellungen -

Idylle, Kultur Metropolregion
Auf einer Gesamtlänge von 67 Kilometer führt die Filstalroute von ihrem Der Flusslauf bietet Interessantes, Markantes und manches unerwartete Klein- Die Südroute verläuft auf 24 km in unmittel- Ausgangspunkt am so genannten „Bahnhöfle“, das übrigens nie einen Zug sah, od. Das Motto Idylle – Kultur – Metropolregion weist auf die für viele oft überra- barer Nähe der Fils, wodurch die Flussland- von den Höhen der Schwäbischen Alb bei der Burgruine Reußenstein bequem schenden Facetten des Raumes hin: Von den Tuffterrassen über Wasserfälle im schaft noch intensiver „erfahren“ werden kann. hinab in das Hasental, vorbei am Grauen Stein und weiter in das Obere Filstal. Oberlauf bis hin zu bedeutenden Zeugnissen der Industrie- und Kulturge- g Hauptwegweiser mit detaillierten Entfernungs- schichte und den jüngsten Entwicklungen moderner Wasserkraftanlagen und angaben und Sonderzielen wie den Ortsmit- Ab dem idyllisch gelegenen Filsursprung (Karstquelle) auf Markung Wiesensteig gewässerökologischer Renaturierungsmaßnahmen. Schritt für Schritt wird der ten und Bahnstationen und eine Vielzahl von folgt der bequeme Radwanderweg auf den verbleibenden 62 km dem Flusslauf Lebensraum Fluss zurückgewonnen und den Menschen und der Fauna wieder Zwischenwegweisern sorgen für eine unkom- bis zu seiner Mündung in den Neckar, dem sog. Hechtkopf, bei Plochingen. zugänglich gemacht. Auch städtebaulich rückt die Fils vermehrt ins Visier: In plizierte Wegführung vor Ort. Markante Orts- Die Tour macht die Veränderung von einer landwirtschaftlichen Kulturlandschaft einigen Städten und Gemeinden, so in Plochingen, Göppingen, Süßen, Eislingen eingangsschilder erleichtern zusätzlich die über die verschiedenen Zwischenstufen der industriellen Prägung bis in den und Ebersbach wurden in den letzten Jahren neue attraktive Zugänge zur Fils Orientierung im Routenverlauf. Kernraum der Metropolregion Stuttgart hinein auf besondere Weise erlebbar.