Ilse Stöbe: Wieder Im Amt
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

When Die Zeit Published Its Review of Decision Before Dawn
At the Front: common traitors in West German war films of the 1950s Article Accepted Version Wölfel, U. (2015) At the Front: common traitors in West German war films of the 1950s. Modern Language Review, 110 (3). pp. 739-758. ISSN 0026-7937 doi: https://doi.org/10.5699/modelangrevi.110.3.0739 Available at http://centaur.reading.ac.uk/40673/ It is advisable to refer to the publisher’s version if you intend to cite from the work. See Guidance on citing . To link to this article DOI: http://dx.doi.org/10.5699/modelangrevi.110.3.0739 Publisher: Modern Humanities Research Association All outputs in CentAUR are protected by Intellectual Property Rights law, including copyright law. Copyright and IPR is retained by the creators or other copyright holders. Terms and conditions for use of this material are defined in the End User Agreement . www.reading.ac.uk/centaur CentAUR Central Archive at the University of Reading Reading’s research outputs online AT THE FRONT: COMMON TRAITORS IN WEST GERMAN WAR FILMS OF THE 1950s Erst im militärischen Geheimnis kommt das Staatsgeheimnis zu sich selbst; da der Krieg als permanenter und totaler Zustand vorausgesetzt wird, läßt sich jeder beliebige Sachverhalt unter militärische Kategorien subsumieren: dem Feind gegenüber hat alles als Geheimnis und jeder Bürger als potentieller Verräter zu gelten. (HANS MAGNUS ENZENSBERGER) Die alten Krieger denken immer an die Kameraden, die gefallen sind, und meinen, ein Deserteur sei einer, der sie verraten hat. (LUDWIG BAUMANN) Introduction Margret Boveri, in the second volume of her treatise on Treason in the 20th Century, notes with respect to German resistance against National Socialism that the line between ethically justified and unethical treason is not easily drawn.1 She cites the case of General Hans Oster, deputy head of the Abwehr under Admiral Canaris. -

United States of America V. Erhard Milch
War Crimes Trials Special List No. 38 Records of Case II United States of America v. Erhard Milch National Archives and Records Service, General Services Administration, Washington, D.C. 1975 Special List No. 38 Nuernberg War Crimes Trials Records of Case II United States of America v. Erhard Milch Compiled by John Mendelsohn National Archives and Records Service General Services Administration Washington: 1975 Library of Congress Cataloging in Publication Data United States. National Archives and Records Service. Nuernberg war crimes trial records. (Special list - National Archives and Records Service; no. 38) Includes index. l. War crime trials--N emberg--Milch case,l946-l947. I. Mendelsohn, John, l928- II. Title. III. Series: United States. National Archives and Records Service. Special list; no.38. Law 34l.6'9 75-6l9033 Foreword The General Services Administration, through the National Archives and Records Service, is· responsible for administering the permanently valuable noncurrent records of the Federal Government. These archival holdings, now amounting to more than I million cubic feet, date from the <;lays of the First Continental Congress and consist of the basic records of the legislative, judicial, and executive branches of our Government. The presidential libraries of Herbert Hoover, Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman, Dwight D. Eisenhower, John F. Kennedy, and Lyndon B. Johnson contain the papers of those Presidents and of many of their - associates in office. These research resources document significant events in our Nation's history , but most of them are preserved because of their continuing practical use in the ordinary processes of government, for the protection of private rights, and for the research use of scholars and students. -

Ilse Stöbe (1911 - 1942) Im Widerstand Gegen Das „Dritte Reich“
Ilse Stöbe (1911 - 1942) im Widerstand gegen das „Dritte Reich“. Berlin, den 27. August 2013 (korrigierte Fassung vom 20. September 2013) Dieses Gutachten wurde vom Institut für Zeitgeschichte, München-Berlin, im Auftrag des Auswärtigen Amtes erstellt. Gemäß dem von beiden Seiten am 21. Juni 2012 geschlossenen Vertrag erstreckt sich der Gegenstand dieses Gutachtens auf: 1. Ermittlung und Darstellung aller Handlungen, Tätigkeiten und Leistungen von Frau Ilse Stöbe, die sie als Vertreterin des Widerstandes gegen das „Dritte Reich“ ausweisen. 2. biografische Einzelheiten, die für eine persönliche Verstrickung von Ilse Stöbe in Unrechtstaten sprechen, bzw. biografische Einzelheiten, die dagegen sprechen könnten, dass das Auswärtige Amt künftig Ilse Stöbe in besonderer Weise als Widerständlerin gegen den Nationalsozialismus würdigt und an sie erinnert. Einleitung Ilse Stöbe wurde am 14. Dezember 1942 vom Reichskriegsgericht wegen Landesverrats zum Tode verurteilt und am 22. Dezember 1942, nachdem Hitler persönlich eine Begnadigung abgelehnt hatte, im Gefängnis Plötzensee mit dem Fallbeil hingerichtet. Ilse Stöbe hatte tatsächlich die sowjetische Militäraufklärung mit Informationen beliefert. Ihre sterblichen Reste wurden aller Wahrscheinlichkeit nach zu Forschungszwecken freigegeben, ein Grab existiert nicht. Die nutzbare Forschungsliteratur und Publizistik ist nicht sehr umfänglich und offenbart im Hinblick auf die Person Ilse Stöbes große Lücken. Die vorliegenden Darstellungen sind disparat und widersprechen sich teilweise in den Fakten -

Final Report NATO Research Fellowship Prof. Dr. Holger H
Final Report NATO Research Fellowship Prof. Dr. Holger H. Herwig The University of Calgary Aggression Contained? The Federal Republic of Germany and International Security1 Two years ago, when I first proposed this topic, I had some trepidation about its relevance to current NATO policy. Forty-eight months of work on the topic and the rush of events especially in Central and East Europe since that time have convinced me both of its timeliness and of its relevance. Germany's role in SFOR in Bosnia since 1996, the very positive deployment of the German Army (Bundeswehr) in flood-relief work along the Oder River on the German- Polish border in the summer of 1997, and even the most recent revelations of neo-Nazi activity within the ranks of the Bundeswehr, have served only to whet my appetite for the project. For, I remain convinced that the German armed forces, more than any other, can be understood only in terms of Germany's recent past and the special military culture out of which the Bundeswehr was forged. Introduction The original proposal began with a scenario that had taken place in Paris in 1994. On that 14 July, the day that France annually sets aside as a national holiday to mark its 1789 Revolution, 189 German soldiers of the 294th Tank-Grenadier Battalion along with their twenty- four iron-crossed armoured personnel carriers for the first time since 1940 had marched down the Champs-Elysées in Paris. General Helmut Willmann's men had stepped out not to the tune of "Deutschland, 1 The research for this report was made possible by a NATO Research Fellowship. -

ROEDER, MANFRED 0014.Pdf
CD-996 >- vas vr■-• Er, qr..) f•4I e■11 SECRET ZIC .1It / ▪ W eq, isa 1.a.s CO ROTE KAPELLE Euro aeische S iona at( .et 4-eC-T-1970-- — co cz. OG (The Red Orchestra - European Espionage) by General Judge Dr. Manfred ROEDER Pu lished by Verlag Hans Siep, Hamburg, 1952 36 Pages No Index The a thor of this book was the German Chief Justice and General Pro ecutor at the "Rote Kapelle" trial. After World War U, he was i prisoned in Nuernberg by the Americans from the autumn of l96 until his release at the beginning of 1949. His o mion.s and comments about this espionage case are based on his tudy of the documentary material presented to the court. Was t e SCHULTZE-BOYSEN/HARNACK group simply a German resi tance movement fighting against the Nazi regime? Or was it an spionage network organized by the Soviets and the German Corn unists; did the group exploit the credulity of the German anti- azis while from the start following instructions from Soviet ilitary Intelligence and the Comintern, with the intention of u timately taking over the reins of power in Germany? The a thor upholds the latter hypothesis and gives his reasons for t s conviction: Already in June 1941, when the German- Soviet war st rted, there were lively, coded, short-wave communicatio s aimed at Moscow originating from Berlin, Paris, Brussels and msterdarn. Further transmissions were recorded from Switzerl nd and the south of France. It was obvious from the similarity of he codes used that the traffic was originating from a centrally di ected network in the service of the USSR. -

Roeder, Manfred 0015
, FOR OFFICIIAL USE ONLY CE TL INTELLIGENCE AGENCY \-4EPORT NO. a) 44-18 INFORMATION FROM FOREIGN D CUMENTS OR RADIO BROADCASTS CD NO. I S-180 COUNTRY German Feder Republic DATE OF INFORMATION 1952 SUBJECT Political - sistance, espionage HOW DATE DIST. c;.. V E C. 19514 PUBLISHED Book WHERE PUBLISHED Hamburg NO. OF PAGES 31 DATE PUBLISHED 1952 SUPPLEMENT TO LANGUAGE German. REPORT NO. THIS IS UNEVALUATED INFORMATION - ,OURCE Die Rote Ka e Hamburg, 52 pp.7-36 • ••. TicIL RED BAND Dr M. Roeder DECL ASSIFIED AND R ELEASED BY CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY SOURCES METHODS EXEMPT laNaM NAZI WAR CRIMESDISCLOCIURE DATE 2004 2006 PLEASE NOTE THIS IS AN UNEDITED TRANSLATION DISSEMINATED FOR THE IN ORMATION or THE INTELLIGENCE ADVI- SORY COMMIT EE AGENCIES ONLY. IF FURTHER DIS- SEMINATIO S NECESSARY, THIS COVER SHEET MUST BE REMOVED NO CIA MUST NOT BE IDENTIFIED AS THE SOURCE. FOR OFFICIAL USE ONLY Diotoba-1 TE NAVY NSR8 DISTRIbUTION' iY AIR FBI co 40 18 WARNING Laws relating to copyright, libel, slander and communications require that tbe dissemination of part of thid text be limited to "Official Use Only." Exception can be granted only by the issuing agency . Users are warned that noncompliance may sub- ject violators to personal liability. THE RED BAND Die Rote Kapelle [The ed Band], Judge Advocate Gen. Hamburg, 1952, Pages 7 36 Dr. M. Roeder Civilization and technology have created new possibilities and forms of development in all fie ds of human endeavor. Behind us lies a war whose Li- nal decision is indisp table. How true are Clausewitz theories on war even today. -

The Barnes Review a JOURNAL of NATIONALIST THOUGHT & HISTORY
Bringing history into accord with the facts in the tradition of Dr. Harry Elmer Barnes The Barnes Review A JOURNAL OF NATIONALIST THOUGHT & HISTORY VOLUME XII NUMBER 3 MAY/JUNE 2006 www.barnesreview.org JJiimmmmyy DDoooolliittttllee TThhiiss iissssuuee TTBBRR ttaakkeess aa ffrreesshh llooookk aatt tthhee lliiffee ooff aa ttrruuee AAmmeerriiccaann hheerroo aanndd tthhee rraaiidd tthhaatt cchhaannggeedd tthhee ccoouurrssee ooff WWoorrlldd WWaarr IIII.. TTBBRR IInntteerrvviieewwss MMaannffrreedd RRooeeddeerr JJuusstt rreelleeaasseedd ffrroomm pprriissoonn yyeett aaggaaiinn,, TTBBRR ssiittss ddoowwnn wwiitthh GGeerrmmaannyy’’ss mmoosstt cceelleebbrraatteedd ppoolliittiiccaall pprriissoonneerr——7777 aanndd ssttiillll ssttrreeeett ffiigghhttiinngg.. TThhee DDeeaatthh ooff JJaammeess FFoorrrreessttaall JJaammeess FFoorrrreessttaall,, AAmmeerriiccaa’’ss ffiirrsstt sseeccrreettaarryy ooff DDeeffeennssee,, vvooccaallllyy rreessiisstteedd UU..SS.. ssuuppppoorrtt ffoorr tthhee ccrreeaattiioonn ooff IIssrraaeell.. SSoooonn tthheerreeaafftteerr hhee ‘‘jjuummppeedd’’ ffrroomm aa 1166tthh fflloooorr wwiinnddooww.. AALLSSOO:: VViivviiaann BBiirrdd,, GGeerrmmaarr RRuuddoollff,, JJooaaqquuiinn BBoocchhaaccaa,, FFrreeddrriicckk TTööbbeenn,, GGeenn.. LLeeoonn DDeeggrreellllee,, RReeiinnhhoolldd EEllssttnneerr,, AAnnggeellaa MMeerrkkeell,, IInnggrriidd RRiimmllaanndd,, EErriicchh PPrriieebbkkee,, ““RRuussssiiaann”” MMaaffiiaa,, MMiicchhaaeell CCoolllliinnss PPiippeerr,, IIssrraaeelliitteess,, mmoorree.. 12 Bringing History Into Accord With the Facts in the -
Die Kommunistin Im Auswärtigen Amt. Ilse Stöbe, Kuririn Der Rote
1 DEUTSCHLANDFUNK Redaktion Hintergrund Kultur / Hörspiel Redaktion: Ulrike Bajohr Dossier/Produktion 7./8. Mai ab 8.40 in 8/1 Die Kommunistin im Auswärtigen Amt. Ilse Stöbe, Kurierin der Roten Armee von Sabine Kebir Musik: Schubert/Liszt, CD: Piano Songs, Interpr. Silke Avenhaus, BR Klassik, Arch. 6500857, LC 15080 CD: Schubert Lieder, Gesang D. Fischer-Dieskau, Arch. 6060483, EMI, LC 6646 Urheberrechtlicher Hinweis Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf vom Empfänger ausschließlich zu rein privaten Zwecken genutzt werden. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Nutzung, die über den in §§ 44a bis 63a Urheberrechtsgesetz geregelten Umfang hinausgeht, ist unzulässig. © Sendung am 17. Mai 2013 1 2 01 O-Ton Martin Kröger Die Ehrentafel, die sich im Auswärtigen Amt befindet und an die Diplomaten erinnert, die im Widerstand gegen die Nazis ihr Leben gelassen haben, die hat ganz sicher eine Leerstelle und das ist die von Ilse Stöbe. Das Auswärtige Amt lässt beforschen das Leben von Ilse Stöbe mit dem Ziel, sehr viel genauer über sie Bescheid zu wissen, um im Anschluss daran zu entscheiden, ob Ilse Stöbe nicht doch auf diese Tafel gehört. Ansage: Die Kommunistin im Auswärtigen Amt. Ilse Stöbe, Kurierin der Roten Armee Eine Feature von Sabine Kebir 02 O-Ton Martin Kröger Ilse Stöbe ist vor allem deshalb nicht auf der Tafel, weil sie als Verräterin gilt, weil sie eine Kommunistin war, weil sie spioniert hat für die Rote Armee. Sprecherin: Dr. Martin Kröger, Historiker und Archivar im Auswärtigen Amt. Wenn Sie mich nach meiner persönlichen Meinung fragen, dann gehört Frau Stöbe selbstverständlich auf diese Tafel. Sprecher: Ilse Stöbe, geboren am 17. -

Johannes Tuchel Normalität Der Integration Oder Ignoranz Der
Fachbereich Politik- und Sozial- wissenschaften Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft Prof. Dr. Johannes Tuchel Forschungsstelle Widerstandsgeschichte Stauffenbergstraße 13-14 D-10785 Berlin Telefon: +49 30 – 26 99 50 00 Fax: +49 30 – 26 99 50 10 e-Mail: [email protected] Johannes Tuchel Normalität der Integration oder Ignoranz der Verbrechen? Überlegungen zur Darstellung des Generalrichters Manfred Roeder in Ingrid Bergs Aufsatz „Kommunalpolitik mit NS‐ Vergangenheit? Manfred Roeder als Beigeordneter in Glashütten, in: Jahrbuch Hochtaunus‐ kreis 26 (2018), S. 205 ff. Unkorrigierte Manuskriptfassung, Berlin im April 2019 Seite 2 Ingrid Berg hat in ihrem Aufsatz auf der Grundlage vor allem der lokalen und regionalen Archi‐ ve die lokalpolitische Bedeutung des ehemaligen Generalrichters der Luftwaffe Manfred Ro‐ eder in den 1960er Jahren gewürdigt. Es geht ihr dabei „ausdrücklich nicht um eine Biografie Manfred Roeders, nicht um seine Rolle im verbrecherischen Apparat des Dritten Reiches und erst recht nicht um eine Beurteilung seines Handelns nach heutigen ethischen Maßstäben. Es geht vielmehr um die Rolle, die Manfred Roeder in Glashüttener Kommunalpolitik zugekom‐ men ist.“1 Trotz dieser Einschränkungen nennt Berg eine Reihe von biografischen Daten und liefert allgemeine Einschätzungen des Roederschen Handelns, die nichts mit Glashütten zu tun haben. Diese scheinen mir an einigen Stellen ergänzungs‐ und korrekturbedürftig zu sein. Viel‐ leicht lassen sich dann auch einige Fragen an den Umgang mit Manfred Roeders Vergangenheit in Glashütten präziser als bisher stellen. Welche prägenden Erlebnisse lassen sich in der Biografie Roeders finden?2 Der am 20. August 1900 in Kiel geborene machte als 17‐Jähriger 1917 sein „Notabitur“ an einem Berliner Gymna‐ sium. Er meldete sich freiwillig zum Heer und diente beim 3. -
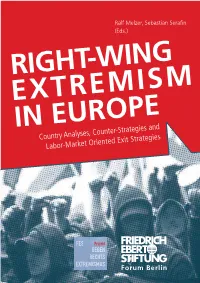
RIGHT-WING EXTREMISM in EUROPE Country Analyses, Counter-Strategies and Labor-Market Oriented Exit Strategies
Ralf Melzer, Sebastian Serafi n (Eds.) RIGHT-WING EXTREMISM IN EUROPE Country Analyses, Counter-Strategies and Labor-Market Oriented Exit Strategies FES GEGEN RECHTS EXTREMISMUS Forum Berlin RIGHT-WING EXTREMISM IN EUROPE I II RIGHT-WING EXTREMISM IN EUROPE RIGHT-WING EXTREMISM IN EUROPE Country Analyses, Counter-Strategies and Labor-Market Oriented Exit Strategies Imprint ISBN: 978-3-86498-522-5 Edited for: Friedrich-Ebert-Stiftung (Friedrich Ebert Foundation) by Ralf Melzer and Sebastian Serafi n Forum Berlin/Politischer Dialog “Project on Combatting Right-Wing Extremism” Hiroshimastraße 17, 10785 Berlin Proofreading: Sandra Hinchman, Lewis Hinchman Translations: zappmedia GmbH, Berlin Photos: see page 464 Design: Pellens Kommunikationsdesign GmbH, Bonn Printing: Druck- und Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG Sontraer Straße 6, 60386 Frankfurt am Main Copyright 2013 by Friedrich-Ebert-Stiftung, Projekt „Gegen Rechtsextremismus“, Forum Berlin Editors’ notes: The spelling, grammar, and other linguistic conventions in this volume refl ect American English usage. The judgments and opinions expressed in the articles collected for this book are those of the authors. They do not necessarily represent the views of the Friedrich Ebert Foundation or of the editors. In order to preserve the uniqueness and individuality of the contributions to this anthology, the editors have decided to retain divergent citation styles. This anthology was compiled as part of a project entitled “Confronting right-wing extremism by developing networks of exit-oriented assistance.” That project, in turn, is integral to the XENOS special program known as “exit to enter” which has received grants from both the German Federal Ministry of Labor and Social Affairs and the European Social Fund. -

0912138629Chief Worldhistory.Biz
Gestapo-Chief: The CIA & Heinrich Müller By Gregory Douglas TBR News Table of Contents Foreword Author’s Acknowledgments Mueller, Heinrich: The official biography Introduction Historical Background The Unmasking of the Interrogator The State of the Union Counter-Intelligence and “Barbarossa” Excerpt on Henry Agard Wallace Admiral Darlan and General Sikorski The Fall of Mussolini Andreas and Bernhard Fine Art as a Commodity Excerpt on Hermann Göring The Knight, Death and The Devil Here Today, Gone Tomorrow The Paranoia of Josef Stalin The Wet World of Josef Stalin Bloody Sunday Gertrude the Screamer An Explosive Career The Jews in the Cellar Rudolf Hess and the Flight to England The Resurrection of Odilo Globocnik The Lion of Münster Kurt Gerstein: A Soul in Torment Paris in the Spring The Trials and Tribulations of the Duke of Windsor Excerpt on Roger Casement July 20th, 1944: Part 1 July 20th, 1944: Part 2 Excerpt on Rommel Betrayal from London Stauffenberg Envoy Müller and the Escape from Berlin The Death and Transfiguration of Heinrich Müller The General, the Company, and the Road to Damascus Bibliography Appendix Foreword Most books on historical personages are only repetition of the subject done by earlier writers. New historical material, especially important material, on controversial individuals rarely appears in print, either because it has been destroyed or deliberately hidden away. If such material does surface, it is generally met with hostility by other published writers in the field if this information makes their own works obsolete. Here we have as a central character, Heinrich Müller, also known as “Gestapo” Müller to differentiate him from another Heinrich Müller of the same rank and in the same department. -

Jahrbuch Hochtaunuskreis (2020)
Jahrbuch Hochtaunuskreis 2020 28. Jahrgang Schwerpunktthema Literatur (Diese Beiträge sind farbig hinterlegt) Johannes Tuchel Normalität der Integration oder Ignoranz der Verbrechen? Überlegungen zu Manfred Roeder als Beigeordneter in Glashütten Ein 2018 im Jahrbuch Hochtaunuskreis er- Welche prägenden Erlebnisse lassen sich schienener Aufsatz hat auf der Grundlage vor 2 Der am 20. allem der lokalen und regionalen Archive die August 1900 in Kiel Geborene machte als lokalpolitische Bedeutung des ehemaligen 17-Jähriger 1917 sein „Notabitur“ an einem Generalrichters der Luftwaffe Manfred Roe- Berliner Gymnasium. Er meldete sich freiwil- der in den 1960er Jahren gewürdigt. Es ging lig zum Heer und diente beim 3. Rheinischen Feld-Artillerie-Regiment Nr. 83 als Artillerie- Manfred Roeders, nicht um seine Rolle im beobachter. Im Juli 1918 erlitt er in Frank- verbrecherischen Apparat des Dritten Rei- reich eine Gasvergiftung und eine Verletzung ches und erst recht nicht um eine Beurteilung am Oberschenkel. Das Regiment wurde nach seines Handelns nach heutigen ethischen dem Waffenstillstand nach Lohne/Oldenburg Maßstäben. Es geht vielmehr um die Rol- verlegt und im Dezember 1918 demobilisiert, le, die Manfred Roeder in der Glashüttener Roeder als Leutnant entlassen. Roeder schloss Kommunalpolitik zugekommen ist.“1 Trotz sich danach der Garde-Kavallerie-Schützen- dieser Einschränkungen nennt die Autorin In- Division an und war an den Berliner Stra- ßenkämpfen im Januar 1919 beteiligt. 1920 und liefert allgemeine Einschätzungen des kämpfte er in der Freiwilligen Russischen Roeder’schen Handelns, die nichts mit Glas- Westarmee (Westrussische Befreiungsarmee), hütten zu tun haben. Diese scheinen mir an einer weißrussischen antikommunistischen einigen Stellen ergänzungs- und korrektur- bedürftig zu sein. Vielleicht lassen sich dann auch einige Fragen an den Umgang mit Man- fred Roeders Vergangenheit in Glashütten 2 Zum Folgenden: Staatsarchiv Nürnberg, Bestand Interro- gations, R 118, Vernehmung Roeders vom 9.