P2 Räumliches Entwicklungskonzept
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
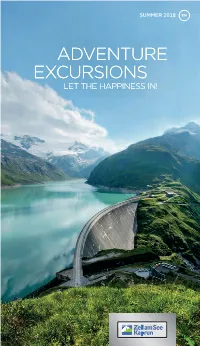
Adventure Excursions
SUMMER EN ADVENTURE EXCURSIONS LETTHEHAPPINESSIN! ZELLAMSEE Schmittenhöhe HOHETAUERNNATIONALPARK Felsentherme SteamTrain-LocalPinzgauTrain AdventureMinigolfWoferlgut IceCave NightbusZellamSee Kaprun ExperienceWorldWood AdventureCastleHohenwerfen BoattripsonlakeZell Mühlauersäge SALZBURGCITY IndoorSwimmingPool-Freizeitzentrum Wildlife-&AdventureParkFerleiten MönchsbergLift Lidos-Freizeitzentrum GrossglocknerHighAlpineRoad HausderNatur CasinoZellamSee NorikerHorseMuseum MuseumderModerne–Mönchsberg WeissseeGlacierWorld KAPRUN Kitzsteinhorn-THEGlacier MuseumderModerne–Rupertinum Nationalparkworlds AlpineCoasterMaisifl itzer DomQuartier-MorethanaMuseum MuseumBramberg WanderErlebnisbus-HikingBusMaiskogel FortressHohensalzburg WorldsofWaterKrimml KaprunMuseum Mozart’sBirthplace KrimmlWaterfalls Vötter’sVehicleMuseum MozartResidence Kitzloch-Gorge CastleKaprun KitzClimbingArena SALZBURGSURROUNDINGS SigmundThunGorge EmbachMountainGolf SalzburgOpen-AirMuseum HighAltitudeReservoirs NationalParkHouse’KönigederLüfte‘ SaltWorldsandCelticVillageHallein TAUERNSPAZellamSee-Kaprun RealTauerngold HellbrunnPalaceandTrickFountains BirdofPreyCenter SalzburgZoo FerdinandPorsche’s GLEMMVALLEY WorldofExperienceFahr(t)raum KartTrackSaalbach FANTASIANAAdventurePark GlemmyO roadPark Strasswalchen Thevalleyendin Schafbergbahn Saalbach-Hinterglemm DIVE Wolfgangseeschi fahrt SAALFELDEN LUNGAU INTO SummerTobogganRun CastleAdventureMauterndorf MuseumRitzenCastle SUMMER CARINTHIA ClimbingGymFelsenfest Heidi-AlmKidsAdventurePark -
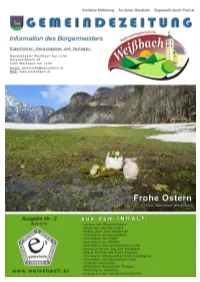
Download Bereit Bzw
Bild Inhalt - Vorwort des Bürgermeisters - Neues aus dem Naturpark - Kneipp aktiv Club Saalachtal - Information Kinderreisepass - Information der SGKK - Information der ZEMKA - Information Seniorenwohnheim Lofer - Rückblick Winter des USV Weißbach - Mobile Rufhilfe des Roten Kreuzes - Information Arbeitnehmer/innenveranlagung - Information der Hauptschule Lofer - Clubkids Information - Information Sozialmarkt Pinzgau - Wohnung zu vermieten - Auszug aus der Jahresrechnung 2011 Klammeingangssteg sowie der Steg beim Haus Liebe Weißbacherinnen, OW 17 (Rudi Haitzmann) erneuert werden. Weiters Liebe Weißbacher! soll die Weißbachbrücke beim Haus OW 19 (Fam. Stockklauser) erneuert werden. Diese wird aller Voraussicht nach um 30 bis 50 cm angehoben, um den Durchfluss des Weißbaches bei Hochwasserereignissen zu erhöhen. Diese Maßnahme war bereits bei der Schutzverbauung des Weißbaches 2005 angedacht. Auf jeden Fall wird es dadurch zu notwendigen Sperren der Brücken kommen. Ich bitte jetzt schon alle davon In den letzten Tagen und Wochen haben einige Betroffenen um ihr Verständnis. sehr wichtige Ereignisse für die Gemeinde Weißbach stattgefunden. Wie jedes Jahr stellte das Frühjahrskonzert unserer Trachtenmusikkapelle im Turnsaal der Hauptschule Zum einen wurde der Spatenstich für das Lofer den Auftakt des musikalischen Jahres dar. Seniorenwohnheim Unken – Lofer - St. Martin - Mit dem Mut zu neuem haben Kapellmeister Sepp Weißbach durchgeführt. Die Bauarbeiten gehen Hagn und seine Musikanten wieder einmal nun sehr zügig voran. Die Fertigstellung und somit bewiesen, zu welchen Leistungen sie fähig sind. die Übersiedlung der Bewohner wird Ende 2013 Neben den musikalischen Höchstleistungen sein. Der einzige Wermutstropfen dabei ist, dass imponieren dabei die hervorragende Kamerad- unsere ortsansässige Baufirma Schmuck GmbH schaft und der Zusammenhalt. Ich freue mich nun doch nicht mit dem Bau beauftragt wurde. Mit schon jetzt auf die kommenden Ausrückungen Ende März 2012 ist die Leiterin des unserer Musikkapelle. -
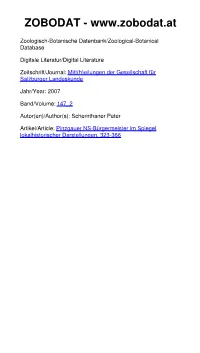
Pinzgauer NS-Bürgermeister Im Spiegel Lokalhistorischer Darstellungen
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mitt(h)eilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde Jahr/Year: 2007 Band/Volume: 147_2 Autor(en)/Author(s): Schernthaner Peter Artikel/Article: Pinzgauer NS-Bürgermeister im Spiegel lokalhistorischer Darstellungen. 323-366 © Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, Salzburg, Austria; download unter www.zobodat.at 323 Pinzgauer NS-Bürgermeister im Spiegel lokalhistorischer Darstellungen Von Peter Schernthaner E in leitung Unter der Herrschaft des Nationalsozialismus wurden furchtbare Ver brechen verübt. Am Ende standen Verwüstung, Elend und der gewaltsame Tod von vielen Millionen. Die 1945 wiedererstandene Republik Österreich schlüpfte von Anfang an in eine Opferrolle. Österreich betrachtete sich als ein Land im Stande der politischen Unschuld. Befreit von einer Unter drückung, der es sich entschieden widersetzt hatte und fest entschlossen, mit der vollen Schärfe der Gesetze gegen die wirklich Schuldigen vorzugehenx. Bereits am 7. Juni 1945 trat — zunächst nur für den Bereich der sowjetischen Besatzungsmacht — das Verbotsgesetz 19452 in Kraft. Dieses verfügte die Auflösung der NSDAP und aller ihrer Gliederungen und untersagte jede Neubildung. Zuwiderhandlungen waren mit strengsten Strafen, bis hin zur Todesstrafe, bedroht. Es verfügte eine Registrierungspflicht für alle Mitglie der der NSDAP oder deren Gliederungen. Wer zwischen dem 1. Juli 1933 und dem 13. März 1938 der NSDAP angehört hatte, galt ohne weiteres Ver fahren als des Hochverrates schuldig, doch wurde die Verfolgung wegen die ses Tatbestandes ausgesetzt. Kurz darauf folgte das Kriegsverbrechergesetz3, dessen § 1 allein die Ausübung bestimmter Funktionen im NS-Staat (z. B. Mitglieder der Reichsregierung, Gauleiter, SS-Führer vom Standartenführer aufwärts u. dgl.) für eine Bestrafung qualifizierte. -

Tourismusverbände Im Land Salzburg (Stand 31.12.2020)
Tourismusverbände im Land Salzburg (Stand 31.12.2020) In 108 Gemeinden bestehen Tourismusverbände, davon haben sich insgesamt 27 Gemeinden zu folgenden 9 TVB zusammen geschlossen: Bezeichnung Zusammenschlüsse TV Gemeinden Kontaktdaten Tourismusverband Obertauern Tweng + Untertauern Tel. 06456/7252 [email protected] www.obertauern.com Tourismusverband Großarltal Großarl + Hüttschlag Tel. 06414/281 [email protected] www.grossarltal.info Lofer + St. Martin bei Lofer + Unken Tourismusverband Salzburger Saalachtal + Weißbach bei Lofer Tel. 06588/8321 [email protected] www.lofer.com St. Veit im Pongau + Schwarzach Tourismusverand St. Veit-Schwarzach im Pongau Tel. 06415/7520 [email protected] www.sonnenterrasse.at Bruck an der Glocknerstraße + Tourismusverband Bruck – Fusch Fusch an der Glocknerstraße Tel. 06545/7295 [email protected] www.grossglockner-zellersee.info Mittersill + Hollersbach + Tourismusverband Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden Stuhlfelden Tel. 06562/40869 [email protected] www.mittersill.at Tourismusverband Wagrain-Kleinarl Wagrain + Kleinarl Tel. 06413/8448 [email protected] www.wagrain-kleinarl.at Fuschl am See + Ebenau + Hof + Tourismusverband Fuschlseeregion Faistenau + Hintersee + Koppl Tel. 06226/8384 [email protected] www.fuschlseeregion.com Göriach, Lessach, Mariapfarr, Tourismusverband Mauterndorf, Ramingstein, St. Tourismus Lungau Salzburger Land Andrä, Tamsweg, Weißpriach, Tel. 06474/2145 [email protected] www.tourismuslungau.at St. Michael, St. Margarethen, Tourismusverband -

Kraftwerksgruppe Pinzgau PINZGAU IST SALZBURGS STROMPIONIER
ERZEUGUNG WO SAUBERE ENERGIE HERKOMMT. KRAFTWERKSGRUPPE PInzgAU PINZGAU IST SALZBURGS STROMPIONIER Wo einst Salzburgs erster Strom erzeugt wurde, spielt er auch heute für die Wirtschaft der Region eine wesentliche Rolle. Bereits vor 1881 erzeugte Ignaz Rojacher in seinem Rauriser Goldbergwerk mit einem einfachen Wasserrad Lichtstrom „im continuirlichen Betriebe“. Bis zur Jahrhundert- wende errichteten Hoteliers und das Aluminiumwerk in Lend eigene Anlagen. Ortseigene Wasserkraftwerke gab es 1902 in Niedernsill und 1905 in Saalfelden. Erstes Großkraftwerk in Fusch Nach dem Ersten Weltkrieg entstand das Fuscher Bärenwerk, als erstes landeseigenes Großkraftwerk. Es machte den Raum um Zell am See mit einem Schlag zu einem der am besten mit Elektrizität versorgten Gebiete Österreichs. Allerdings hatte Strom als Luxusgut mit erheblichen Absatzproblemen zu kämpfen. Motor für die Wirtschaft Mit dem Wirtschaftsaufschwung nach dem 2. Weltkrieg stieg auch der Strombedarf kontinuierlich an. Neben der lokalen Industrie profitiert im Pinzgau vor allem auch der Tourismus von der sicheren und ökologischen Stromerzeugung durch Wasserkraft. Landschaft und Umwelt, der größte Gästemagnet in der Tauernregion, bleiben unbelastet. WASSERKRAFT IM PINZGAU Kraftwerk Bachwinkl 1905 120 kW Kraftwerk Bärenwerk 1924 14.960 kW Kraftwerk Dießbach 1964 24.000 kW Kraftwerk Wald 1988 23.500 kW Kraftwerk Trattenbach 2005 5.070 kW Kraftwerk Hollersbach 2010 5.200 kW PINZGAU IST SALZBURGS STROMPIONIER Als erster Salzburger hatte Ignaz Rojacher in seinem Goldbergbau bereits um 1880 elektrisches Licht. Das Bärenwerk machte im Pinzgau den Raum um Zell am See ab 1924 zu einem der am besten elektrifizierten Gebiete Österreichs. KRAFTWERK DIESSBACH Die rekordverdächtig steile Druckrohrleitung ist das Markenzeichen des Kraftwerkes. Erbaut in den 60er-Jahren gilt es auch heute noch als bauliches und technisches Meisterwerk. -

20161018 STOV BILLA Mittersill
BILLA IN MITTERSILL Standortverordnung für Handelsgroßbetriebe/ Kategorie Verbrauchermarkt BILLA AG Industriezentrum NÖ Süd Str. 3, Objekt 16 2355 Wiener Neudorf Vers. 0 vom 18.10.2016 BILLA Mittersill Standortverordnung Projektleitung: Mag. Silvia Enzensberger Bearbeitung: Mag. Silvia Enzensberger Mag. Doris Winkler ProjektProjekt----Nr.:Nr.:Nr.:Nr.: 15 KEP 1009/04 REGIOPLAN INGENIEURE Salzburg GmbH Siezenheimer Straße 39A A-5020 Salzburg Tel. +43/662/45 16 22-0 Fax +43/662/45 16 22-20 email [email protected] Internet http://www.regioplan.org 18.10.2016 Seite 2 von 31 BILLA Mittersill Standortverordnung INHALT 111 Veranlassung und Projekt 444 1.1 Lage, Funktion- und Nutzungsstruktur 7 1.2 Bestehende Verkehrsstruktur und technische Infrastruktur 10 1.3 Wichtige Umweltmerkmale 14 222 Rechtliche Rahmenbedingungen im Bundesland Salzburg 161616 2.1 Ziele der überörtlichen Raumplanung 16 2.2 Ziele der örtlichen Raumplanung 20 333 Strukturanalyse mit Umwelterheblichkeitsprüfung 232323 3.1 Schwellenwertprüfung für Umweltprüfung: 23 3.2 Prüfung nach Ausschlusskriterien 24 444 Sonstige Auswirkungen der Planung 262626 4.1 Verkehrserschließung und technische Infrastruktur 26 4.2 Wirtschaft und Handelsstruktur 28 555 Quellenverzeichnis 313131 666 Anlagen 313131 ABBILDUNGENABBILDUNGEN:::: Abb. 1: Abgrenzung des Planungsgebietes (ohne Maßstab) 6 Abb. 2: Lage in der Region- Gemeinde Mittersill 7 Abb. 3: Lageplan mit Standorterweiterung Billa Mittersill (ohne Maßstab) 9 Abb. 4: Lage zu öffentlichen Haltestellen Bus/Bahn 11 Abb. 5: Wildbachgefahrenzonen -
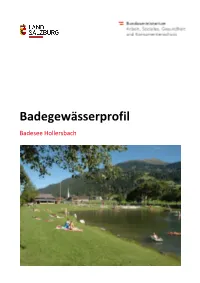
1.2 Badegewässer Name
Badegewässerprofil Badesee Hollersbach Badegewässerprofil Badesee Hollersbach AT3220003000030010 erstellt gemäß Bäderhygienegesetz (BHygG), BGBl. Nr. 254/1976 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 42/2012 und Badegewässerverordnung (BGewV), BGBl. II Nr. 349/2009 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 202/2013 Erstellung: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz und Amt der Salzburger Landesregierung In Kooperation mit: Erscheinungsjahr 2019 Impressum Herausgeber, Medieninhaber und Hersteller: Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz, Radetzkystraße 2, 1030 Wien https://www.sozialministerium.at/ Für den Inhalt verantwortlich: SC Hon. Prof. Dr. Gerhard Aigner, Sektion IX-Öffentliche Gesundheit, Lebensmittel-, Medizin- und Veterinärrecht Titelbild: Badesee Hollersbach © Amt der Salzburger Landesregierung Erscheinungsjahr 2019 Diese Publikation ist auf der Homepage der AGES - Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH unter https://www.ages.at als Download erhältlich. 1 Allgemeine Beschreibung des Badegewässers ........................................................................................... 6 1.1 Badegewässer ID ................................................................................................................................ 6 1.2 Badegewässer Name .......................................................................................................................... 6 1.3 Badegewässer Kurzname ................................................................................................................... -

Endlose Möglichkeiten Limitless Possibilities
NR. Skigebiet · Skiverbund Pisten-km Lifte NR. Skigebiet · Skiverbund Pisten-km Lifte NO. Skiing Region · Ski-Pass Network km of Slopes Lifts NO. Skiing Region · Ski-Pass Network km of Slopes Lifts Endlose Möglichkeiten 1 Skiwelt Wilder Kaiser - Brixental 288 km 90 13 Obertauern 100 km 26 Brixen im Thale, Ellmau, Going, Hopfgarten, Itter, www.ski-obertauern.at Limitless possibilities Kelchsau, Scheffau, Söll, Westendorf www.skiwelt.at 14 Ski amadé 760 km 270 14a Salzburger Sportwelt 21 Skiregionen in Österreich und Bayern 2 Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau 109 km 45 Snow Space Salzburg (Flachau-Wagrain- Niederau, Oberau, Auffach, Alpbach & St. Johann/Alpendorf), Zauchensee - 21 skiing regions in Austria and Bavaria Inneralpbach, Reith im Alpbachtal, Kramsach Flachauwinkl-Kleinarl, Radstadt - www.skijuwel.com Altenmarkt, Eben, Filzmoos, Goldegg 14b Gastein 3 Gletscherskigebiete | 3 glaciers 3 Zillertal Arena 147 km 52 Bad Gastein | Sportgastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein Zell im Zillertal, Gerlos, Königsleiten, Hochkrimml 14c Großarltal 6 Weltcuporte 2.750 Pistenkilometer www.zillertalarena.com 2,750 km of slopes 14d Region Hochkönig 6 world-cup sites 4 Kitz Ski 188 km 57 Maria Alm - Dienten - Mühlbach, Hinterreit, Arthurhaus | Hochkeil, Grießfeld Kitzbühel, Kirchberg, Jochberg, Paß Thurn, 14e Region Schladming Dachstein Mittersill | Hollersbach Forstau | Fageralm, Schladming-Pichl | www.kitzski.at Reiteralm, Schladming | Planai, Rohrmoos | 1 Ticket | 1 ticket Hochwurzen, Skiregion Ramsau | Dachstein, 5 3 Länder Freizeit Arena 171 km 61 Haus | Hauser-Kaibling, Pruggern | Steinplatte-Waidring, Winklmoosalm-Reit im Galsterbergbahn Winkl, SkiStar St. Johann in Tirol - Oberndorf, www.skiamade.com Skilifte Kirchdorf, Lärchenhof- Erpfendorf, 20 21 Regionen | 21 regions 18 Die Buchensteinwand - Bergbahn Pillersee, 15 Werfenweng 29 km 10 5 Almenwelt Lofer, Heutallifte - Unken www. -

Zell Am See Lokalbahn - Krimml 230 Fahrplan Gültig Ab 29.07.2021 Bis Auf Weiteres - Schienenersatzverkehr Ab Niedernsill
Zell am See Lokalbahn - Krimml 230 Fahrplan gültig ab 29.07.2021 bis auf Weiteres - Schienenersatzverkehr ab Niedernsill 3302 3350 3352 3306 3354 3308 3356 3310 3358 3312 3360 3314 3362 3316 3364 3318 3366 3320 3368 3322 3370 3346 3324 3372 3326 3328 3330 3332 SVV Linie 230 [ ] [ ] EILZUG km Schmalspurbahn tägl. W W tägl. W tägl. W tägl. W tägl. W tägl. W tägl. W tägl. W tägl. W tägl. W W tägl. W tägl. tägl. W 2 bis Niedernsill planmäßiger Zugverkehr 0 Zell am See Lokalbahn ab 06:30 07:20 07:40 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 16:50 17:00 17:30 18:00 19:00 20:00 20:50 1 x Tischlerhäusl 06:33 07:23 07:43 08:03 08:33 09:03 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 16:53 17:03 17:33 18:03 19:03 20:03 20:53 2 x Kitzsteinhornstraße 06:34 07:24 07:44 08:04 08:34 09:04 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 16:54 17:04 17:34 18:04 19:04 20:04 20:54 3 x Areitbahn 06:35 07:25 07:45 08:05 08:35 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 I 17:05 17:35 18:05 19:05 20:05 20:55 3 x Bruckberg 06:36 07:26 07:46 08:06 08:36 09:06 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 16:56 17:06 17:36 18:06 19:06 20:06 20:56 4 x Zellermoos 06:37 07:27 07:47 08:07 08:37 09:07 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 I 17:07 17:37 18:07 19:07 20:07 -

Der Berg Ruft...8
Der Berg ruft............................................... 8 Einleitung................................................. 10 1 Traunstein Traunsee.................................. 20 2 Großer Höllkogel Ebensee...........................22 3 Großer Brunnkogel Attersee....................... 24 4 Schafberg St. Wolfgang.............................. 26 5 Gamsfeld Rußbach.................................... 28 6 Braunedelkogel Postalm............................ 30 7 Rinnkogel Strobl....................................... 32 8 Rettenkogel Strobl.................................... 34 9 Hoher Zinken Hintersee.............................. 36 10 Egelseehörndl Abtenau.............................. 38 11 Hochstaufen Bad Reichenhall......................40 12 Sonntagshorn Unken................................ 42 13 Salzburger Hochthron Grödig......................44 14 Bgd. Hochthron Marktschellenberg............... 46 15 Hoher Göll Berchtesgaden/Kuchl.................. 48 16 Watzmann Mittelspitze Berchtesgaden........ 50 17 Hochkalter Ramsau................................... 52 18 Kammerlinghorn Weißbach bei Lofer............54 19 Stadelhorn Ramsau................................... 56 20 Großes Häuselhorn Lofer........................... 58 21 Edelweißlahner Ramsau............................ 60 22 Großer Weitschartenkopf Jettenberg............62 23 Großes Ochsenhorn Lofer.......................... 64 24 Birnhorn Leogang..................................... 66 25 Großes Rothorn Weißbach bei Lofer.............. 68 26 Tristkopf Sulzau....................................... -

Tourismus Im Land Salzburg 2019/20
Landesstatistik Tourismus im Land Salzburg Tourismusjahr 2019/20 Impressum Medieninhaber: Land Salzburg Herausgeber: Landesamtsdirektion, Referat Landesstatistik und Verwaltungscontrolling vertreten durch Dr. Gernot Filipp Bildnachweis: Foto Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer: © Helge Kirchberger Photography Redaktion, Mitarbeit, Koordination: Mag. Ulrike Höpflinger, Christine Nagl, Judith Pichler Umschlaggestaltung, Satz und Grafik: Landesstatistik und Verwaltungscontrolling, Landesmedienzentrum Grafik Druck: Hausdruckerei Land Salzburg alle Postfach 527, 5010 Salzburg Erscheinungsdatum: Februar 2021 ISBN: 978-3-902982-95-7 Bestellinformationen: [email protected], Tel: +43 662 8042 3525 Downloadadresse: https://www.salzburg.gv.at/statistik-tourismus Rechtlicher Hinweis, Haftungsausschluss Wir haben den Inhalt sorgfältig recherchiert und erstellt. Fehler können dennoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Wir übernehmen daher keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität des Inhaltes; insbesondere übernehmen wir keinerlei Haftung für eventuelle unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die direkte oder indirekte Nutzung der angebotenen Inhalte entstehen. Eine Haftung der Autorinnen und Autoren oder des Landes Salzburg aus dem Inhalt dieses Werkes ist gleichfalls ausgeschlossen. Tourismus im Land Salzburg Tourismusjahr 2019/20 Mag. Ulrike Höpflinger Christine Nagl Judith Pichler AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG Landesamtsdirektion Referat 20024: Landesstatistik und Verwaltungscontrolling Schwierige -

Einnahmen, Ausgaben Und Schulden Nach Gemeinde
Finanzen Einnahmen, Ausgaben und Schulden im Jahr 2019 nach Gemeinde ordentlicher Haushalt außerordentlicher Haushalt Steuereinnahmen Schulden in 1.000 Euro Ertrags Grund- Kommunal- Interessen- sonstige pro Kopf Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben insgesamt anteile steuer steuer tenbeiträge Abgaben (in Euro) Land Salzburg 1.768.656 1.748.234 306.638 324.946 656.562 55.862 244.819 18.061 27.488 493.438 883,6 Bezirk Salzburg (Stadt) 565.410 565.410 69.167 75.347 237.728 14.951 87.972 822 21.561 71.872 463,6 Bezirk Hallein 174.977 175.320 38.132 37.835 65.975 5.025 18.923 2.071 737 57.783 950,0 Bezirk Salzburg-Umgebung 434.658 426.660 83.878 88.882 149.583 14.567 70.451 5.702 1.847 129.723 845,1 Bezirk St. Johann im Pongau 240.135 232.088 48.127 52.951 87.364 8.793 29.787 3.128 1.310 78.443 966,1 Bezirk Tamsweg 73.601 71.546 12.318 12.754 20.746 2.086 5.840 1.054 297 29.398 1.451,7 Bezirk Zell am See 279.874 277.210 55.015 57.177 95.166 10.439 31.846 5.285 1.735 126.220 1.440,4 Stadt Salzburg 565.410 565.410 69.167 75.347 237.728 14.951 87.972 822 21.561 71.872 463,6 Abtenau 18.620 18.634 1.022 1.359 5.740 587 1.695 82 50 8.987 1.526,9 Adnet 7.118 7.070 1.540 1.540 3.391 319 1.211 211 19 46 12,6 Annaberg-Lungötz 5.436 5.358 29 104 2.217 198 675 48 13 3.018 1.352,5 Bad Vigaun 4.835 4.892 826 535 2.137 169 467 89 19 1.057 513,4 Golling an der Salzach 12.107 11.944 7.931 6.817 4.183 357 1.277 276 46 9.469 2.195,6 Hallein 67.103 67.109 10.631 11.098 28.093 1.601 7.785 767 392 17.946 842,0 Krispl 1.891 1.599 113 312 878 61 64 14 6 127 144,7 Kuchl 16.705 17.611 1.434 1.434 6.920 649 2.192 229 76 1.632 221,4 Oberalm 16.033 15.843 2.028 2.028 4.154 309 789 58 30 0 0,0 Puch bei Hallein 16.501 16.790 11.496 11.536 4.487 453 2.240 39 50 11.456 2.408,8 Rußbach am Paß Gschütt 2.035 2.036 25 0 792 79 197 67 10 732 942,9 St.