Geschichte Der Forstsamendarre Jatznick
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Official Journal L 338 Volume 35 of the European Communities 23 November 1992
ISSN 0378 - 6978 Official Journal L 338 Volume 35 of the European Communities 23 November 1992 English edition Legislation Contents I Acts whose publication is obligatory II Acts whose publication is not obligatory Council Council Directive 92 /92/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 86/ 465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC (Federal Republic of Germany) 'New Lander* 1 Council Directive 92 /93 / EEC of 9 November 1992 amending Directive 75 /275 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268/ EEC (Netherlands) 40 Council Directive 92 / 94/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 75 / 273 /EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268/ EEC (Italy) 42 2 Acts whose titles are printed in light type are those relating to day-to-day management of agricultural matters, and are generally valid for a limited period . The titles of all other Acts are printed in bold type and preceded by an asterisk. 23 . 11 . 92 Official Journal of the European Communities No L 338 / 1 II (Acts whose publication is not obligatory) COUNCIL COUNCIL DIRECTIVE 92/92/ EEC of 9 November 1992 amending Directive 86 /465 / EEC concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 /268 / EEC (Federal Republic of Germany ) 'New Lander' THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Commission of the areas considered eligible for inclusion -

Jahrgang 9 ISSN 1611-227X 16. April 2011 Nr. 04 PASEWALKER NACHRICHTEN - 2 - – Gewerbliche Anzeige – Nr
Jahrgang 9 ISSN 1611-227X 16. April 2011 Nr. 04 PASEWALKER NACHRICHTEN - 2 - – Gewerbliche Anzeige – Nr. 04/2011 Nr. 04/2011 – Gewerbliche Anzeige – - 3 - PASEWALKER NACHRICHTEN PASEWALKER NACHRICHTEN - 4 - Nr. 04/2011 IMPRESSUM INHALTSVERZEICHNIS Pasewalker Nachrichten und Seite Inhalt Amtliches Mitteilungsblatt für das Amt Uecker-Randow-Tal ISSN 1611-227X Stadt Pasewalk Amtliches Mitteilungsblatt mit öffentlichen 04 Impressum/Inhaltsverzeichnis Bekanntmachungen der Stadt Pasewalk und des Amtes Uecker-Randow-Tal 05 Wir gratulieren 06 Veranstaltungskalender Pasewalk Das amtliche Mitteilungsblatt erscheint einmal monatlich und wird kostenlos an 07 Jubilare die erreichbaren Haushalte verteilt. 08 Öffentliche Bekanntmachungen Verbreitete Auflage: 10.000 Exemplare 11 Rathaus Herausgeber: 1. Stadt Pasewalk, Haußmannstraße 85, 17309 Pasewalk, 16 Brücke zum Nachbarn Internet: www.pasewalk.de 18 Kultur & Museum 2. Amt Uecker-Randow-Tal, Lindenstraße 32, 17309 Pasewalk 21 Wirtschaft Herstellung: Schibri-Verlag, Am Markt 22, 17335 Strasburg, 23 Infos Tel.: 039753/22757, Fax: 039753/22583, www.schibri.de, 24 Kultur- & Sporttermine E-Mail: [email protected] 30 Fernradweg Berlin Usedom Verantwortlich für den amtlichen Teil der Stadt Pasewalk: 31 Radwege in und um Pasewalk Der Bürgermeister 32 Vom Inn zum Strelasund in einem Zug Verantwortlich für den redaktionellen Teil der Stadt Pasewalk: 35 Kitas und Schulen Schibri-Verlag, Am Markt 22, 17335 Strasburg, [email protected] 36 Am Rande Verantwortlich für den amtlichen Teil des Amtes: 37 Vereine Der Amtsvorsteher, -

Mecklenburg-Vorpommern Brandenburg
260000 280000 300000 320000 340000 360000 380000 400000 420000 440000 380-kV-Freileitung Bertikow - Pasewalk Görmin Gemarkung Klein Schwiesow Gemarkung Kronskamp E5 Flur N1e, uFblusrtg. 277 Jürgenshagen Flur 2 Gnoien Flächenpool Nr.49 Klein Züssow - BBPIG Vorhaben Nr. 11 - Gemarkung Wilheminenhof Flst. 308/1, 310, 308/2, 308/4, 312 Loitz Alte Nebel 1. BA Schwiesow Karlsburg 0 Seewiese Flur 1, Flst. 275 0 Einreichung des Plans und der Unterlagen nach § 21 NABEG 0 Schwaan 0 0 Gemarkung Lüssow 0 0 0 8 Gemarkung Sandförde 8 Unterlage 7 9 Flur 1, Flst. 584 Gemarkung Heinrichsruh 9 5 5 Hornstorf Gemarkung Parum Wardow Flughafen Laage Flur 1 Bentzin BlatGt ä6g1elow Laage Flur 4 Flur 1, Flst. 87/2 ca. 1,5 km Flst. 201 Lassan Übersicht trassenferner Maßnahmen FlsGtü. t7z4ko/1w Wismar Bernitt Blatt 59 Angaben zu den Datengrundlagen siehe Anlage 3 der Planfeststellungsunterlagen nach § 21 NABEG Jarmen B103 E5 Tutow E5 Flächenpool Demmin Flächenpool Dargun Maßnahmen Nr.13 Nr.16 Blatt 60 Zurow Heinrichsruh Neukloster Kronskamp Blatt 51 Blatt 52 Lübow Jördenstorf Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Dorf Mecklenburg Bützow E5 Flächenpool Maßnahmenkennung Nr.21 Usedom Lüssow Sandförde A! C! EF ! 2 Erläuterung Maßnahmentyp Anklam De Barg Bobitz Pfarrkoppel A Ausgleichsmaßnahme Nr. Einzelmaßnahme E Ersatzmaßnahmen Warin 1:20.000 Neukalen Index Maßnahmentyp Vier1ro:s2e0nb.e0rg00 Kreienbarg Warnow Güstrow Borrentin Mühlen Bad Kleinen Tarnow Erläuterung Index Eichsen 1:20.000 1:20.000 Alt Meteln AR Artenschutzrechtlich erforderliche V- und M-Maßnahmen 0 0 0 Dobin am See Teterow 0 0 Mühl Rosin 0 0 0 6 Burow 6 Artenschutzrechtliche Maßnahme zur Erhaltung der ökologischen Funktion 9 Lalendorf 9 CEF 5 Brüel 5 Groß Wokern der Fortpflanzungs- und Ruhestätten (continuous ecological functionality) Schorssow DHL E2 Ducherow LRO-004 Malchin Maßnahmennummer und Beschreibung Sternberg Strandcafe Seehof Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Ueckermünde Brüsewitz Gemarkung Rothenmoor A9 Ersatzpflanzungen von Alleen und Baumreihen in Brandenburg Flur 6 E1 Erhaltung einer Offenlandfläche bei Pinnow Flst. -

Vorpommern-Greifswald Können Sie Hier Herunterladen
MIT DEM RAD AUF ENTDECKUNGSTOUR durch die Gutshauslandschaft Vorpommerns Teil II – Vorpommern-Greifswald INHALTSVERZEICHNIS Einführung S. 4 Gutshausrouten Route 1A – Entlang der Dänischen Wiek S. 7 Route 1B – Greifswalder Landschaft S. 8 Route 2 – Beidseits der Tollense S. 15 Route 3 – Nördlich der Peene S. 25 Route 4 – Lassaner Winkel S. 33 Route 5 – Zwischen Achterwasser und Haff S. 41 Route 6 – Landgrabental S. 47 Route 7 – Ueckermünder Heide S. 55 Route 8 – Rund um die Brohmer Berge S. 61 Route 9 – Beidseits der Randow S. 69 Route 10 – Östlich des Randowbruchs S. 75 Literatur S. 82 Informationen S. 83 MIT DEM RAD AUF ENTDECKUNGSTOUR durch die Gutshauslandschaft Vorpommerns Teil II – Vorpommern-Greifswald Einführung Nachdem wir im Jahr 2013 die Radwanderbroschüre zu Guts- und Parkanlagen im Landkreis-Vorpommern-Rügen erstellt haben und diese sich großer Beliebtheit erfreut hat, folgt nun die Fortsetzung mit dem zweiten Teil für den Landkreis Vorpommern- Greifswald. In dieser Broschüre werden elf verschiedene Routen vorgestellt, die dazu einladen, die Guts- und Herrenhäuser und die dazugehörigen Anlagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit dem Fahrrad zu erkunden. Neben diesen Anlagen sind auch weitere Sehenswürdigkeiten wie bezaubernde Alleen, kleine Dorfkirchen, histo- rische Ortskerne und vor allem die abwechslungsreiche Landschaft mit ihrem unver- wechselbaren vorpommerschen Gepräge zu entdecken. Radeln in Vorpommern ist dank der überwiegend flachen Topographie auch für Unge- übte zu empfehlen. Die leicht hügelige Landschaft macht das Radfahren einfach und die wenigen Steigungen sind gut zu meistern. Zu den einzelnen Routen wurden zwar Empfehlungen zum Richtungsverlauf gegeben, es ist jedoch an windigen Tagen ratsam, die Streckenrichtung vor Ort so zu legen, dass Sie Gegenwind und somit unnötige Anstrengungen vermeiden. -

Ortschaften Mit Gasnetz Im Land Mecklenburg-Vorpommern
Ortschaften mit Gasnetz im Land Mecklenburg-Vorpommern Gemeinde- Landkreis PLZ Gemeinde Ortsteil schlüssel Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Alt Panekow Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Altkalen Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Granzow Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Kleverhof Landkreis Rostock 13072004 17179 Altkalen OT Neu Panekow Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Alt Vorwerk Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Boddin Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Groß Lunow Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Klein Lunow Landkreis Rostock 13072016 17179 Boddin OT Neu Vorwerk Landkreis Rostock 13072023 17166 Dahmen OT Dahmen Landkreis Rostock 13072023 17166 Dahmen OT Großen Luckow Landkreis Rostock 13072023 17166 Dahmen OT Ziddorf Landkreis Rostock 13072035 17179 Gnoien, Stadt OT Dölitz Landkreis Rostock 13072035 17179 Gnoien, Stadt OT Gnoien Landkreis Rostock 13072038 17166 Groß Roge OT Groß Roge Landkreis Rostock 13072038 17166 Groß Roge OT Klein Roge Landkreis Rostock 13072040 17166 Groß Wokern OT Groß Wokern Landkreis Rostock 13072040 17166 Groß Wokern OT Neu Wokern Landkreis Rostock 13072040 17166 Groß Wokern OT Nienhagen Landkreis Rostock 13072040 17166 Groß Wokern OT Uhlenhof Landkreis Rostock 13072041 17168 Groß Wüstenfelde OT Groß Wüstenfelde Landkreis Rostock 13072041 17168 Groß Wüstenfelde OT Schwetzin Landkreis Rostock 13072045 17166 Hohen Demzin OT Hohen Demzin Landkreis Rostock 13072049 17168 Jördenstorf OT Jördenstorf Landkreis Rostock 13072068 17179 Lühburg -

== File: Baden-Wuerttemberg.Osm== Leinzell
== File: baden-wuerttemberg.osm== Leinzell (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.8481691&lon=9.8744058&zoom=13&layers=B00FTF Lampoldshausen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.2644733&lon=9.401743&zoom=13&layers=B00FTF Schmiechen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.3619755&lon=9.718584&zoom=13&layers=B00FTF Aasen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.9815384&lon=8.5536472&zoom=13&layers=B00FTF Steinweiler (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.7324411&lon=10.2646639&zoom=13&layers=B00FTF Dogern (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.6167&lon=8.16667&zoom=13&layers=B00FTF Dautmergen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.2325091&lon=8.750052&zoom=13&layers=B00FTF Dunningen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.2119538&lon=8.5058067&zoom=13&layers=B00FTF Niederrimbach (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.4746972&lon=9.9962608&zoom=13&layers=B00FTF Ratzenried (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.7205111&lon=9.9005783&zoom=13&layers=B00FTF Nimburg (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.1049349&lon=7.7748184&zoom=13&layers=B00FTF Kleingartach (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.0993393&lon=8.9731444&zoom=13&layers=B00FTF Erzingen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.6605789&lon=8.4250728&zoom=13&layers=B00FTF Bettenfeld (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.3407293&lon=10.1276214&zoom=13&layers=B00FTF Oggelshausen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.0712874&lon=9.6491112&zoom=13&layers=B00FTF Riedbach -

Jahrgang 8 ISSN 1611-227X 18. September 2010 Nr. 09 PASEWALKER NACHRICHTEN - 2 - – Gewerbliche Anzeige – Nr
Jahrgang 8 ISSN 1611-227X 18. September 2010 Nr. 09 PASEWALKER NACHRICHTEN - 2 - – Gewerbliche Anzeige – Nr. 09/2010 Nr. 09/2010 - 3 - PASEWALKER NACHRICHTEN IMPRESSUM INHALTSVERZEICHNIS Pasewalker Nachrichten und Seite Inhalt Amtliches Mitteilungsblatt für das Amt Uecker-Randow-Tal Stadt Pasewalk ISSN 1611-227X 03 Impressum/Inhaltsverzeichnis Amtliches Mitteilungsblatt mit öffentlichen 04 Wir gratulieren Bekanntmachungen der Stadt Pasewalk und des Amtes Uecker-Randow-Tal 05 Öffentliche Bekanntmachungen 06 Rathaus Das amtliche Mitteilungsblatt erscheint einmal monatlich und wird kostenlos an 08 Kultur & Museum die erreichbaren Haushalte verteilt. 11 Wirtschaft Verbreitete Aufl age: 10.000 Exemplare 11 Lesen Herausgeber: 1. Stadt Pasewalk, Haußmannstraße 85, 17309 Pasewalk, 13 Infos Internet: www.pasewalk.de 23 1.000-Euro-Gage für Gemischten Chor aus Pasewalk 2. Amt Uecker-Randow-Tal, Lindenstraße 32, 17309 Pasewalk Maschine Birr & Co. versetzten rund 9.000 Leute in Herstellung: Schibri-Verlag, Am Markt 22, 17335 Strasburg, Partylaune Tel.: 039753/22757, Fax: 039753/22583, www.schibri.de, 24 Mobil in allen Lebenslagen: Leistungsschau Uecker-Randow E-Mail: [email protected] blickt erfolgreich auf 2011 Verantwortlich für den amtlichen Teil der Stadt Pasewalk: 26 Aufl ösung des 8. Preisrätsels des Schibri-Verlags zur Der Bürgermeister Leistungsschau 2010 in Pasewalk Verantwortlich für den redaktionellen Teil der Stadt Pasewalk: 28 Schultradition lebt in der Baustraße fort Schibri-Verlag, Am Markt 22, 17335 Strasburg, [email protected] 31 Kultur- -

Stadtreporter UECKERMÜNDER STADTREPORTER -22- Nr
UECKERMÜNDER STADTREPORTER AMTLICHES MITTEILUNGSBLATT DER STADT UECKERMÜNDE kostenlos und monatlich Jahrgang 16 ISSN 1439-1465 Dienstag, der 15. Mai 2012 Nr. 05 Maritime Messe, Vereinsfest, Drachenbootfestival, Regatten, Livemusik, Wasserski, Rallye Stettiner Haff und einiges mehr sorgen vom 08. bis 10. Juni für reichlich Abwechslung in Deutschlands nordöstlichster Hafenstadt. Mit der Ueckermünder Haff-Sail möchten eröffnet wird die Haff-Sail am Freitag- die Anlieger des Stettiner Haffs auf deut- abend, zuvor wird es bereits eine Strate- scher und polnischer Seite auf die giekonferenz der Pomerania zum Was- vielfältigen Möglichkeiten an diesem Ge- sertourismus geben und die Rallye Stetti- wässer aufmerksam machen. Deutsch- ner Haff Station machen. Die Teilnehmer polnische Kontakte auf den Ebenen Wirt- der Rallye absolvieren eine Prüfungsfahrt schaft, Tourismus und Kultur sollen geför- und präsentieren anschließend ihre Fahr- dert und Voraussetzungen geschaffen zeuge in der Schlossallee. Am Samstag werden, damit sich die Menschen näher werden die Rallyeteilnehmer sicher unge- kommen. Die Haff-Sail ist dabei auch duldig von zahlreichen Besuchern am Ziel Volksfest, was sich in den zahlreichen und im Ueckerpark von ihrer Tour erwartet. Im kulturell-sportlichenAktivitäten ausdrückt. Anschluss können Besucher mit den Teil- Am diesjährigen Haff-Sail-Wochenende nehmern über die Rallye und Fahrzeuge wird es u.a. Wettkämpfe mit deutsch-pol- ins Gespräch kommen oder sich einfach nischer Beteiligung geben. Geplant sind nur die Fahrzeuge anschauen. ein Volleyball-, ein Streetsoccer- und ein Judo-Städte-Turnier. Der Samstag steht traditionell im Zeichen der Vereine. Viele von ihnen stellen den Neu in diesem Jahr ist der Veranstal- Besuchern ihr Vereinsleben vor. tungsort rund um den Ueckerpark unter Einbeziehung des Stadthafens. -
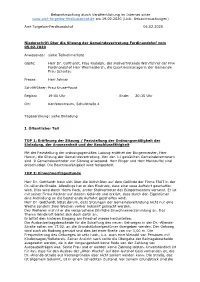
Link: Bekanntmachungen)
Bekanntmachung durch Veröffentlichung im Internet unter www.amt-torgelow-ferdinandshof.de am 19.02.2020 (Link: Bekanntmachungen) Amt Torgelow-Ferdinandshof 06.02.2020 Niederschrift über die Sitzung der Gemeindevertretung Ferdinandshof vom 05.02.2020 Anwesende: siehe Teilnehmerliste Gäste: Herr Dr. Gotthardt, Frau Rudolph, der stellvertretende Wehrführer der FFw Ferdinandshof Herr Wermelskirch, die Quartiersmanagerin der Gemeinde Frau Scharlau Presse: Herr Johner Schriftführer: Frau Kruse-Faust Beginn: 19:00 Uhr Ende: 20:35 Uhr Ort: Konferenzraum, Schulstraße 4 Tagesordnung: siehe Einladung I. Öffentlicher Teil TOP 1: Eröffnung der Sitzung / Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit Mit der Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung eröffnet der Bürgermeister, Herr Hamm, die Sitzung der Gemeindevertretung. Von den 11 gewählten Gemeindevertretern sind 9 Gemeindevertreter zur Sitzung anwesend. Herr Pinger und Herr Manteuffel sind entschuldigt. Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt. TOP 2: Einwohnerfragestunde Herr Dr. Gotthardt freut sich über die Aktivitäten auf dem Gelände der Firma FAAT in der Dr.-Allende-Straße. Allerdings hat er den Eindruck, dass eine neue Auffahrt geschaffen wird. Dies wird durch Herrn Poch, erster Stellvertreter des Bürgermeisters verneint. Er ist mit seiner Firma Pächter auf diesem Gelände und erklärt, dass durch den Eigentümer eine Anbindung an die bestehende Auffahrt geschaffen wird. Herr Dr. Gotthardt bittet darum, dass Sitzungen der Gemeindevertretung nicht nur eine Woche sondern zwei Wochen vorher bekannt gemacht werden. Des Weiteren mahnt er die versprochene jährliche Einwohnerversammlung an. Das Thema Windkraft bietet sich doch dafür an. Er bittet den hinteren Eingang am Friedhof wieder herzustellen. Die Ausbaubeitragsbescheide für die Schaffung des neuen Gehweges in der Dr.-Allende- Straße sollen am 17.02. -

LEADER Abschlussbroschüre Der Region „Stettiner Haff“ Gefördert, Gebaut Und Entwickelt…
LEADER Abschlussbroschüre der Region „Stettiner Haff“ Gefördert, gebaut und entwickelt… www.kreis-vg.de Inhalt Seite Eine Region im Wandel 04 Mit dem Rad das Land entdecken 05 Zahlreiche Wege führen quer durchs Land 06 Galenbecker See 07 Geschützte Natur 08 Die Stadt Strasburg 09 Es war einmal – Sagen der Region 10 Die Stadt Pasewalk 11 Wirtschaftsstandort 12/13 Erdkuhle Jatznick 14 Historisches Gemäuer wird zum Pflegezentrum 15 Ein Ort für Kinder 16 Mönkebude 17 Ein Schmuckstück aus längst vergangener Zeit 18/19 Die Stadt Ueckermünde 20 Informative Schilder und Tafeln 21 Übersichtskarte 22/23 Orte der Ruhe 24 Multiple Häuser 25/26 Die Stadt Eggesin 27 Naturparkzentrum Eggesin 28/29 Lernen kann so viel Spaß machen 30 Entlang der Uecker 31 Rallye Stettiner Haff 32 Mit ein paar Schritten hinein ins Mittelalter 33 Die Stadt Torgelow 34 Sanitär-Insel Torgelow 35 Löcknitz – ein Ort mit vielen Angeboten 36/37 Gärtnerei Koblentz 38 Die Stadt Penkun 39 Rittergut Damerow 40 Tagestouren 41 So bunt ist das Dorfleben 42 Impressum Herausgeber: Lokale Aktionsgruppe „Stettiner Haff“ Landkreis Vorpommern-Greifswald An der Kürassierkaserne 9 · 17309 Pasewalk Texte: Silvio Wolff Fotos: Marek Kowalczyk, Silvio Wolff, Peter Harbarg, Stephan Blankschein, Ulrich Blume, thinkstockphotos.de Gestaltung, Satz, Kartografie (S. 22-23, 44) Druckmanagement: Lieps GmbH · Die Werbeagentur · www.lieps.de Redaktionsschluss: 18.11.2014 Wir möchten auf diesem Wege allen recht herzlich danken, die uns bei der Erstellung dieser Broschüre unterstützt und ihre Fotos und Texte zur Verfügung gestellt haben. Fast zu schön zum Weitersagen. Eine Region im Wandel … Willkommen in der LEADER-Region „Stettiner Haff“ Liebe Leserinnen und Leser, ganz im Nordosten Deutschlands an der Küste des seit 1995 rund 8 Mio. -

Gemeindevertretung Jatznick Vorlage-Nr: Gvl 9 /043/2020
Gemeindevertretung Jatznick Vorlage-Nr: GVl 9 /043/2020 Vorlage !Status: öffentlich Datum: 05.05.2020 Erarbeitet durch: FB 2 - Finanzen Feststellung des Jahresabschlusses 2016 Beratungsfolge: Datum Gremium Zuständigkeit 10.06.2020 Gemeindevertretunq Jatznick Entscheidung Beschlussvorschlag: Die Gemeindevertretung Jatznick beschließt die Feststellung des vom Rech• nungsprüfungsamt Wolgast geprüften Jahresabschluss der Gemeinde Jatznick zum 31. Dezember 2016, der vom Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Ue• cker-Randow-Tal i. d. F. vom 12.05.2020 akzeptiert wurde. Sach- und Rechtslage: § 60 Abs. 5 Satz 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung vom 13. Juli 2011, in Kraft getreten am 05.09.2011. Der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Uecker-Randow-Tal hat den Jahresab• schluss der Gemeinde Jatznick zum 31. Dezember 2016, der durch das Rechnungsprü• fungsamt Wolgast gemäߧ 3a Kommunalprüfungsgesetz geprüft wurde, zugestimmt. Das Rechnungsprüfungsamt Wolgast hat das Ergebnis der Prüfung in seinem Prüfbe• richt zusammengefasst und abschließend in seinem Prüfvermerk einen uneinge• schränkten Bestätigungsvermerk erteilt, dem sich der Rechnungsprüfungsausschuss des Amtes Uecker-Randow-Tal in seinem abschließenden Prüfungsvermerk ange• schlossen hat. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so we• sentlich sind, dass sie der Feststellung durch die Gemeindevertretung entgegenstehen könnten. Der Prüfbericht incl. des Prüfvermerks und der abschließende Prüfungsvermerk sind der Beschlussvorlage als Anlagen beigefügt. Die Bilanzsumme beträgt 8.091.920,89 € Der Ergebnisvortrag des Vorjahres beträgt 1.104.109,79 € Das Jahresergebnis zum 31.12.2016 beträgt -100.468,68 € Die Finanzrechnung weist für 2016 einen Finanzmittelüberschuss aus von (kumulativ) 46.540,54 €. Seite: l /2 Der Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung ist gegeben. ln der Finanzrechnung konnte kein Haushaltsausgleich erzielt werden. -

5. LPG-Bildung Und LPG-Strukturentwicklung an Der
111 5. LPG-Bildung und LPG-Strukturentwicklung an der Peene: Zentralisation des Agrarkapitals in staatlicher Hand und Neu- bildung von Kapitalgesellschaften und Privatunternehmen nach der Wende Mit der Aufgabe vieler Bodenreformwirtschaften, hervorgerufen durch mangelnde wirtschaft- liche Voraussetzungen, durch zum Teil fachliche Inkompetenz, politische Repression und Abwanderung meist durch Flucht in den Westen, wurden häufig Bodenreformparzellen in den Bodenfonds zurückgegeben. Dieses Land wurde zum Teil von sogenannten Örtlichen Land- wirtschaftsbetrieben (ÖLB) übernommen, die kommunal durch die Gemeinden geleitet wur- den. Sie waren Vorläufer der LPG. Durch staatliche Direktiven, vor allem durch den II. Parteikonferenz der SED, erfolgte ab dem Jahre 1952 eine Kampagne zur Gründung von LPG nach dem Vorbild des sowjetischen Kolchos.275 Voraussetzungen dafür waren: die mit Absicht klein gehaltenen Bodenwirt- schaftsflächen, der Kapitalmangel an landwirtschaftlichen Fachkenntnissen, Zugvieh, Zucht- vieh, Saatgut und Gebäuden. Mit den örtlichen Landwirtschaftsbetrieben (ÖLB) und den vor- handenen materiellen Voraussetzungen der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe276 (VdgB) in Form von Agrarflächen und Gerät einerseits und den politischen Intentionen der VdgB wurden die Voraussetzungen geschaffen. Materielle Voraussetzungen wurden vor al- lem durch die Maschinenausleihstationen (MAS), später Maschinen-Traktoren-Stationen (MTS) hergestellt.277 So begann der Prozeß der LPG-Bildung hier exemplarisch im untersuch- ten Gebiet ebenso wie