Unverkäufliche Leseprobe
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Liebe, Freiheit Und Patriotismus Im Roman Cordelia Von Caroline Von Wolzogen
LIEBE, FREIHEIT UND PATRIOTISMUS IM ROMAN CORDELIA… COLLOQUIA 26 | 2017 | 23–42 GERMANICA ISSN 2450-8543 STETINENSIA DOI: 10.18276/CGS.2017.26-02 Literaturwissenschaft BARBARA ROWIŃSKA-JANUSZEWSKA Poznań LIEBE, FREIHEIT UND PATRIOTISMUS IM ROMAN CORDELIA VON CAROLINE VON WOLZOGEN Abstract In dem Beitrag wird auf die wichtigsten Motive des Romans Cordelia von Caroline von Wolzogen verwiesen. Eine der ersten deutschen Schriftstellerinnen ist bekannt vor allem durch ihren Erstlings- roman Agnes von Lilien und durch Schillers Leben, Cordelia wurde hingegen bisher kaum untersucht. Ihr Alterswerk zeigt Caroline von Wolzogen als eine Idealistin und Patriotin (Napoleonszeit, Befrei- ungskriege), die den Idealen der Weimarer Klassik und insbesondere den Ideen von Schiller („schöne Seele“) und Wilhelm von Humboldt treu geblieben ist. Schlüsselwörter Liebe, Bildung, Freiheit, Patriotismus 23 BARBARA ROWIŃSKA-JANUSZEWSKA LOVE, FREEDOM AND PATRIOTISM IN THE NOVEL CORDELIA BY CAROLINE VON WOLZOGEN Abstract The following paper examines the most important motifs in the last novel Cordelia by Caroline von Wolzogen. She was one of the first German women’s writers, Schillers sister-in-law, known mostly by her first novel Agnes von Lilien and Schiller’s Biography. Von Wolzogen’s last novel has so far hardly been investigated. It shows Wolzogen as an idealist and patriot (Napoleon’s time, Liberation wars) who has remained faithful to the ideals of Weimar Classicism, especially the ideas of Schiller (“beau- tiful soul”) and Wilhelm von Humboldt. Keywords love, education, freedom, patriotism MIŁOŚĆ, WOLNOŚĆ I PATRIOTYZM W POWIEŚCI CORDELIA CAROLINE VON WOLZOGEN Abstrakt Niniejszy tekst zajmuje się najważniejszymi motywami w ostatniej powieści Cordelia Caroline von Wolzogen. Jedna z pierwszych niemieckich pisarek znana jest głównie dzięki powieści Agnes von Lilien i biografii o Schillerze. -

Hin : Alexander Von Humboldt Im Netz
Markus Lenz Bewegte Systematik. Alexander von Humboldts „Amerikanische Reisetagebücher“ als Problemfelder der Literaturgeschichte und historischen Epistemologie Themenschwerpunkt Amerikanische Reisetagebücher HiN XVI, 31 (2015) ISSN: 1617–5239 Ingo Schwarz „etwas hervor- Julia Bispinck-Roßbacher Markus Alexander Lenz zubringen, was meines Kö- „Zwischen den Zeilen …“ Zur Bewegte Systematik. Alexan- nigs und meines Vaterlandes kodikologischen Untersu- der von Humboldts Amerika- werth sein kann“ – Briefe von chung der Amerikanischen nische Reisetagebücher als Alexander von Humboldt an Reisetagebücher von Alexan- Problemfelder der Literatur- Friedrich Wilhelm III., 1805 der von Humboldt geschichte und historischen Epistemologie Ottmar Ette Tras la huella de Tobias Kraft Humboldts la vida. El proyecto de larga Hefte. Geschichte und Ge- David Blankenstein, duración „Centro Alejandro genwart von Tagebuch-For- Bénédicte Savoy Frontale de Humboldt. Ciencia en schung und -Rezeption Präsenz. Zu einem unbe- movimiento“ edita los apun- kannten Porträt Alexander tes transdisciplinarios de Dominik Erdmann, Jutta von Humboldts im Besitz des Humboldt Weber Nachlassgeschichten – französischen Conseil d’État Bemerkungen zu Humboldts Horst Bredekamp Die Ameri- nachgelassenen Papieren Margot Faak Alexander von kanischen Reisetagebücher: in der Berliner Staatsbib- Humboldts Amerikareise ein erster Zugang liothek und der Biblioteka Jagiellońska Krakau Universität Potsdam Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften Internationale Zeitschrift für Humboldt-Studien International Review for Humboldtian Studies Revista internacional de estudios humboldtianos Revue internationale d‘études humboldtiennes ISSN: 1617–5239 HiN XVI, 31 (2015) Impressum Herausgeber Prof. Dr. Ottmar Ette, Prof. Dr. Eberhard Knobloch Editorial Board Dr. Tobias Kraft, Dr. Ulrich Päßler, Dr. Thomas Schmuck Redaktionelle Mitarbeit Katja Schicht, Sandra Ewers Advisory Board Prof. Dr. Walther L. Bernecker, Prof. Dr. Laura Dassow Walls, Prof. -

Insel Verlag
Insel Verlag Leseprobe Gersdorff, Dagmar von Caroline von Humboldt Eine Biographie © Insel Verlag insel taschenbuch 4158 978-3-458-35858-9 Schiller nannte sie »ein unvergleichliches Geschçpf«, fr Goethe war sie die bedeutendste Frau ihrer Zeit: Caroline von Humboldt (1766- 1829). Sie war nicht nur klug, gebildet und abenteuerlustig, sondern vor allem leidenschaftlich interessiert an der Kunst und neugierig auf Menschen. Caroline von Humboldt bereiste ganz Europa, ihr Haus in Rom wurde zum gesellschaftlichen Mittelpunkt. Sie fçrderte die dort lebenden deutschen Knstler und sammelte mit großem Kunstverstand. Trotzdem sah die Nachwelt in ihr lange vor allem nur die mustergltige Gattin Wilhelm von Humboldts. Dagmar von Gersdorff entwirft in die- ser Biographie ein neues Bild dieser außergewçhnlichen und selbstbe- wussten Frau. Dagmar von Gersdorff wurde in Trier geboren. Die promovierte Ger- manistin lebt heute als Literaturwissenschaftlerin und freie Schriftstel- lerin in Berlin. Sie ist Mitglied des Internationalen PEN. Im insel taschenbuch liegen außerdem von ihr vor: Marianne von Willemer und Goethe. Geschichte einer Liebe (it 4059), Mein Herz ist mir Heimat nicht geworden. Das Leben der Karoline von Gnder- rode (it 4023), Goethes Enkel. Walther, Wolfgang und Alma (it 3350), Dich zu lieben kann ich nicht verlernen. Das Leben der Sophie Bren- tano-Mereau (it 3235) und Goethes Mutter. Eine Biographie (it 2925). insel taschenbuch 4158 Dagmar von Gersdorff Caroline von Humboldt Dagmar von Gersdorff Caroline von Humboldt Eine Biographie Mit zahlreichen Abbildungen Insel Verlag Umschlagabbildung: Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz Erste Auflage 2012 insel taschenbuch 4158 Insel Verlag Berlin 2011 Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der bersetzung, des çffentlichen Vortrags sowie der bertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. -

Caroline Und Wilhelm Von Humboldt Nach Hazel Rosenstrauch, Wahlverwandt Und Ebenbürtig
Vortrag von Gisela Müller 1.3.2011 Literarische Gesellschaft Lüneburg Gelebte Gleichberechtigung vor 200 Jahren? Caroline und Wilhelm von Humboldt nach Hazel Rosenstrauch, Wahlverwandt und ebenbürtig Gliederung 1. Die Zeitenwende 1800 1 2. Biografie von Wilhelm und Caroline 2 - 6 3. Die neue Rolle der Frau 6 - 7 4. Das Verhältnis zwischen Caroline und Wilhelm – traditionell oder gleichberechtigt? 8 - 10 5. Der Riss in Leben und Theorie 10 - 13 6. Anmerkungen 13 - 20 1. Die Zeitenwende 1800 Caroline und Wilhelm von Humboldt leben in einer Zeit, die von unvorstellbaren Umbrüchen geprägt ist. Die Macht der Kirche wird von der Macht der Vernunft infrage gestellt, die Religionskritik schließlich zur Gesellschaftskritik von Marx. Die Ordnung der Welt ist nicht gottgegeben, sondern vom Menschen gemacht. Wenn sie gelingen sollte, müsste Kants kategorischer Imperativ verwirklicht werden. Er lautet. „Verhalte dich so, dass die Maxime deines Handelns zum allgemeinen Gesetz werden kann.“ Die ländlich und bäuerlich geprägte Welt mit grundherrlicher Abhängigkeit und klaren Standesgrenzen wird durch die Technisierung grundlegend verändert. Wilhelm lernt im Mansfeldischen Bergbau 1788 die erste in Deutschland gebaute Dampfmaschine kennen. 1769 hatte James Watt die erste industriell einsetzbare in England gebaut. Arbeitsteilung in Manufakturen und Fabriken führt zu neuen Lebensformen und die Industrialisierung zur Verstädterung. Die an feste Regeln gebundene Sozialordnung der Feudalgesellschaft wird durch die Französische Revolution zerstört. Das Individuum ist mit Menschenrechten ausgestattet, ist für sich selbst verantwortlich und als Staatsbürger zur politischen Mitbestimmung befähigt. An die Stelle der unveränderlichen Weltordnung treten die auf ständige Veränderung und Selbstverantwortung beruhende demokratische Ordnung und der Pluralismus. An der Verwirklichung arbeiten wir noch heute. -

Literat 2008 50 5 Galutine.P65
ISSN 0258–0802. LITERATÛRA 2008 50(5) EINE FRAU IN DER KULTUR, DIE KULTUR EINER FRAU: CAROLINE VON HUMBOLDT Elýbieta M. Kowalska Dozentin, Institut für Germanistik, Universität Rzeszów „Karoline von Humboldt, die Mutter, ist eine weiterhin bei Caroline „das schöne, Geist und jener seltenen Frauen, auf deren Art Deutsch- Liebe blickende Auge [...], die kastanien- land unter allen mir bekannten Nationen braunen Haare [...], die Wangen [...] frisch vielleicht einzig das Recht hat, stolz zu sein. gerötet und den so ausdrucksvollen feinen Kenntnisreich in einem Grade, daß sie nur für Mund vom frohen, oft so reizend mutwilligen eine Gelehrte gehalten zu sein, wollen dürfte; Lächeln umspielt [...].“3 Friedrich Schiller einen Verstand besitzend, der die Region nennt sie „ein unvergleichliches Geschöpf“ männlichen Ernstes und männlicher Um- und „lieblichen Genius“4. fassungskraft so erreicht, daß nur liebens- Die Gattin Wilhelm von Humboldts, des würdige Weiblichkeit es uns verbirgt, wie Staatsmannes und Sprachphilosophen, Schwä- bedeutend die Eroberungen auf diesem streng gerin des Forschers Alexander von Humboldt, von den Herren der Welt bestrittenen Boden schien also von ihren Zeitgenossen als eine seien; mit einem Sinn für das Höchste und außerordentliche Persönlichkeit wahrge- Schönste in Poesie und Kunst begabt, wie ihn nommen zu werden.5 der Himmel nur seinen Lieblingen verleiht; dazu kommt eine Persönlichkeit, welche diese 3 Ebd., 7. 4 seltenen Gaben des Geistes [...] mit dem Friedrich Schiller schreibt an seine spätere Frau Charlotte über Caroline: „Mit ihrem lichtvollen Blicke gewinnendsten Ausdruck einer Herzensgüte beleuchtet sie mir meine eigene Seele. Sie ist mir ein vereinigt...“1, so beschreibt die dänische lieblicher Genius, der selbst glücklich um den Schriftstellerin Friederike Brun die Glücklichen schwebt...“ (Hettler, 2001, 40, vgl., Gustav Sichelschmidt, Caroline von Humboldt: Ein Frauenbild „Stammutter einer der edelsten Familien aus der Goethezeit, Düsseldorf: Droste, 1989, 8). -

On the Diversity of Human Languages Constructions... Spain and The
Hannah Lotte Lund On the Diversity of Human Languages Constructions... Spain and the Spaniards in the Travel Writings of Alexander, Wilhelm and Caroline von Humboldt and their Reflections in the Berlin Republic of Letters Around 1800 The objects with which we are acquainted only by the animated narra tives of travellers, have a particular charm; imagination wanders with de light over what is vague and undefined. Alexander von Humboldt 18181 One must have a special intention or, like me, must be thrown into this country by coincidence, to find this end of the world particular interest ing. Wilhelm von Humboldt 1799 The starting point for this research were the intellectual networks of 18th century Berlin and especially the Jewish Salons with their multi ple inner-German and international connections. Given the often stated renewed interest in Spain among German intellectuals around 1800 and the high level of intellectual exchange in the city of Berlin, which called itself the capital of Enlightenment, one might have as sumed, and also my “imagination wandered with delight” over the idea, that quite a number of the members of the Berlin Republic of Letters at that time would have dealt considerably with Spain. In short, they did not. Despite quite a few personal bonds to the Iberian Peninsula, the Berlin intellectual elite around 1800 gave Spain not much of a debate. Among those few who dealt with this part of Europe academically, were Wilhelm, Alexander and Caroline von Humboldt, who went to Spain on different motives around 1800 - years before the War of Independence brought Spain back to the mind 1 All translations in this text are my own - H.L.L. -
Beiträge Zur Humboldt'schen Familienchronik, Literatur Und
Beiträge zur Humboldt’schen Familienchronik, Literatur und deutschen Sprache Abhandlungen der Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung e.V. Band 28, Oktober 2011 Beiträge zur Humboldt’schen Familienchronik, Literatur und deutschen Sprache Abhandlungen der Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung e.V. Band 28, Oktober 2011 001_008_Vorspann.indd 1 30.09.11 09:31 001_008_Vorspann.indd 2 30.09.11 09:31 Beiträge zur Humboldt’schen Familienchronik, Literatur und deutschen Sprache mit Beiträgen von Boleslaw Andrzejewski, Johann Christoph Bürgel, Udo von der Burg, Inge Brose-Müller, Heidelore Kneffel, Peter Korneffel, Walter Krämer, Hans-Jürgen Radam und Franz Simmler Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung e.V. 001_008_Vorspann.indd 3 30.09.11 09:31 Die Beiträge geben ausschließlich die Meinung der Verfasser wieder. BibliograÀ sche Informationen der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen NationalbibliograÀ e; detaillierte bibliograÀ sche Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung e.V., Mannheim ISBN: 978-3-940456-33-5 Copyright 2011 by Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung e.V. Sitz Mannheim Jede Art der Vervielfältigung und Wiedergabe ist untersagt. Redaktion: Prof. Dr. Dr. Dagmar Hülsenberg, Ilmenau Layout, Druck und Verlag: TZ-Verlag & Print GmbH, 64380 Roßdorf www.edition-tz.de www.tz-verlag.de 001_008_Vorspann.indd 4 30.09.11 09:31 -

Von Humboldt BERLIN COSMOS
Wilhelm and Alexander von Humboldt BERLIN COSMOS edited by Paul Spies, Ute Tintemann, and Jan Mende WIENAND 114 16. FLORA – The Plants CONTENTS 118 17. FAUNA – The Bird 122 18. THE PHILOSOPHY OF LANGUAGE – The Desk 128 19. AMERICA – The Dictionary 132 20. EGYPT – The Lion-Headed Goddess 136 21. URANIA – The Meridian Circle 7 PREFACE 140 22. GENDER CHARACTER – The Genius ESSAYS IMPACT 11 I The Brothers Wilhelm & Alexander von Humboldt 148 23. RESONANCE SPACE – The Cosmos Lectures 19 II Wilhelm & Alexander von Humboldt or: 152 24. REPRESENTATION – The Statue Humboldtian Science 156 25. TRANSFER OF KNOWLEDGE – The Model 25 III The Glow of the Exhibits. 160 26. TRANSLATING – Greek The Humboldt Brothers’ Museum Concepts MONUMENTS PLACES 166 27. CONFERENCE – The Medal 36 1. PANORAMA – Berlin Scholars 170 28. HONOURS AND DISTINCTIONS – 40 2. SPREE-ATHENS – The Horse’s Head The New Orders and Ceremonies 46 3. SALON – Hebe 174 29. CONVERSATION – The Knoblauchhaus 50 4. THE ROYAL HOUSE – The Key 180 30. POSTHUMOUS FAME – Humboldt Places 54 5. MUSEUM – The Horse Tamers 58 6. THE ACADEMY – The Clock 64 7. UNIVERSITY – The Building ESTATES 189 I The Humboldt-Collection Hein in the Stadtmuseum Berlin LIFE 192 II Alexander von Humboldt’s personal papers collection in the Staatsbibliothek zu Berlin – 72 8. EVERYDAY LIFE – The Bed Preußischer Kulturbesitz – The Travel Journals 78 9. FAMILY – The Sculpture 196 III The Linguistic Estate of Wilhelm von Humboldt in 82 10. TEGEL – The Gallery of Antiquities the Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 88 11. BERLINER – The Death Mask APPENDIX COLLECTIONS AND RESEARCH 202 Annotations 94 12. -
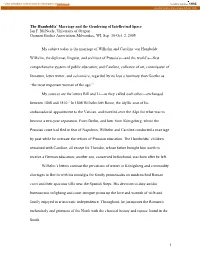
1 the Humboldts' Marriage and the Gendering of Intellectual Space Ian
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by University of Oregon Scholars' Bank The Humboldts’ Marriage and the Gendering of Intellectual Space Ian F. McNeely, University of Oregon German Studies Association, Milwaukee, WI, Sep. 30-Oct. 2, 2005 My subject today is the marriage of Wilhelm and Caroline von Humboldt: Wilhelm, the diplomat, linguist, and architect of Prussia’s—and the world’s—first comprehensive system of public education; and Caroline, collector of art, connoisseur of literature, letter writer, and salonnière, regarded by no less a luminary than Goethe as “the most important woman of the age.”1 My sources are the letters Bill and Li—as they called each other—exchanged between 1808 and 1810.2 In 1808 Wilhelm left Rome, the idyllic seat of his ambassadorial appointment to the Vatican, and traveled over the Alps for what was to become a two-year separation. From Berlin, and later from Königsberg, where the Prussian court had fled in fear of Napoleon, Wilhelm and Caroline conducted a marriage by post while he oversaw the reform of Prussian education. The Humboldts’ children remained with Caroline, all except for Theodor, whose father brought him north to receive a German education; another son, conceived beforehand, was born after he left. Wilhelm’s letters contrast the privations of winter in Königsberg and commodity shortages in Berlin with his nostalgia for family promenades on sundrenched Roman corsi and their spacious villa near the Spanish Steps. His devotion to duty amidst bureaucratic infighting and court intrigue points up the love and warmth of wife and family enjoyed in aristocratic independence. -

1 the Humboldts' Marriage and the Gendering of Intellectual Space Ian
The Humboldts’ Marriage and the Gendering of Intellectual Space Ian F. McNeely, University of Oregon German Studies Association, Milwaukee, WI, Sep. 30-Oct. 2, 2005 My subject today is the marriage of Wilhelm and Caroline von Humboldt: Wilhelm, the diplomat, linguist, and architect of Prussia’s—and the world’s—first comprehensive system of public education; and Caroline, collector of art, connoisseur of literature, letter writer, and salonnière, regarded by no less a luminary than Goethe as “the most important woman of the age.”1 My sources are the letters Bill and Li—as they called each other—exchanged between 1808 and 1810.2 In 1808 Wilhelm left Rome, the idyllic seat of his ambassadorial appointment to the Vatican, and traveled over the Alps for what was to become a two-year separation. From Berlin, and later from Königsberg, where the Prussian court had fled in fear of Napoleon, Wilhelm and Caroline conducted a marriage by post while he oversaw the reform of Prussian education. The Humboldts’ children remained with Caroline, all except for Theodor, whose father brought him north to receive a German education; another son, conceived beforehand, was born after he left. Wilhelm’s letters contrast the privations of winter in Königsberg and commodity shortages in Berlin with his nostalgia for family promenades on sundrenched Roman corsi and their spacious villa near the Spanish Steps. His devotion to duty amidst bureaucratic infighting and court intrigue points up the love and warmth of wife and family enjoyed in aristocratic independence. Throughout, he juxtaposes the Romantic melancholy and grimness of the North with the classical beauty and repose found in the South. -

FRIEDRICH GENTZ, 1764-1832 a Dissertation Presented to The
BETWEEN THE OLD AND THE NEW: FRIEDRICH GENTZ, 1764-1832 A Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy by TRAVIS EAKIN Dr. Jonathan Sperber, Dissertation Supervisor MAY 2019 The undersigned, appointed by the Dean of the Graduate School, have examined the dissertation entitled BETWEEN THE OLD AND THE NEW: FRIEDRICH GENTZ, 1764-1832 Presented by Travis Eakin A candidate for the degree of Doctor of Philosophy And hereby certify that in their opinion it is worthy of acceptance: _____________________________________________________________ Professor Jonathan Sperber, Chair _____________________________________________________________ Professor Ilyana Karthas _____________________________________________________________ Professor Robert Smale _____________________________________________________________ Professor John Frymire _____________________________________________________________ Professor Sean Franzel Acknowledgements This project would not have been possible without the commentary, input, and support of a number of people along the way. The first and one of the oldest debts I owe is to my undergraduate advisor at Southeast Missouri State University, Dr. David Cameron. His insight and wit made history come alive for me, as it did for many others, and encouraged me to think I too might be able to make a mark in the field. I am proud to consider myself a part of his scholarly legacy. I was first encouraged to look into Friedrich Gentz as a possible dissertation subject by Professor Barbara Hahn, of the German Studies Department at Vanderbilt University, after a conference in 2012. Clearly our conversation stayed with me over the years, and I am very grateful for her suggestion. At the University of Missouri, there are a whole host of individuals I want to thank. -

* 11. Oktober 1796 in Hannover; † 24. August 1857 in Rom
1 www.kuenstlerleben-in-rom.de NAMENSREGISTER ZU „KÜNSTLERLEBEN IN ROM“ AUGUST WILHLEM AHLBORN (* 11. Oktober 1796 in Hannover; † 24. August 1857 in Rom). Er trat 1819 in die Berliner Kunstakademie ein, war dort Schüler von Wach und Schinkel; 1827 ging er nach Rom und war dort Mitbegründer des Römischen Kunstvereins. JOHANN CARL BAEHR (* 18. August 1801 in Riga; † 29. September 1869 in Dresden). 1823 war er Schüler Matthaeis an der Kunstakademie in Dresden. Von 1827 bis 1828 war er in Rom und stand dort in Beziehung zu Koch, Reinhart, Thorvaldsen, Cornelius, und besonders zu Führich. 1829 kehrte er nach Riga zurück, war aber von 1834 bis 1835 erneut in Italien. 1840 war er Professor an der Kunstakademie in Dresden. CARL BARTH (* 12. Oktober 1787 in Eisfeld; † 12. September 1853 in Kassel). Carl Barth absolvierte zunächst eine Lehre als Goldschmied bei seinem Vater in Hildburghausen. Ab 1805 bildete er sich unter Johann G. von Müller in Stuttgart zum Kupferstecher aus und besuchte ab 1814 die Kunstakademie in München. Während seiner Romreise von 1817 bis 1819 lernte er den Dichter Friedrich Rückert kennen, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband. Ab 1820 lebte er meist in Hildburghausen. Dort arbeitete er vor allem für das Bibliographische Institut von Joseph Meyer und schuf Stahlstiche zu "Galerie der Zeitgenossen", "Klassikerreihe" und "Conversationslexikon". POMPEO GIROLAMO BATONI (* 5. Februar 1708 in Lucca; † 4. Februar 1787 in Rom). Batoni, ein Schüler Sebastiano Concas und Agostino Masuccis, durch Kaiser Joseph II. in den Adelstand erhoben, wurde in seiner Zeit sehr hoch geschätzt und in eine Linie mit Anton Raphael Mengs gestellt.