Diptera, Simuliidae) in Der Schweiz
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
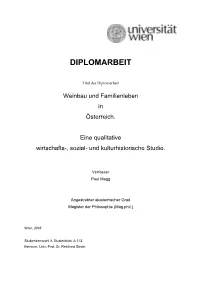
Dip Arbeit Fertig4
DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Weinbau und Familienleben in Österreich. Eine qualitative wirtschafts-, sozial- und kulturhistorische Studie. Verfasser Paul Magg Angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag.phil.) Wien, 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 312 Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Reinhard Sieder INHALTSVERZEICHNIS Vorwort Einleitung………………………………………………………………………………...…….5 ALLGEMEINER HISTORIOGRAPHISCHER TEIL Die Geschichte des Weinbaus in Österreich……………………...……………………………8 Die Grundlagen der österreichischen Weinwirtschaft……………………..............................37 Die Weinbauregionen in Österreich………………………………..............................39 Die Rebsorten und ihre Geschichte…………………………………………………...44 Die Qualitätsstufen des Österreichischen Wein……………………………………. 75 Das Jahr im Weingarten und die Weinbereitung ……………………………………. 80 2 SPEZIELLER ASPEKTE - TEIL Die Geschichte des Weinbaus im Burgenland………………………………………….... 108 Das Weinbaugebiet Neusiedl am See……………………………………………….…..... 123 Das Klima und die Lage………………………………………………………….. 126 Die Geschichte des Weinbaus in Weiden am See………………………………………... 127 Der Fall Millner: Analyse der Familiengeschichte einer Winzerfamilie in Weiden am See………………………………………..………..... 131 Zusammenfassung……………………………………………………………………….. 150 Literaturverzeichnis……………………………………………………………………… 156 Bild und Grafiknachweis…………………………………………………………………. 161 Anhang…………………………………………………………………………………… 168 Transkripotionen der geführten Interviews………………………………………. 169 Abstract…………………………………………………………………………… 333 Lebenslauf………………………………………………………………………… -

Download (9MB)
Beiträge zur Hydrologie der Schweiz Nr. 39 Herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für Hydrologie und Limnologie (SGHL) und der Schweizerischen Hydrologischen Kommission (CHy) Daniel Viviroli und Rolf Weingartner Prozessbasierte Hochwasserabschätzung für mesoskalige Einzugsgebiete Grundlagen und Interpretationshilfe zum Verfahren PREVAH-regHQ | downloaded: 23.9.2021 Bern, Juni 2012 https://doi.org/10.48350/39262 source: Hintergrund Dieser Bericht fasst die Ergebnisse des Projektes „Ein prozessorientiertes Modellsystem zur Ermitt- lung seltener Hochwasserabflüsse für beliebige Einzugsgebiete der Schweiz – Grundlagenbereit- stellung für die Hochwasserabschätzung“ zusammen, welches im Auftrag des Bundesamtes für Um- welt (BAFU) am Geographischen Institut der Universität Bern (GIUB) ausgearbeitet wurde. Das Pro- jekt wurde auf Seiten des BAFU von Prof. Dr. Manfred Spreafico und Dr. Dominique Bérod begleitet. Für die Bereitstellung umfangreicher Messdaten danken wir dem BAFU, den zuständigen Ämtern der Kantone sowie dem Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz). Daten Die im Bericht beschriebenen Daten und Resultate können unter der folgenden Adresse bezogen werden: http://www.hydrologie.unibe.ch/projekte/PREVAHregHQ.html. Weitere Informationen erhält man bei [email protected]. Druck Publikation Digital AG Bezug des Bandes Hydrologische Kommission (CHy) der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (scnat) c/o Geographisches Institut der Universität Bern Hallerstrasse 12, 3012 Bern http://chy.scnatweb.ch Zitiervorschlag -

Contrasting Sediment Flux in Val Lumnezia
1661-8726/09/020211-12 Swiss J. Geosci. 102 (2009) 211–222 DOI 10.1007/s00015-009-1320-6 Birkhäuser Verlag, Basel, 2009 Contrasting sediment flux in Val Lumnezia (Graubünden, Eastern Swiss Alps), and implications for landscape development MARCO SCHWAB 1, 2, FRITZ SCHLUNEGGER 1, HEINZ SCHNEIDER 1, GREGOR STÖCKLI 1, 3 & DIRK RIEKE-ZAPP 1 Key words: landslide, Alps, monitoring, geomorphology, drainage basin development ABSTRACT This paper presents qualitative estimates of sediment discharge from opposite magnitudes of sediment discharge on the eastern tributaries than on the west- valley flanks in the S–N-oriented Val Lumnezia, eastern Swiss Alps, and re- ern valley side, where landsliding has been the predominant erosional process. lates inferred differences in sediment flux to the litho-tectonic architecture of These differences are interpreted to be controlled by the dip-slope situation of bedrock. The valley flank on the western side hosts the deep-seated Lumnezia bedrock on the western side that favours down-slope slip of material. landslide where an area of ca. 30 km2 has experienced slip rates of several Morphometric investigations reveal that the western valley side is char- centimetres per year, potentially resulting in high sediment discharge to the acterized by a low topographic roughness because this valley flank has not trunk stream (i.e. the Glogn River). High slip rates have resulted in topo- been dissected by a channel network. It appears that high sediment discharge graphic changes that are detectable on aerial photographs and measurable of the Lumnezia landslide has inhibited the establishment of a stable channel with geodetic tools. -
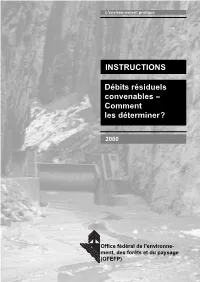
Débits Résiduels Convenables -- Comment Les Déterminer?
L'environnement pratique INSTRUCTIONS Débits résiduels convenables -- Comment les déterminer? 2000 Office fédéral de l'environne- ment, des forêts et du paysage (OFEFP) L'environnement pratique INSTRUCTIONS Débits résiduels convenables -- Comment les déterminer? 2000 Publié par l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) Auteurs R. Estoppey, OFEFP, Berne Dr. B. Kiefer, Kiefer & Partners AG, Zurich M. Kummer, OFEFP, Berne S. Lagger, OFEFP, Berne H. Aschwanden, SHGN, Berne (chap. 7) Traduction B. Bressoud, Ardon Commande Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage Documentation 3003 Berne Fax + 41 (0)31 324 02 16 E-mail: [email protected] Internet: http://www.admin.ch/buwal/publikat/f/ Numéro de commande VU-2701-F © OFEFP 2000 Table des matières 3 TABLE DES MATIÈRES $9$17352326 ,1752'8&7,21 1.1 GÉNÉRALITÉS..................................................................................................................................7 1.2 OBJECTIF ET PRINCIPES DE LA FIXATION DE DÉBITS RÉSIDUELS CONVENABLES ......8 1.3 BASES LÉGALES..............................................................................................................................8 1.4 LE SYSTÈME DES DISPOSITIONS DE LA LEAUX SUR LES DÉBITS RÉSIDUELS................10 /¶$8725,6$7,21'(35e/Ê9(0(17'¶($8 2.1 PRÉLÈVEMENTS D’EAU SOUMIS À AUTORISATION ............................................................13 2.2 CONDITIONS POUR L’OCTROI DE L’AUTORISATION ...........................................................19 -

Flood Magnitude-Frequency Analyses and Sediment Transport
Edinburgh Research Explorer Lateral sediment sources and knickzones as controls on spatio- temporal variations of sediment transport in an Alpine river Citation for published version: Bekaddour, T, Schlunegger, F, Attal, M, Norton, KP & Föllmi, K (ed.) 2013, 'Lateral sediment sources and knickzones as controls on spatio-temporal variations of sediment transport in an Alpine river', Sedimentology, vol. 60, no. 1, pp. 342-357. https://doi.org/10.1111/sed.12009 Digital Object Identifier (DOI): 10.1111/sed.12009 Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Peer reviewed version Published In: Sedimentology Publisher Rights Statement: The final published version is available online at www.interscience.wiley.com copyright of Wiley-Blackwell (2013). General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 24. Sep. 2021 This is an author final draft or ‘post-print’ version. The final version of this article was published in Sedimentology by Wiley Blackwell. © 2013 The Authors. Journal compilation © 2013 International Association of Sedimentologists. Cite As: Bekaddour, T, Schlunegger, F, Attal, M, Norton, KP & Föllmi, K (ed.) 2013, 'Lateral sediment sources and knickzones as controls on spatio-temporal variations of sediment transport in an Alpine river' Sedimentology, vol 60, no. -

Water Management in Vorarlberg, in Alpine Rhine and Lake Constance Basin
Skadar/Shkodra Lake Commission 17.11.2009 Water management in Vorarlberg, in Alpine Rhine and Lake Constance basin Thomas Blank State governement of Vorarlberg Unit for water management Vorarlberg, Lake Constance, Alpine Rhine Rheinspitz Rohrspitz Rheinmündung BregenzThomas Blank, Unit for water management 1 Content 1 Water management in Vorarlberg 2 International water management in the basin of Lake Constance 3 Alpine Rhine -International water management 4 International Commission for the Protection of Lake Constance IGKB 5 EU water framework directive Thomas Blank, Unit for water management Catchment areas in Europe Thomas Blank, Unit for water management 2 Rhine basin Thomas Blank, Unit for water management River-basins of Vorarlberg Thomas Blank, Unit for water management 3 Amount of water in Vorarlberg Precepitation/year: 1900 mm „Burgenland“ „Vorarlberg“ „Burgenland“Quelle: Wasserland Bayern, Bayer. Staatsministe rium f ü r Landesentwicklung „V undorarlberg“ Umweltfragen Quelle: Wasserland Bayern, Bayer. Staatsministerium f ür Landesentwicklung und Umweltfragen Thomas Blank, Unit for water management Water-balance of Vorarlberg Water-supply: 1 % of precepitation Verbrauch 5 Werte in Mio m³/Jahr Thomas Blank, Unit for water management 4 Monitoring Surface water monitoring Legaly binding program for quality an quantity (precipitation, discharge) Thomas Blank, Unit for water management Monitoring Groundwater monitoring Legaly binding program for quality an quantity Thomas Blank, Unit for water management 5 Water-supply 70 % Groundwater -

(Cottus Gobio) En Suisse
L’environnement pratique INFORMATIONS CONCERNANT LA PÊCHE N° 77 Biologie, menaces et protection du chabot (Cottus gobio) en Suisse Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage OFEFP L’environnement pratique INFORMATIONS CONCERNANT LA PÊCHE N° 77 Biologie, menaces et protection du chabot (Cottus gobio) en Suisse Mit deutscher Zusammenfassung Con riassunto in italiano Publié par l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage OFEFP Berne, 2004 Valeur juridique de cette publication La présente publication est une aide à l'exécution éla- borée par l'OFEFP en tant qu'autorité de surveillance. Destinée en premier lieu aux autorités d'exécution, elle concrétise des notions juridiques indéterminées prove- nant de lois et d'ordonnances et permet ainsi une appli- cation uniforme de la législation. Les aides à l'exécution (appelées aussi directives, instructions, recommanda- tions, manuels, aides pratiques) paraissent dans la collection « L'environnement pratique ». Ces aides à l'exécution garantissent l'égalité devant la loi ainsi que la sécurité du droit, tout en favorisant la recherche de solutions adaptées aux cas particuliers. Si l'autorité en tient compte, elle peut partir du principe que ses décisions seront conformes au droit fédéral. D'autres solutions ne sont pas exclues; selon la juris- prudence, il faut cependant prouver leur conformité avec le droit en vigueur. Editeur Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) L’OFEFP est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) Auteurs Stephane Zbinden, Jean-Daniel Pilotto et Valérie Durouvenoz GREN, Biologie appliquée Sàrl, Genève [email protected] Couverture Photo Michel Roggo, Fribourg Commande Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, Documentation CH–3003 Berne Fax + 41 (0)31 324 02 16 E-mail: [email protected] Internet: www.buwalshop.ch Numéro de commande MFI-77-F © OFEFP 2004 Table des matières Inf. -

Förderung Der Litho-Rheophilen Fischarten Der Schweiz
Förderung der litho-rheophilen Fischarten der Schweiz - Factsheets zu Biologie und Förderungsmassnahmen - Bericht im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt, Bern Dezember 2010 WFN - Wasser Fisch Natur Dr. Arthur Kirchhofer Murtenstrasse 52 3205 Gümmenen 031/751’18’74 [email protected] Bearbeitung: Martina Breitenstein, Arthur Kirchhofer Impressum (überarbeitete Version 2014): Autoren: Martina Breitenstein, Arthur Kirchhofer (WFN - Wasser Fisch Natur) Fachliche Begleitung: Daniel Hefti (BAFU) Begleitgruppe: Andreas Hertig (Fischerei- und Jagdverwaltung des Kantons Zürich) Armin Peter (EAWAG) Bruno Polli (Servizio cantonale della caccia e pesca Ticino) Thomas Vuille (Fischereiinspektorat des Kantons Bern) Jean-Daniel Wicky (Service des forêts et de la faune Fribourg) Fotos Fischbilder: Michel Roggo Foto M05: Daniel Zopfi Foto M09: Jagd & Fischerei Kanton Aargau Restliche Fotos: Martina Breitenstein, Arthur Kirchhofer WFN 02.14 «Förderung der litho-rheophilen Fischarten der Schweiz» BAFU WFN 2010 Inhalt Einleitung 1 Aufbau der Factsheets 2 Factsheets A) Fischarten - Bachforelle (inkl. Doubs- und Adriatische Forelle) A-01 - Seeforelle / Trota marmorata A-02 - Äsche A-03 - Nase A-04 - Barbe / Südbarbe A-05 - Hundsbarbe A-06 - Schneider A-07 - Strömer / Südströmer A-08 - Groppe A-09 - Rhonestreber, Apron A-10 - Bachneunauge A-11 B) Massnahmen Ufer / Habitatdiversität - Flachwasserzonen M-01 - Raubäume M-02 - Belebungssteine M-03 Längsvernetzung - Blockrampe M-04 - Umgehungsgewässer M-05 - Raugerinne-Beckenpass M-06 - Technischer Fischpass M-07 Gewässersohle - Kiesschüttung M-08 - Kieslockerung M-09 Population - Stützbesatz M-10 - Wiederansiedlung M-11 WASSER FISCH NATUR WFN 02.14 WFN 02.14 «Förderung der litho-rheophilen Fischarten der Schweiz» BAFU WFN 2010 Einleitung Die litho-rheophilen Fischarten sind strö- weisen zu Schutz- und Förderungsmassnah- mungsliebend und benötigen für ihre Fort- men zu erstellen. -

Contrasting Sediment Flux in Val Lumnezia (Graubünden, Eastern Swiss Alps), and Implications for Landscape Development
1661-8726/09/020211-12 Swiss J. Geosci. 102 (2009) 211–222 DOI 10.1007/s00015-009-1320-6 Birkhäuser Verlag, Basel, 2009 Contrasting sediment flux in Val Lumnezia (Graubünden, Eastern Swiss Alps), and implications for landscape development MARCO SCHWAB 1, 2, FRITZ SCHLUNEGGER 1, HEINZ SCHNEIDER 1, GREGOR STÖCKLI 1, 3 & DIRK RIEKE-ZAPP 1 Key words: landslide, Alps, monitoring, geomorphology, drainage basin development ABSTRACT This paper presents qualitative estimates of sediment discharge from opposite magnitudes of sediment discharge on the eastern tributaries than on the west- valley flanks in the S–N-oriented Val Lumnezia, eastern Swiss Alps, and re- ern valley side, where landsliding has been the predominant erosional process. lates inferred differences in sediment flux to the litho-tectonic architecture of These differences are interpreted to be controlled by the dip-slope situation of bedrock. The valley flank on the western side hosts the deep-seated Lumnezia bedrock on the western side that favours down-slope slip of material. landslide where an area of ca. 30 km2 has experienced slip rates of several Morphometric investigations reveal that the western valley side is char- centimetres per year, potentially resulting in high sediment discharge to the acterized by a low topographic roughness because this valley flank has not trunk stream (i.e. the Glogn River). High slip rates have resulted in topo- been dissected by a channel network. It appears that high sediment discharge graphic changes that are detectable on aerial photographs and measurable of the Lumnezia landslide has inhibited the establishment of a stable channel with geodetic tools. -

Master Plan Migratory Fish Rhine
Master Plan Migratory Fish Rhine Report No. 179 Imprint Publisher: International Commission for the Protection of the Rhine (ICPR) Kaiserin-Augusta-Anlagen 15, D 56068 Koblenz P.O. box 20 02 53, D 56002 Koblenz Telephone +49-(0)261-94252-0, Fax +49-(0)261-94252-52 Email: [email protected] www.iksr.org ISBN 978-3-941994-09-6 © IKSR-CIPR-ICBR 2009 Report 179e.doc Internationale Kommission zum Schutz des Rheins International Commission for the Protection of the Rhine Commission Internationale pour la Protection du Rhin Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn Master Plan Migratory Fish Rhine ICPR report no. 179 1. Initial conditions ..................................................................................... 2 2. Background............................................................................................ 3 3. Already implemented measures for anadromous migratory fish...................... 5 4. Measures planned for anadromous migratory fish in the different sections of the Rhine.................................................................................................... 6 4.1 River Continuity and Habitats...................................................................... 6 4.1.1 Delta Rhine............................................................................................ 6 4.1.2 Lower Rhine........................................................................................... 7 4.1.3 Middle Rhine ......................................................................................... -

Beiträge Zur Gallo-Keltischen Namenkunde
Beiträge zur gallo-keltisch Namenkunde Quirin Esser I s Ii* Beiträge AI zur gallo -kellischeu tacukuode. HS Von i Dr. Quirin Esser. I. Heft Im Selbstverläge des Verfassers. Malznedy, 1884. l I I Druck von J. D o e p g e n in St. Vith (Eifcl). i o ' / Ii L.iyui/cd by Google d by Google Beiträge zur gallo -kelUscheu Alameukiiudc. Von l>r. Quirin JBwer, ^ \ I. Heft. \...^'^ ' -/ ' Im Selbstverläge des VerfaworSy Malmedy, 1884^ Bruck von ^f. D 0 e p g e ü iix SU Villi (Eifel). Druckfehler : S. 28, Z. 10 V. o. lies Mayen statt Kayen. S. 43, Z. 17 V. t). lies *Eposius st. *Fposiu.s. S. 48, Z. 9 T. u. lies Coimbra st. Coimbm. S. 54, Z. d Y. u. lies Ciiito-pennius st. Cunu-pennins. S. 57, Z. 4 V. o. ist nach KC. III 305 die Scliluss- kiannner ausgelassen. S. 71, Z. 8 V. u. ist zwischen -holländische" und „zu.** eine Schlussklammer zu ergänzen. S. 88, Z. 7 V. u. lies8)Argo-gilumstatt8) Argo-gilnm. « Uigiiizeü by Google : Verzeiehniss der benutzten Literatur und der Abkürzungen Boll. Acta sanotoi iim i ollegit J. IJollaiifliis. lir. Brambach: Cuipus inscriptioiium iilieuairnMinj. BUB. Beyer: Mitteirlieinisclies Urkuudenbucij* aBüDdo. Coblenz 1860-^74. CBG, Caesaris commentarii do hello Gallico. Fick, Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. 3. Auüage. 4 Biindc. F. I und IL Förstemann: Altdeutsches Namenbuch. 1. Band: Personennamen; 2. Band: Ortsnamen, zweite Bearbeitung. Glück L 2, 3, 1 : Die Bisthümer Noric ams ; 2 : Die bei Cäsar vorkommenden keltischen Namen ; 3 : Renos^ Moinos und Mogontiacon. HIB, Hübner: Inscriptiones Britanniae Latinae. -

International Water Management at Lake Constance
International Water Management at Lake Constance H. G. Schröder Institut für Seenforschung Langenargen Lake Constance… …made by ice and water…15,000 years BP… Hans Strobl: Vorarlberger Naturschau • Altitude a.s.l. 395 m • Total surface area 535 km 2 • Maximum depth 254 m • Volume 49 km 3 •Length of shoreline 273 km • Overall length 63 km • Overall width 14 km • Catchment area 11 500 km 2 • Mean outflow ca. 370 m 3/s …determined by man since 10,000 years BP… from: Otto Hauser (1921) Leben und Treiben zur Urzeit • 1,500,000 people living in the catchment area of the lake • Local industry (engines, aircraft- and spacecraft equipment) and agriculture (hop, apple trees, vineyards) together with the inhabitants discharge sewage water equivalent to 3,200,000 people • Until the early 1970s the major part of sewage entered the lake without any treatment • Major tourist area in Germany • More than 2,500,000 visitors per year • 55,000 boats registered at the lake • Severe structural changes (land use for roads,parking, harbous, houses etc.) • Additional water pollution • Drinking water source for more than 4 million people (drinking water pumped at 25 sites at depth > 30m) • 170,000,000 m³ water / year = less than 2% of annual outflow • Water export from largest drinking water plant in Sipplingen via pipeline network to 500 cities and villages in Southern Germany “The boundaries between countries result from historical events, and, therefore, they do not coincide with the boundaries of the watersheds. As a consequence, several lakes and rivers mark the boundaries between countries or cross them.