Das Mundaneum Oder Das Papierne Internet Von Paul Otlet Und Henri La Fontaine 2012
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
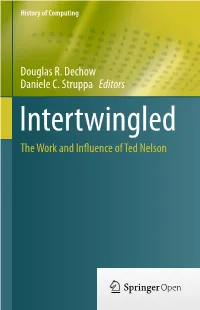
Ted Nelson History of Computing
History of Computing Douglas R. Dechow Daniele C. Struppa Editors Intertwingled The Work and Influence of Ted Nelson History of Computing Founding Editor Martin Campbell-Kelly, University of Warwick, Coventry, UK Series Editor Gerard Alberts, University of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands Advisory Board Jack Copeland, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand Ulf Hashagen, Deutsches Museum, Munich, Germany John V. Tucker, Swansea University, Swansea, UK Jeffrey R. Yost, University of Minnesota, Minneapolis, USA The History of Computing series publishes high-quality books which address the history of computing, with an emphasis on the ‘externalist’ view of this history, more accessible to a wider audience. The series examines content and history from four main quadrants: the history of relevant technologies, the history of the core science, the history of relevant business and economic developments, and the history of computing as it pertains to social history and societal developments. Titles can span a variety of product types, including but not exclusively, themed volumes, biographies, ‘profi le’ books (with brief biographies of a number of key people), expansions of workshop proceedings, general readers, scholarly expositions, titles used as ancillary textbooks, revivals and new editions of previous worthy titles. These books will appeal, varyingly, to academics and students in computer science, history, mathematics, business and technology studies. Some titles will also directly appeal to professionals and practitioners -
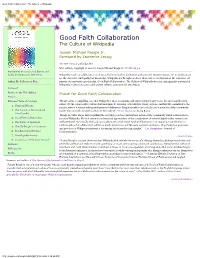
The Culture of Wikipedia
Good Faith Collaboration: The Culture of Wikipedia Good Faith Collaboration The Culture of Wikipedia Joseph Michael Reagle Jr. Foreword by Lawrence Lessig The MIT Press, Cambridge, MA. Web edition, Copyright © 2011 by Joseph Michael Reagle Jr. CC-NC-SA 3.0 Purchase at Amazon.com | Barnes and Noble | IndieBound | MIT Press Wikipedia's style of collaborative production has been lauded, lambasted, and satirized. Despite unease over its implications for the character (and quality) of knowledge, Wikipedia has brought us closer than ever to a realization of the centuries-old Author Bio & Research Blog pursuit of a universal encyclopedia. Good Faith Collaboration: The Culture of Wikipedia is a rich ethnographic portrayal of Wikipedia's historical roots, collaborative culture, and much debated legacy. Foreword Preface to the Web Edition Praise for Good Faith Collaboration Preface Extended Table of Contents "Reagle offers a compelling case that Wikipedia's most fascinating and unprecedented aspect isn't the encyclopedia itself — rather, it's the collaborative culture that underpins it: brawling, self-reflexive, funny, serious, and full-tilt committed to the 1. Nazis and Norms project, even if it means setting aside personal differences. Reagle's position as a scholar and a member of the community 2. The Pursuit of the Universal makes him uniquely situated to describe this culture." —Cory Doctorow , Boing Boing Encyclopedia "Reagle provides ample data regarding the everyday practices and cultural norms of the community which collaborates to 3. Good Faith Collaboration produce Wikipedia. His rich research and nuanced appreciation of the complexities of cultural digital media research are 4. The Puzzle of Openness well presented. -

Systems, Networks, and Webs: History and Theory of Infrastructure
SI 541/741 Prof. Paul N. Edwards University of Michigan, Winter 2008 Monday, 1-4 PM, 311 West Hall Systems, Networks, and Webs: History and Theory of Infrastructure This course offers historical, comparative, and theoretical perspectives on the evolution of major infrastructures from the 19th century to the present. We will focus especially on information infrastructures: the Internet, the World Wide Web, and scientific cyberinfrastructures. To set the stage, we will compare their historical trajectories with those of older transportation, electric power, and communication infrastructures. For example, transportation infrastructures face their most difficult challenges at the interface between different transport modes, as in ports (where shipping connects with trucking and rail) and airports (where air transit connects with automobile, truck, bus, subway, train, and pedestrian modes). These intermodal problems in transport networks find significant parallels in information infrastructures. For example, data conversion (from analog to digital, or from one digital format to another) creates difficult problems for system designers and users; connecting networks built on different standards motivated early Internet research. The course looks at how infrastructures form, how they change, and how they shape (and are shaped by) social systems. A major focus will be the role of standards (e.g. railroad track gauge, alternating current voltages, TCP/IP, HTTP, HTML) and standard-setting bodies in creating “ground rules” for infrastructure development. Concepts such as “technological momentum” (the tendency of large technical systems to become increasingly resistant to change), “load factor” (maximizing the use of available system capacity), and "interdependence" (among components and between connected infrastructures) will be explored. -

Ted Nelson - Curriculum Vitae
Ted Nelson - Curriculum Vitae http://hyperland.com/TNvita TNvita-D40 2011.06.15 Curriculum Vitae: Theodor Holm Nelson, PhD email: tandm[at]xanadu.net Software Designer, Author, "Visionary" Designer-Generalist, The Internet Archive Visiting Professor, University of Southampton CAREER SUMMARY SO FAR: Two main software designs, 8 books, over 50 articles (9 peer-reviewed), numerous academic positions, perhaps 750 former students. Coined various words in some degree of circulation [list at end]. Many believe the World Wide Web was based on my ideas.* My ideas are very different. * See citations in Tim Berners-Lee's original proposal for the Web at http://www.w3.org/History/1989/proposal.html See also Berners-Lee's Weaving the Web (1999 edition), page 5, and hyperland.com/TBLpage. COMPELLING MOTIVATION BEHIND MY WORK: In 1960, I had a unique vision of on- line publishing by the general public and a vast personal computing industry-- but with entirely different structure and spirit from what we see around us now.* I have striven for decades, academically and commercially, to bring about this very different vision. This vision is laboriously detailed in my book Possiplex, as are various possible firsts in my early projects. * See my autobiography, POSSIPLEX. PRINCIPAL DESIGNS ( • BEST-KNOWN DESIGN: the Back Button (HES Project, 1966-7). It's obvious now, but I had to fight for it. ) • MAIN DESIGN 1: Xanalogical hypertext, a radical generalization of documents: unbreaking links to stabilized content, remix with overlays, and quotations connected to their sources. (My particular buildout is called Xanadu®.) Readings and demos listed later. -

An Archaeology of Digital Journalism
ARCHVES MASSACHUSETTS INSTITUTE OF rECHNOLOLGY MAY 14 2015 The Missing Links: LIBRARIES An Archaeology of Digital Journalism by Liam Phalen Andrew B.A., Yale University (2008) Submitted to the Department of Comparative Media Studies/Writing in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Comparative Media Studies at the MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY June 2015 @ Liam Phalen Andrew, MMXV. All rights reserved. The author hereby grants to MIT permission to reproduce and to distribute publicly paper and electronic copies of this thesis document in whole or in part in any medium now known or hereafter created. Signature redacted Author .......................................... Department of Comparative Media Studies/Writing Signature redactedM ay 8, 2015 Certified by........................................ William Uricchio Professor of Comparative Media Studies Thesis Supervisor Signature redacted Accepted by ................ Z-/ T.L. Taylor Director of Graduate Studies, Comparative Media Studies 2 The Missing Links: An Archaeology of Digital Journalism by Liam Phalen Andrew Submitted to the Department of Comparative Media Studies/Writing on May 8, 2015, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Comparative Media Studies Abstract As the pace of publishing and the volume of content rapidly increase on the web, citizen journalism and data journalism have threatened the traditional role of institu- tional newsmaking. Legacy publishers, as well as digital-native outlets and aggrega- tors, are beginning to adapt to this new news landscape, in part by drawing newfound value from archival stories and reusing older works. However, this trend's potential remains limited by technical challenges and institutional inertia. -

World Wide Web - Wikipedia, the Free Encyclopedia
World Wide Web - Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Wide_Web&printabl... World Wide Web From Wikipedia, the free encyclopedia The World Wide Web , abbreviated as WWW and commonly known as The Web , is a system of interlinked hypertext documents contained on the Internet. With a web browser, one can view web pages that may contain text, images, videos, and other multimedia and navigate between them by using hyperlinks. Using concepts from earlier hypertext systems, British engineer and computer scientist Sir Tim Berners Lee, now the Director of the World Wide Web Consortium, wrote a proposal in March 1989 for what would eventually become the World Wide Web. [1] He was later joined by Belgian computer scientist Robert Cailliau while both were working at CERN in Geneva, Switzerland. In 1990, they proposed using "HyperText [...] to link and access information of various kinds as a web of nodes in which the user can browse at will",[2] and released that web in December. [3] "The World-Wide Web (W3) was developed to be a pool of human knowledge, which would allow collaborators in remote sites to share their ideas and all aspects of a common project." [4] If two projects are independently created, rather than have a central figure make the changes, the two bodies of information could form into one cohesive piece of work. Contents 1 History 2 Function 2.1 What does W3 define? 2.2 Linking 2.3 Ajax updates 2.4 WWW prefix 3 Privacy 4 Security 5 Standards 6 Accessibility 7 Internationalization 8 Statistics 9 Speed issues 10 Caching 11 See also 12 Notes 13 References 14 External links History Main article: History of the World Wide Web In March 1989, Tim BernersLee wrote a proposal [5] that referenced ENQUIRE, a database and 1 of 13 2/7/2010 02:31 PM World Wide Web - Wikipedia, the free encyclopedia http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Wide_Web&printabl.. -

Hypertext, Narrative, and the Future of News Writing
HYPERTEXT, NARRATIVE, AND THE FUTURE OF NEWS WRITING By Holly Cowart Approved: __________________________________ __________________________________ Dr. Joe Wilferth Dr. Aaron Shaheen UC Foundation Associate Professor UC Foundation Assistant Professor (Director of Thesis) (Committee Member) __________________________________ __________________________________ Dr. Heather Palmer Dr. Herbert Burhenn Assistant Professor Dean of the College of Arts and Sciences (Committee Member) __________________________________ Dr. Jerald Ainsworth Dean of the Graduate School HYPERTEXT, NARRATIVE, AND THE FUTURE OF NEWS WRITING By Holly Cowart A Thesis Submitted to the Faculty of the University of Tennessee at Chattanooga in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in English The University of Tennessee at Chattanooga Chattanooga, Tennessee May, 2011 ii Copyright © 2011 By Holly Cowart All Rights Reserved iii ABSTRACT This thesis considers how the narrative context in which hypertext has developed offers a solution for transforming print media into an online form. It defines the qualities of the hypertext narrative and looks specifically at how hyperfiction has utilized these qualities. It outlines the aspects of hypertext relevant to shaping an online narrative and then considers how those aspects of hypertext could be applied to one of the forms of narrative, the online news story, that up to this point has not effectively utilized screen-based text. The online news story is an example of words on a screen functioning in much the same way they have for hundreds of years on the newspaper page. This thesis focuses specifically on the application of hypertext theory to online newspaper because of the precarious place in which that media finds itself as it works to adapt to the age of the Internet. -

XANADU's Textemes
Summer-Edition 2017 — vordenker-archive — Rudolf Kaehr (1942-2016) Title XANADU’s textemes Diamond theoretical reflections on hypertextuality Archive-Number / Categories 2_46 & 2_41-13 / K08, K10 Publication Date 2009 Keywords / Topics Polycontexturality, Kenogrammatic, Diamond Approaches, Hypertext Disciplines Cybernetics, Semiotics, Logic, Computer Science Abstract Xanadu is still not yet realized. Nevertheless, it is appropriate, not only to understand its principles and its radical difference to established Web hypertext and multimedia, but to try to think and design even more advanced concepts of non-traditional interactions. One interesting extension of identity-oriented thematizations is opened up by polycontextural, kenogrammatic and diamond approaches to text theory; proposed recently as textemes (or textems). Textemes are based on the interplay of anchored semiotic diamonds and are delivering necessary environments for transclusions. Transclusions and transjunctions are modeled additionally in a polycontextural setting. The characteristics of ‘electronic’ text in contrast to ‘physical’ paper texts are emphasized. Citation Information / How to cite Rudolf Kaehr: "XANADU’s textemes", www.vordenker.de (Sommer Edition, 2017) J. Paul (Ed.), http://www.vordenker.de/rk/rk_Xanadu-s-textemes_2009.pdf Categories of the RK-Archive K01 Gotthard Günther Studies K08 Formal Systems in Polycontextural Constellations K02 Scientific Essays K09 Morphogrammatics K03 Polycontexturality – Second-Order-Cybernetics K10 The Chinese Challenge or A Challenge for China K04 Diamond Theory K11 Memristics Memristors Computation K05 Interactivity K12 Cellular Automata K06 Diamond Strategies K13 RK and friends K07 Contextural Programming Paradigm XANADU-0.3.nb file:///Volumes/KAE-TEXTE/KAE-TEXTS/Short%20Studies/Pub... XANADU’s textemes Diamond theoretical reflections on hypertextuality Rudolf Kaehr Dr.@ ThinkArt Lab Glasgow Abstract Xanadu is still not yet realized. -

Htbrew-D11 === 18.01.11 REPLY TO
HTbrew-D11 === 18.01.11 REPLY TO BREWSTER: Where My Hypertext Ideas Came From, and Where They All Went Theodor Holm Nelson Internet Archive Fellow and Founding Designer, Project Xanadu® Anyone is free to use the designs described below, but but please don't to use the term "Xanadu" for them, which is my registered trademark. Brewster Kahle has recently asked about the origins of my hypertext ideas. He didn't know how big the answer was. To quote the old saying (going back, I understand, to Roman times)-- here is a long piece because I didn't have time to write a short one. Brewster's question is answered, more or less, in the first twenty paragraphs, but I thought it important to continue on and get the record straight. I have tried to make this answer as short as possible, but I needed also to include the context of my other computer ideas and aspirations. (My actual works in other computer areas I put at the end, to be skipped if not interested.) My personal story is deeply interwoven with these ideas, in the same way that Bucky Fuller's story was interwoven with his ideas. However, I won't tell the personal story here, since I have already told it variously, especially in - My autobiography POSSIPLEX available at lulu.com/shop/ted-nelson/possiplex/paperback/product-14925222.html - My book "Literary Machines", available in many forms - the video "Here I Stand", showing at youtube.com/watch?v=mmfjM-SGlGs - my CV (summary of my work to 2011) at hyperland.com/TNvita So this will be a condensed version, concentrating on the aspirations and actual work, with almost none of the personal story-- where I was, jobs, writings, universitites, friends, lovers, griefs, etc. -

The Magical Place of Literary Memory
10/07/2009 The Magical Place of Literary Memory The Magical Place of Literary Memory™: Xanadu Belinda Barnet What I thought would be called Xanadu is called the World Wide Web and works differently, but has the same penetration (Nelson, 1999, interview). It was a vision in a dream. A computer filing system which would store and deliver the great body of human literature, in all its historical versions and with all its messy interconnections, acknowledging authorship, ownership, quotation and linkage. Like the web, but much better: no links would ever be broken, no documents would ever be lost, copyright and ownership would be scrupulously preserved. This vision is actually older than the web, and aspects of it are older than personal computing: it belongs to hypertext pioneer Theodore Holm Nelson, who dubbed the project Xanadu in 1967. The name comes from the famous poem by Samuel Taylor Coleridge, Kubla Khan. In his tale of the poem's origin, Coleridge claimed to have woken from a laudanum-laced reverie with 'two or three hundred' lines of poetry in his head. He had noted down but a few lines when he was interrupted by a visitor, and when he returned to his work later he found that the memories had blurred irretrievably. His mythical landscape, this vision of Xanadu, had passed away 'like the images on the surface of a stream into which a stone had been cast' (Coleridge, cited in Nelson 1987, hereafter DM, p. 142). Like Nelson, Coleridge feared the despotism of the senses and the confusion of senseless memory; he feared memory loss. -
Ted Nelson and the Citation Analysis of His Concept of Hypertext
Ted Nelson ..&.~,t!x#,-.~~~I Jij ~*'f Ted Nelson and the Citation Analysis of His Concept of Hypertext .a~ )=J Ming-yueh Tsay .~*.~ ....... ~~ffl.~ Professor, Graduate Institute of Library, Information and Archival Studies National Chengchi University ~~JIk~ Chu-yuan Cheng i~~L* ••1fl..~ .~. ~,{;~±!!. Graduate Student, Department of Information and Library Science Tamkang University 231 Ted Nelson AJt.;t!x.{4.$.:.t..;) m~*'T Ted Nelson and the Citation Analysis of His Concept of Hypertext 4aMA Ming-yueh Tsay a~A*~ ••~A••*~~M.a Professor, Graduate Institute of Library, Infonnation and Archival Studies National Chengchi University I~*!& Chu-yuan Cheng j~~.r..A* jf~AIi ••* ~"Ji ±!!. Graduate Student, Department of Infonnation and Library Science Tamkang University [..-I- Abstract1 Ted Nelson ~-t Vannevar Bush.:t.. Memex 1t1tJI$fj¥ . ~ 1963 ~"t:#JT tk_;t[x.{t-.$ • jt~ 1965 ~it~1 "hypertext" -til· ;t[x.{t--.$.t.ti4tr¥ T.~~#~~~ft~~~&·fl~~.m#*,~.~*a~.#*.~ ~<J£i1itit~f}¥ • *bff~ i..f£.4m ~I m x.J.tHtlJTii;- • t~ Ted Nelson.:t..~ li!f.»,~~rmff~' ~mfl~lmx.~4Hi' {~J-ku: tt1;"1}>$" , .~~~, ~Im ~{~ , *#~JJ'J~~1 m x.~f%j $.~ff*~~l m"x"~~tt , ..~ T M Nelson a~;t[x#.$fi~*#MltJ£~f}¥·bff~M*M~'~f}¥~M~~. !l).t. ~'f1-A~Jl&j#*a.1R.#*~IIl.~*~lmJii~ 'x*aftlf"x.:t..' -233 A.1t. ~ 'ta x.1~ itJtl ~ #t. (Personalized Retrieval Indexing and Documentary Evolution System' AA ~jj. PRIDE) ~ , ~ - .:.3::.:tl ill ~ x.1~ ( hyper-text) ..;t' I • jt ~~ ~ ~ tt X. !f. nidlj it T "hypertext" - til] • J Jl:t tt ' Nelson I'lp ~ lit Jl1ilT ~ x.*~ifQaIJ"*jt • jt$- 1972 ~j~A.-s}# Memex .,p.1l~JtlJJt1lh\;.~~x.M&~ ft ~ , t), a .1!l. -

Frances Uta 2502M 10845.Pdf (717.6Kb)
BORGES AND NEW MEDIA: CONNECTIONS VIA HETEROTOPIC SPACES by SHERRIN FRANCES Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Arlington in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF ARTS IN ENGLISH THE UNIVERSITY OF TEXAS AT ARLINGTON December 2010 Copyright © by Sherrin Frances 2010 All Rights Reserved ACKNOWLEDGEMENTS I want to thank my committee members—Dr. Carolyn Guertin, Dr. Wendy Faris and Dr. Chris Conway—not only for their input and support, but also for taking a chance on an unknown, long lost student. I would especially like to thank my supervising professor, Dr. Carolyn Guertin, for her encouragement and perspective. Her careful reading and insightful suggestions pushed this project beyond my own expectations. I would also like to thank Dr. Tim Morris for facilitating such an easy return to UTA. Thank you, too, to Dr. Victor Vitanza for providing ongoing support throughout the last two decades. Thank you to my parents for instilling so many core values as I grew up. And, most especially, thank you to Robert Wall and Nicole Roberts for everything that you have done, are doing and will one day get around to: you are sources of tremendous energy and inspiration. September 14, 2010 iii ABSTRACT BORGES AND NEW MEIDA: CONNECTIONS VIA HETEROTOPIC SPACES Sherrin Frances, M.A. The University of Texas at Arlington, 2010 Supervising Professor: Carolyn Guertin Borges‘ short stories such as ―The Aleph‖ and ―The Garden of Forking Paths‖ were uncanny in their foreshadowing of hypertext and internet developments in the 1990‘s.