Bericht Zum Weihnachtshochwasser 2014 (PDF
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diplomarbeit
Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit „Die Franken und der Norden. Über die Schwierigkeit der Interpretation von frühmittelalterlichen Quellen zur Geschichte Dänemarks“ Verfasserin Sandra Polzer angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, im August 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 312 394 Studienrichtung lt. Studienblatt: Geschichte (Stzw) Betreuer: Doz. Klaus Lohrmann Inhaltsverzeichnis 1. Danksagung......................................................................................................................................... 4 2. Einleitung ............................................................................................................................................ 5 3. Ad Fontes – Die Herausforderungen im Umgang mit frühmittelalterlichen Texten ......................... 13 3.1. Die Begrifflichkeit in den fränkischen Quellen und das Problem der „doppelten Theoriebildung“ ....................................................................................................................... 13 3.2. Die Bedeutung von Schriftlichkeit im Frühmittelalter............................................................... 18 3.3. Ungeschriebene Gesetze – Die Auswirkungen von Oralität auf die Wahrnehmung von sozialen und politischen Zusammenhängen ........................................................................................... 22 3.4. Die Grundregeln des politischen Systems der Franken ............................................................. 32 4. Die Auseinandersetzung -

Collected Information for Teachers
Authors: Matthias Maluck, Luise Zander Collected Information for teachers Topic: History The border landscape of Hedeby and the Danevirke was at the centre of political and military struggles for dominance over Jutland between Danish, Carolingian and, later, German sovereigns. The border marked the end of the Carolingian expansion to the north, after the Frisians and Saxons had been subdued and incorporated into their realm in the course of the eighth century. Hedeby and the Danevirke represent a significant cultural, political and economic phase in the history of Northern Europe, reflecting the specific nature and the development of borders in connection with the formation of states in Viking-Age. This landscape is a unique case study for the development over centuries of the architecture of fortified boundaries in conjunction with trading centres which are strategically integrated into their natural environment. The history of the Danevirke's construction spans more than 500 years, from protohistoric times to the Viking Age and the High Middle Ages. The linear defences of the Danevirke dominated the Schleswig Isthmus before the eighth century. Depending on strategic requirements in the border area between the Danes, Saxon tribes and the Frankish and German Empires, they were extended and reinforced through repeated building activity and the addition of stretches of ramparts. As a consequence, in the course of half a millennium the largest archaeological monument in Northern Europe came into being. The most striking stages of construction include the fieldstone wall in the Main Wall from around 740, the Connection Wall with Hedeby's link to the Main Wall in about 970, the Kovirke shortening the line of the ramparts in the late tenth century, and the great brick wall in around 1170. -

THE CURRENT MODEL of ARCHAEOLOGICAL METAL DETECTING and ITS SUCCESS in SCHLESWIG-HOLSTEIN Bente Sven Majchczack, Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
J. MartensMajchczack & M. Ravn – The (red.): current Pløyejord model som of archaeologicalkontekst – Portal forlag, metal detecting Kristiansand and its 2016 success in Schleswig-Holstein(side 89–10089) THE CURRENT MODEL OF ARCHAEOLOGICAL METAL DETECTING AND ITS SUCCESS IN SCHLESWIG-HOLSTEIN Bente Sven Majchczack, Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein ABSTRACT: The current model of archaeological metal detecting and its success in Schleswig-Holstein In Germany, each state has its own legislation concerning heritage management. This paper focuses on the system used in Schleswig-Holstein, and a number of recent research projects are presented. In 2005, the State Archaeological Department of Schleswig-Holstein (Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, ALSH) launched a system known as the Schleswig Model to allow and control the private use of metal detectors based on a certification process, licensing and cooperation. With this system, Schleswig-Holstein became one of the first German states to establish a legal system for metal detecting. Subsequently, the system has proven to be practical and efficient, yielding an output of finds, sites and excavations of high scientific value. Not least due to this success, other German states have established similar systems for legal metal detecting. INTRODUCTION is capable of uncovering cultural monuments. Recent Throughout Europe, many different ways have been laws and court rulings regard archaeological finds, found to address metal detecting in terms of law and even finds as young as certain remains of World War the protection of cultural heritage. The circumstances II, as moveable cultural monuments. Prior to 2005, are the same in Germany, where the federal system the ALSH used this legislation to prevent any use of leaves relevant legislation to the states. -

Wissenschaftsmagazin Impulse Ausgabe
Das Wissenschaftsmagazin der VolkswagenStiftung 01 Impulse 16 Ins Blaue hinein Ozeane, Küsten, Inseln: der größte Lebensraum auf unserer Erde im Fokus der Forschung Vorwort Es ist erst wenige Monate her, da ließ ein Urteil geflügelte Wort vom „blauen Planeten“ und seinen die Weltgemeinschaft aufhorchen: Neuseeland Geheimnissen, die er noch birgt. Und über diesen erkennt als erster Staat den Klimawandel und möchten wir Ihnen viele Geschichten erzählen – die Zerstörung der Umwelt als berechtigten, also kleine und große. Die großen führen Sie jeweils „rechtmäßigen“ Anlass für Migration und damit drei Mal zunächst zu verschiedenen Küstenregio- als Asylgrund an. Eine Familie von der Pazifik- nen dieser Welt, dann zu Inseln – oder solchen, die insel Tuvalu, deren Zuhause, so wertete es das Wissenschaftler dafür halten –, und zuletzt geht‘s neuseeländische Gericht, nachweislich Opfer des dann drei Mal direkt hinaus auf die Ozeane. Wilhelm Krull, allmählich steigenden Meeresspiegels geworden Generalsekretär der war, erhielt in letzter Instanz dauerhaftes Blei- In vielen der Beiträge über die geförderten Pro- VolkswagenStiftung berecht zugesprochen. Es dauerte nicht lange, jekte, die ja den Kern der Erzählungen bilden, und die Vereinten Nationen meldeten sich mit schwingt immer auch der Gedanke der Nachhal- dem Hinweis: Sollte sich an der Situation nichts tigkeit mit. Dieser ist zunehmend von Bedeutung ändern, dann erwarte man bis zum Jahr 2050 auch bei jenen gemeinsam von Land und Stiftung weltweit bis zu 500 Millionen Menschen, die vergebenen -

Pløyejord Som Kontekst
PLØYEJORD SOM KONTEKST Nye utfordringer for forskning, forvaltning og formidling Artikkelsamling Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo J. Martens & M. Ravn (red.) PLØYEJORD SOM KONTEKST Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. ? Pløyejord som kontekst Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Jes Martens & Mads Ravn (red.) © 2016 Portal forlag og Kulturhistorisk museum, Arkeologisk seksjon ISBN: 978-82-8314-073-6 2. Opplag 2016 Forsidebilde. Jordarbeid mellom gravhauger. Arkivfoto Viborg kommune, Danmark. Gjengitt med tillatelse av copyright-innehaver. Tittelblad. Tegneren Jørgen Kraglunds ikoniske illustrasjon til Christian Fischers artikkel i Skalk nr 1, 1983. Gjengitt med tillatelse av Skalk. Spørsmåls tegnet er tilføyet av redaksjonen. Bakside. Plogen sletter alle spor. Denne pedagogiske illustrasjonen er hentet fra Skalk nr. 2, 1999: 5. Gjengitt med tillatelse av Skalk. Grafisk design og omslag: Rune Eilertsen Trykk: Renessanse Media Font: Adobe Caslon Pro 11/13.3 Papir: MultiArt Silk 130 gr/m2 Alle henvendelser om denne boken kan rettes til: Portal forlag AS Agder Allé 4631 Kristiansand www.portalforlag.no [email protected] Kulturhistorisk museum Arkeologisk seksjon Postboks 6762 St. Olavs plass N-0130 Oslo Norway Tlf.: (+47) 22 85 19 00 Fax: (+47) 22 85 19 38 E-mail: [email protected] Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller fotografiloven eller i strid med avtaler inngått av KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. J. Martens & M. Ravn (red.): Pløyejord som kontekst – Portal forlag, Kristiansand 2016 (side 5–12) PLØYEJORD SOM KONTEKST Forord Redaksjonen I dette bindet presenteres elleve bidrag om funnene fra forskningsmessige, praktiske, konserveringsmessige, pløyejorden. Denne typen funn kalles i Norge normalt administrative og juridiske variabler analyseres og løsfunn eller løse kulturminner selv om de i regelen diskuteres. -

Archäologischer Grenzkomplex Haithabu Und Danewerk (UNESCO Welterbestätte)
Archäologischer Grenzkomplex Haithabu und Danewerk (UNESCO Welterbestätte) Schlagwörter: Grenzbefestigung, Grenzübergangsstelle, Abschnittsbefestigung, Erdwerk (Archäologie), Wallanlage, Kulturdenkmal , Bodendenkmal, Hafen Fachsicht(en): Archäologie, Naturschutz, Kulturlandschaftspflege Gemeinde(n): Borgwedel , Busdorf , Dannewerk , Eckernförde , Ellingstedt , Fahrdorf , Fleckeby , Hollingstedt (Kreis Schleswig- Flensburg), Jagel , Schaalby , Schleswig , Selk , Windeby Kreis(e): Rendsburg-Eckernförde , Schleswig-Flensburg Bundesland: Schleswig-Holstein Übersichtskarte der archäologischen Grenzlandschaft von Haithabu und Danewerk in der Schleswiger Landenge zwischen Nord- und Ostsee Fotograf/Urheber: Konrad Rappaport .Die Grenzbefestigung des Danewerks und das Handelszentrum Haithabu bilden zusammen das Zentrum der archäologischen Grenzregion zwischen Treene, Eider und Schlei. Der passierbare Landweg zwischen Nord- und Ostsee wurde durch die Flüsse und die Schlei auf nur wenige Kilometer verengt. Die Schleswiger Landenge begünstigte, dass Haithabu und Danewerk – vor allem in der Wikingerzeit (750-1050 n. Chr.) – ein bedeutender Knotenpunkt für Handel, Austausch und kriegerische Konflikte zwischen Skandinavien und Kontinentaleuropa war. Bedeutung des archäologischen Erbes Die Grenzlandschaft Danewerk Haithabu UNESCO-Weltkulturerbe Quelle / Internet .Bedeutung des archäologischen Erbes Der archäologische Grenzkomplex von Haithabu und dem Danewerk gehört zu den bedeutendsten archäologischen Zeugnissen in Schleswig-Holstein und ist weltweit -
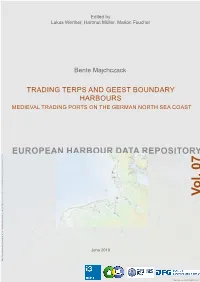
EUROPEAN HARBOUR DATA REPOSITORY V Ol. 07
Edited by Lukas Werther, Hartmut Müller, Marion Foucher Bente Majchczack TRADING TERPS AND GEEST BOUNDARY HARBOURS MEDIEVAL TRADING PORTS ON THE GERMAN NORTH SEA COAST EUROPEAN HARBOUR DATA REPOSITORY Vol. 07 Vol. http://doi.org/10.12770/18ff0d48-b203-4a65-94a9-5fd8b0ec35f6 Jena 2019 EMODnet Bathymetry Consortium (2018): Digital (DTM). https://doi.org/10.22032/dbt.38393 How to cite this volume : B. Majchczack, Trading terps and Geest boundary harbours − medieval trading ports on the German North Sea coast. In: L. Werther / H. Müller / M. Foucher (ed.), European Harbour Data Repository, vol. 07 (Jena 2019). DOI: https://doi.org/10.22032/dbt.38393 (pdf), https://doi.org/10.22032/dbt.38395 (csv), https://doi.org/10.22032/dbt.38394 (excel). How to cite a specific dataset in this volume: B. Majchczack, Trading terps and Geest boundary harbours − medieval trading ports on the German North Sea coast, ID [add number ID_place]. In: L. Werther / H. Müller / M. Foucher (ed.), European Harbour Data Repository, vol. 07 (Jena 2019). DOI: https://doi.org/10.22032/dbt.38393 (pdf), https://doi. org/10.22032/dbt.38395 (csv), https://doi.org/10.22032/dbt.38394 (excel). European Harbour Data Repository Table of contents General introduction and critical comments 4 Specific introduction and critical comments 8 Key words and thesauri 11 References 33 Database 37 3 European Harbour Data Repository General introduction and critical comment General introduction and critical comments The European Harbour Data Repository is a series of databases which were compiled in the framework of the DFG-funded Priority Program 1630 “Harbours from the Roman Period to the Middle Ages” (Kalmring/von Carnap-Bornheim 2012; Engel/Kunz/Müller/Werther 2018; http://www.spp-hae- fen.de/en/home/). -
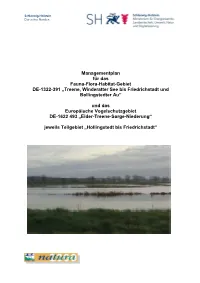
MP 1322-391 Treene Hollingstedt Friedrichstad Endfassung
Managementplan für das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet DE-1322-391 „Treene, Winderatter See bis Friedrichstadt und Bollingstedter Au“ und das Europäische Vogelschutzgebiet DE-1622 493 „Eider-Treene-Sorge-Niederung“ jeweils Teilgebiet „Hollingstedt bis Friedrichstadt“ 2 Der Managementplan wurde in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden, Flä- cheneigentümern und den lokalen Akteuren durch die Integrierte Station Eider-Treene-Sorge und Westküste (LLUR) im Auftrag des Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Um- welt, Natur und Digitalisierung (MELUND) erarbeitet und wird bei Bedarf fortgeschrieben. Als Maßnahmenplan aufgestellt (§ 27 Abs. 1 LNatSchG i. V. mit § 1 Nr. 9 NatSchZVO) Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein Mercatorstraße 3 Postfach 7151 24106 Kiel 24171 Kiel Kiel, den 03.04.2018 gez. Hans-Joachim Kaiser Titelbild: Treene bei Wohlde (Foto: D. Waldhoff) 3 Inhaltsverzeichnis 0. Vorbemerkung .................................................................................................... 4 1. Grundlagen ......................................................................................................... 4 1. 1. Rechtliche und fachliche Grundlagen ......................................................... 4 1. 2. Verbindlichkeit ............................................................................................ 5 2. Gebietscharakteristik ......................................................................................... 6 2.1. Gebietsabgrenzung -

Danewerk Wanderkarte 2018.Indd
10 Seesperrwerk vor Reesholm: Routenvorschläge Tu r f o r s l a g Das Danewerk Wallanlage unter der Wasseroberfläche 1. Spaziergang im Archäologischen Park – 5 km/ca. 1,5 Std. 1. Gåtur i Den arkæologiske Park – 5 km/ca. 1,5 time Die Geschichte des Danewerks Zum Einstieg ins Thema: Starten Sie Ihren 5 km langen Spazier- Turen begynder ved Danevirke Museum. Herfra går vejen langs reicht weit über 1.000 Jahre zu- Von der Spitze der Halbinsel gang am Danevirke Museum. Von hier aus gehen Sie immer ent- voldanlægget mod sydvest. Fra ”porten til Norden” går man forbi rück. Im Jahre 808 wurden die Reesholm bis weit nach Osten in lang der Wallanlagen in südwestlicher Richtung. Sie gelangen vom de fritlagte rester af Valdemarsmuren og hen til den rekonstruere- als Danewerk bezeichneten die Große Breite erstreckte sich Tor im Danewerk über die freigelegten Reste der Waldemarsmau- de skanse 14. Herfra er der en god udsigt over landskabet. Turen Wallanlagen im Bereich der Wanderkarte einst das monumentale Schlei- er zur rekonstruierten Schanze 14, von der Sie einen weiten Blick in går nu tilbage forbi museet, krydser landevejen og fortsætter Schleswiger Landenge erstmals Seesperrwerk. Die aus hölzernen die Landschaft haben. Von hier kehren Sie zum Museum zurück langs volden. Efter en lille skov kommer man til Thyraborg. Heref- erwähnt. HAITHABU–DANEWERK Blockbaukästen in quadratischer und queren dann die Straße. Entlang des Walls erreichen Sie hinter ter går turen tilbage til museet. Zwischen der Schlei im Osten Form zusammengesetzte Anlage einem Wald die Thyraburg. Zurück geht‘s auf demselben Weg. und der Treene im Westen erstreckte sich der Verteidigungswall war vermutlich etwa 1100 Meter lang. -

Schleswig-Holstein Vorgestellt, Die Den Blick Auf Die Lokale Verflechtung Von Naturaler Umwelt Und Gesellschaftlichem Handeln Erlauben
In diesem Sammelband werden Schauplätze der Umweltgeschichte aus dem heutigen Graduiertenkolleg 1024 Interdisziplinäre Umweltgeschichte Bundesland Schleswig-Holstein vorgestellt, die den Blick auf die lokale Verflechtung von naturaler Umwelt und gesellschaftlichem Handeln erlauben. Selbstverständlich ist keine Naturale Umwelt und gesellschaftliches Handeln in Mitteleuropa Vollständigkeit bei der Darstellung umweltgeschichtlicher Erinnerungsorte in Schleswig- Holstein angestrebt worden. Wir möchten mit diesem Band den an der Umweltgeschichte Interessierten jedoch einige exemplarische Fallbeispiele vorstellen, welche Einblicke in das Mensch-Umwelt-Verhältnis und die Umweltproblematik vergangener und gegenwärtiger Zeiten ermöglichen und von besonderer umweltgeschichtlicher Relevanz sind. Zugleich Dominik Collet möchten wir mit diesen Schauplätzen ein stärkeres Bewusstsein für zeit- und ortsübergrei- fende Umweltthemen vermitteln. Manfred Jakubowski-Tiessen (Hg.) Schauplätze der Umweltgeschichte in Schleswig-Holstein in Schleswig-Holstein Collet/Jakubowski-Tiessen (Hg.) Schauplätze der Umweltgeschichte (Hg.) Schauplätze Collet/Jakubowski-Tiessen ISBN: 978-3-86395-041-5 Universitätsdrucke Göttingen Universitätsdrucke Göttingen Dominik Collet, Manfred Jakubowski-Tiessen (Hg.) Schauplätze der Umweltgeschichte in Schleswig-Holstein This work is licensed under the Creative Commons License 3.0 “by-sa”. erschienen in der Reihe der Universitätsdrucke im Universitätsverlag Göttingen 2013 Dominik Collet und Manfred Jakubowski-Tiessen (Hg.) Schauplätze -

TP Eider 2011-12 Vorläufige Bewertung
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein Umsetzung der Richtlinie 2007/60/EG des europäischen Parlamentes und des Rates vom 23.10.2007 über die Bewertung und das Management von Hochwasserrisiken in der FGE Eider in Schleswig-Holstein Vorläufige Bewertung des Hochwasserrisikos (gem. Art. 4) und Bestimmung der Gebiete mit potenziell signifikantem Hochwasserrisiko (gem. Art. 5) Aufgestellt: Teilprojekt Eider 07. September 2011 Veröffentlichung 22. Dezember 2011 II INHALTSVERZEICHNIS 1 EINLEITUNG .............................................................................................................................. 1 2 FORDERUNGEN DER RICHTLINIE ZUR VORLÄUFIGEN BEWERTUNG DES HOCHWASSERRISIKOS .......................................................................................................... 4 3 BESCHREIBUNG DES EINZUGSGEBIETS EIDER (GEMÄß ART. 4 ABS. 2A) ..................... 8 3.1 GEOGRAPHISCHE AUSDEHNUNG ......................................................................................... 8 3.2 GEOLOGIE UND TOPOGRAPHIE .......................................................................................... 10 3.3 GEWÄSSERNETZ UND KÜSTENGEBIETE........................................................................... 13 3.3.1 PLANUNGSEINHEIT ARLAU / BONGSIELER KANAL ......................................................... 14 3.3.2 PLANUNGSEINHEIT EIDER / TREENE ................................................................................. 15 3.3.3 PLANUNGSEINHEIT MIELE -

Informationssammlung Für Lehrer Thema
Autoren: Matthias Maluck, Luise Zander Informationssammlung für Lehrer Thema: Grenzen überwinden/Overcoming Borders The Heritage Site, and especially the Danevirke, contains the issue of a border complex. Hedeby facilitated exchange between trading networks spanning the European continent, and – in conjunction with the Danevirke – controlled trading routes, the economy and the territory at the crossroads between the emerging Danish kingdom and the kingdoms and peoples of mainland Europe. The archaeological evidence highlights the significance of Hedeby and the Danevirke as an example of an urban trading centre connected with a large-scale defensive system in a border complex at the core of major trading routes over sea and land from the 8th to 11th centuries. Features of the natural landscape and man-made structures were combined intentionally to form a border complex at a natural bottleneck in the Viking Age between the eighth and eleventh centuries. Englisch: Hedeby and the Danevirke represent a significant cultural, political and economic phase in the history of Northern Europe, reflecting the specific nature and the development of borders in connection with the formation of states in Viking-Age Europe between the eighth and eleventh centuries AD. This landscape is a unique case study for the development over centuries of the architecture of fortified boundaries in conjunction with trading centres which are strategically integrated into their natural environment. The defensive system of the Danevirke and the trading centre of Hedeby consists of a spatially linked complex of earthworks, walls and ditches, settlements, grave fields and a harbour across the Schleswig Isthmus on the Jutland Peninsula in Northern Europe from the first and early second millennia AD.