Download Download
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
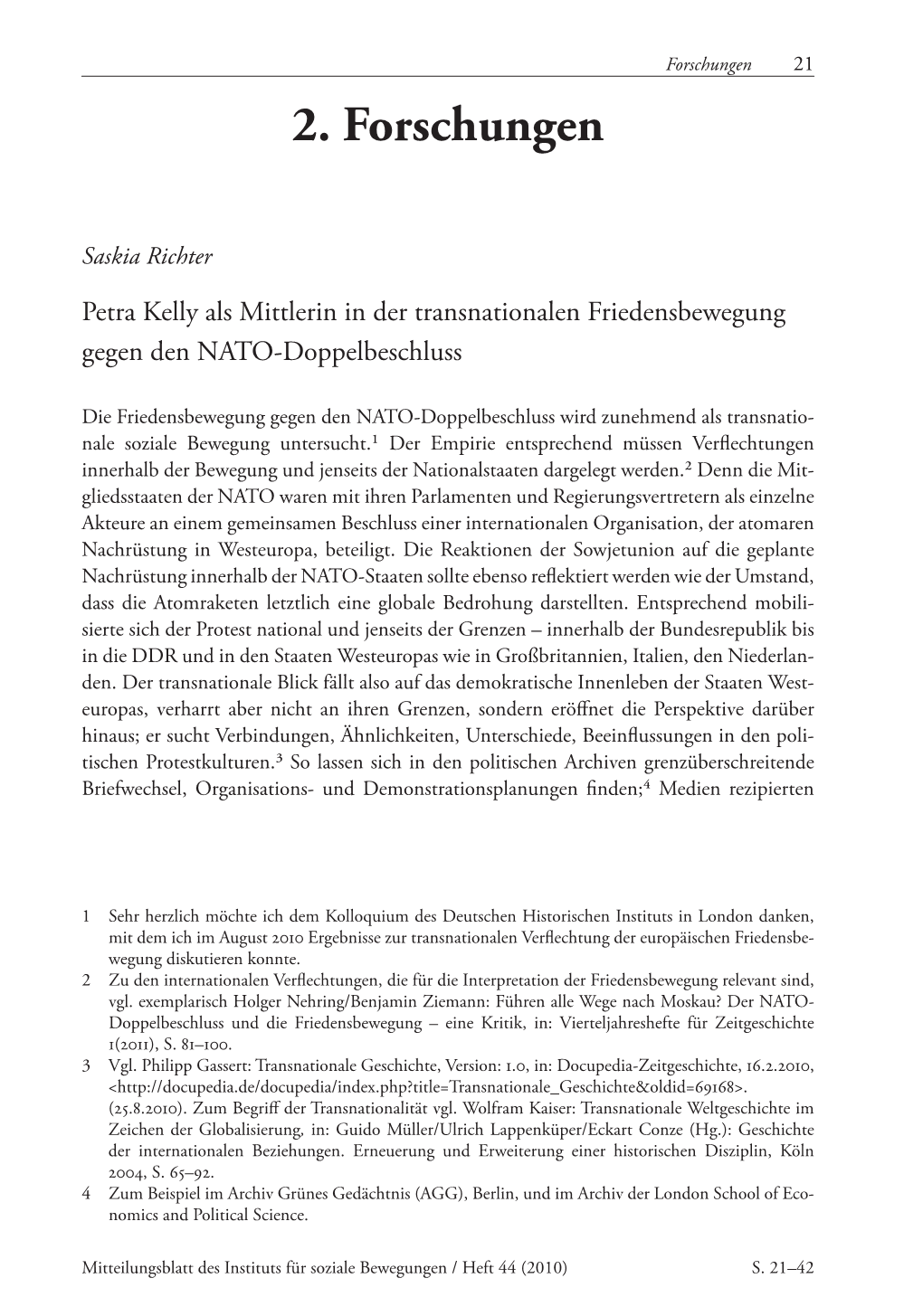
Load more
Recommended publications
-

Beyond Social Democracy in West Germany?
BEYOND SOCIAL DEMOCRACY IN WEST GERMANY? William Graf I The theme of transcending, bypassing, revising, reinvigorating or otherwise raising German Social Democracy to a higher level recurs throughout the party's century-and-a-quarter history. Figures such as Luxemburg, Hilferding, Liebknecht-as well as Lassalle, Kautsky and Bernstein-recall prolonged, intensive intra-party debates about the desirable relationship between the party and the capitalist state, the sources of its mass support, and the strategy and tactics best suited to accomplishing socialism. Although the post-1945 SPD has in many ways replicated these controversies surrounding the limits and prospects of Social Democracy, it has not reproduced the Left-Right dimension, the fundamental lines of political discourse that characterised the party before 1933 and indeed, in exile or underground during the Third Reich. The crucial difference between then and now is that during the Second Reich and Weimar Republic, any significant shift to the right on the part of the SPD leader- ship,' such as the parliamentary party's approval of war credits in 1914, its truck under Ebert with the reactionary forces, its periodic lapses into 'parliamentary opportunism' or the right rump's acceptance of Hitler's Enabling Law in 1933, would be countered and challenged at every step by the Left. The success of the USPD, the rise of the Spartacus move- ment, and the consistent increase in the KPD's mass following throughout the Weimar era were all concrete and determined reactions to deficiences or revisions in Social Democratic praxis. Since 1945, however, the dynamics of Social Democracy have changed considerably. -

2019 Ausgabe 9 Porträt Petra Kelly
HOME FRAU UND MUTTER ARCHIV 2019 AUSGABE 9 PORTRÄT PETRA KELLY Grüne Galionsfigur und gefallener Friedensengel "Wenn wir uns Petra Kelly näherten, spürten wir ihr Feuer. Wir hatten Angst, es könne sie verbrennen." So und ähnlich wird die Mitgründerin der Grünen beschrieben: Petra Kelly lebte ein intensives Leben - leidenschaftlich und leidvoll gleichermaßen. Von Jutta Laege Wenn sich in diesen Wochen und Monaten die junge Generation bei "Fridays for future" in Bewegung setzt und für eine nachhaltige Klima- und Umweltpolitik streitet, sich Galionsfiguren wie Greta Thunberg und Luise Neubauer an deren Spitze herauskristallisieren, fühlt man sich unweigerlich an die Anfänge der Grünen in der alten Bundesrepublik Ende der 1970er- und Anfang der 1980er-Jahre erinnert. Und an eine Vorkämpferin, die vierzig Jahre später nahezu in Überzeugte Pazifistin: Petra Vergessenheit geraten ist. Kelly 1983 in Mutlangen, bei Die 1947 im bayerischen Günzburg geborene Petra Kelly war eine Frau, einer Blockade des US-Raketendepots an der sich die Geister schieden: Foto: dpa/Report Fleißig, stark und charismatisch auf der einen, zierlich, verletzlich, verbissen und irgendwie immer abgekämpft auf der anderen Seite. Sie arbeitet pausenlos Sie ist die "grüne Mutter Teresa", streitet unablässig für eine bessere Umwelt, für den Frieden, kämpft gegen die atomare Aufrüstung, gegen das politische Establishment, gegen den Hunger in der dritten und irgendwie gegen alle Ungerechtigkeiten der gesamten Welt. Sie arbeitet pausenlos und steht immer wieder kurz vor dem Burnout. "Es gibt Augenblicke, wo ich mehr oder weniger zusammenbreche, und Momente, in denen mein Verstand sagt Stopp!, aber mein Herz weitermacht", sagt sie kurz vor ihrem Tod. Der wird nicht durch ihren körperlichen Zusammenbruch verursacht, sondern tritt gewaltsam ein. -

Interview with J.D. Bindenagel
Library of Congress Interview with J.D. Bindenagel The Association for Diplomatic Studies and Training Foreign Affairs Oral History Project AMBASSADOR J.D. BINDENAGEL Interviewed by: Charles Stuart Kennedy Initial interview date: February 3, 1998 Copyright 2002 ADST Q: Today is February 3, 1998. The interview is with J.D. Bindenagel. This is being done on behalf of The Association for Diplomatic Studies. I am Charles Stuart Kennedy. J.D. and I are old friends. We are going to include your biographic sketch that you included at the beginning, which is really quite full and it will be very useful. I have a couple of questions to begin. While you were in high school, what was your interest in foreign affairs per se? I know you were talking politics with Mr. Frank Humphrey, Senator Hubert Humphrey's brother, at the Humphrey Drugstore in Huron, South Dakota, and all that, but how about foreign affairs? BINDENAGEL: I grew up in Huron, South Dakota and foreign affairs in South Dakota really focused on our home town politician Senator and Vice President Hubert H. Humphrey. Frank, Hubert Humphrey's brother, was our connection to Washington, DC, and the center of American politics. We followed Hubert's every move as Senator and Vice President; he of course was very active in foreign policy, and the issues that concerned South Dakota's farmers were important to us. Most of farmers' interests were in their wheat sales, and when we discussed what was happening with wheat you always had to talk about the Russians, who were buying South Dakota wheat. -

Ecofeminist Ideology of Petra Kelly: the Challenges of Modern Political Thought Nadić, Darko
www.ssoar.info Ecofeminist Ideology of Petra Kelly: The Challenges of Modern Political Thought Nadić, Darko Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Nadić, D. (2013). Ecofeminist Ideology of Petra Kelly: The Challenges of Modern Political Thought. European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities, 2(2), 63-70. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-341831 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY-NC-ND Lizenz This document is made available under a CC BY-NC-ND Licence (Namensnennung-Nicht-kommerziell-Keine Bearbeitung) zur (Attribution-Non Comercial-NoDerivatives). For more Information Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden see: Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de European Quarterly of Political Attitudes and Mentalities EQPAM Vol.2, No.2, April 2013 ISSN 2285 – 4916 ISSN- L 2285 - 4916 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Ecofeminist Ideology of Petra Kelly: The Challenges of Modern Political Thought1 _____________________________________________________________________________________________ Darko Nadić Faculty of Political Science, University of Belgrade, Serbia Submission to ECPAM’2012: June 15th, 2012 Accepted for ECPAM’2012: July 15th, 2012 Submission to EQPAM: March 28th , 2013 Accepted for EQPAM: April 15th, 2013 _____________________________________________________________________________________________ Abstract Petra Kelly (1947-1992) has remained recorded in history as one of the true icons of modern German and European environmental movement. Combining the ideas of feminism, peace, nonviolence, ecology (environmental protection) and social justice, she has managed to reconcile these seemingly opposing ideas and merge them into one specific type of ideology that was the guiding idea of the German Green Party until the mid-nineties of the last century. -

Dirk Schneider 1 Dirk Schneider
Dirk Schneider 1 Dirk Schneider Dirk Schneider (* 21. April 1939 in Rostock; † 4. November 2001 in Berlin) war ein deutscher Politiker und Geheimdienstagent (MfS). Er war während der Erschießung Benno Ohnesorgs beim Besuch des persischen Schahs am 2. Juni 1967 als Publizistikstudent der Freien Universität Berlin im "Komitee für Öffentlichkeitsarbeit" engagiert. Schneider war federführend bei den linksradikalen Zeitungsprojekten Agit 883 und Radikal. Nach basisorientierter Stadtteilarbeit in Berlin-Kreuzberg Anfang bis Mitte der 1970er-Jahre war er vom 29. März 1983 bis zu seiner Mandatsniederlegung am 30. März 1985 (eine halbe Wahlperiode) Mitglied des Deutschen Bundestages (MdB) und der Bundestagsgruppe der Grünen. Er war 1978 Gründungsmitglied und danach mehrere Jahre einer der Sprecher der Alternativen Liste (AL) in Berlin. 1979 wurde er auch Mitglied der Grünen. In den Jahren 1979 bis 1981 war er Vorsitzender der AL-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung Berlin-Kreuzberg. Er wurde von der Alternative Liste für die erste Bundestagsfraktion der damaligen Grünen, heute Bündnis 90/Die Grünen in West-Berlin aufgestellt und gewählt. Er war der deutschlandpolitische Sprecher der grünen Bundestagsfraktion. Da die Grünen und die AL damals das sogenannte Rotationsprinzip hatten, räumte er nach der ersten Hälfte der Legislaturperiode seinen Platz für seinen Nachrücker Christian Ströbele (ebenfalls AL Berlin). 1983 unterzeichnete er zusammen mit Petra Kelly, Otto Schily, Gert Bastian, Antje Vollmer, und Lukas Beckmann einen "persönlichen Friedensvertrag" mit Erich Honecker während eines Besuchs dieser Grünen-Delegation in Ostberlin. Unter seinem Einfluss rückte der Schwerpunkt der Grünen von der Pflege von Beziehungen zur DDR-Opposition zu einer Identifikation mit SED-Positionen, z. B. der Übernahme der Geraer Forderungen Erich Honeckers. -

Dezember 2017
★ ★ ★ Dezember ★ ★ 2017 ★ ★ ★ Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Deutschen Bundestages und des Europäischen Parlaments e. V. Editorial Rita Pawelski Informationen ...Grüße aus dem Saarland Termine Personalien Titelthemen Mitgliederreise Saarland und Luxemburg Berichte / Erlebtes Europäische Assoziation Jahreshauptversammlung in Bonn Mein Leben danach Erlesenes Aktuelles Die Geschäftsführerin informiert Jubilare © Carmen Pägelow Editorial Informationen Willkommen in der Vereinigung der ehemaligen Abgeordneten, Termine © Thomas Rafalzyk liebe neue Ehemalige! 20.03.2018 Frühlingsempfang der DPG (voraussichtlich) Für mehr als 200 Abgeordnete 21.03.2018 Mitgliederversammlung der DPG (voraussichtlich) beginnt nun eine neue Lebens- 14./15.05.2018 Mitgliederveranstaltung mit zeit. Sie gehören dem Deutschen Empfang des Bundespräsidenten / Bundestag nicht mehr an. Je Jahreshauptversammlung mit Wahl / nach Alter starten sie entweder Studientag „Die Zukunft Europas“ in eine neue Phase der Berufs- 12.-20. Juni 2018 Mitgliederreise nach Rumänien tätigkeit oder sie bereiten sich auf ihren dritten Lebensabschnitt vor. Aber egal, was für sie für sich und ihre Zukunft geplant haben: die Zeit im Bundestag ist nun Vergangenheit. Personalien Ich weiß aus Erfahrung, dass der Übergang in die neue Zeit von vielen Erinnerungen – und manchmal auch von Wehmut – begleitet wird. Man hat doch aus Überzeugung im Deutschen Bundestag gearbeitet… und oft auch mit Herzblut. Man hatte sich an den Arbeitsrhythmus gewöhnt und daran, dass der Tag oft 14 bis 16 Arbeitsstunden hatte. Man schätzte die fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro, die Planungen über- © Deutscher Bundestag / Achim Melde nommen, Reisen gebucht, an Geburtstage erinnert, den Termin- kalender geführt, Sitzungen vorbereitet und Akten sortiert haben. Auf einmal ist man selbst dafür zuständig: welchen Zug muss ich nehmen, wann fährt der Bus, wer hat wann Geburtstag. -

Introduction: the Nuclear Crisis, NATO's Double-Track Decision
Introduction Th e Nuclear Crisis, NATO’s Double-Track Decision, and the Peace Movement of the 1980s Christoph Becker-Schaum, Philipp Gassert, Martin Klimke, Wilfried Mausbach, and Marianne Zepp In the fall of 1983 more than a million people all across West Germany gathered under the motto “No to Nuclear Armament” to protest the imple- mentation of NATO’s Double-Track Decision of 12 December 1979 and the resulting deployment of Pershing II and cruise missiles in West Germany and other European countries.1 Th e media overfl owed with photos of human chains, sit-in blockades, and enormous protest rallies. Th e impressive range of protest events included street theater performances, protest marches, and blockades of missile depots. During the fi nal days of the campaign there were huge mass protests with several hundred thousand participants, such as the “Fall Action Week 1983” in Bonn on 22 October and a human chain stretching about 108 km from Ulm to Stuttgart. It seemed as if “peace” was the dominant theme all over Germany.2 Despite these protests, the West German Bundestag approved the missile deployment with the votes of the governing conservative coalition, thereby concluding one of the longest debates in German parliamentary history.3 A few days later the fi rst of the so-called Euromissiles were installed in Mut- langen, near Stuttgart, and in Sigonella, on the island of Sicily.4 Th e peace movement had failed to attain its short-term political aim. However, after a brief period of refl ection, the movement continued to mobilize masses of people for its political peace agenda. -

CDU/CSU Und F.D.P
Plenarprotokoll 13/113 (Zu diesem Protokoll folgt ein Nachtrag) Deutscher Bundestag Stenographischer Bericht 113. Sitzung Bonn, Donnerstag, den 20. Juni 1996 Inhalt: Begrüßung des Präsidenten des Makedo-- - Zweite und dritte Beratung des von nischen Parlaments, Herrn Tito Petkovski, der Fraktion der SPD eingebrachten und seiner Delegation 10007 A Entwurfs eines Gesetzes zur Wie- derherstellung der Neutralität der Bundesanstalt für Arbeit bei Ar- Glückwünsche zum Geburtstag der Abge beitskämpfen (Drucksachen 13/715, ordneten Hanna Wolf (München) . 10007 B 13/2727) 10008B c) Zweite und dritte Beratung des von Erweiterung und Abwicklung der Tages den Abgeordneten Dr. Heidi Knake ordnung 10007 B Werner, Petra Bläss und der Gruppe der PDS eingebrachten Entwurfs eines Absetzung von Tagesordnungspunkten 10007 D Gesetzes zur Änderung des Arbeits- förderungsgesetzes - Nichtberück- sichtigung der Kirchensteuer in den Tagesordnungspunkt 3: neuen Ländern (Drucksachen 13/1843, 13/3206) 10008 C a) Erste Beratung des von den Fraktionen Dr. Norbert Blüm, Bundesminister BMA 10008 C der CDU/CSU und F.D.P. eingebrach- ten Entwurfs eines Gesetzes zur Re- Dr. Dagmar Enkelmann PDS 10009B form der Arbeitsförderung (Arbeits- Adolf Ostertag SPD 10012 C förderungs-Reformgesetz) (Drucksache Marieluise Beck (Bremen) BÜNDNIS 90/ 13/4941) 10008A DIE GRÜNEN 10014C, 10017D, 10018 C b) - Zweite und dritte Beratung des von dem Abgeordneten Manfred Müller Dr. Renate Hellwig CDU/CSU 10016D, 10036B (Berlin) und den weiteren Abge- Dr. Renate Hellwig CDU/CSU 10017 C ordneten der PDS eingebrachten Dr. Heiner Geißler CDU/CSU 10018B Entwurfs eines Gesetzes zur Än- Dr. Gisela Babel F.D.P 10018D, 10034B derung des Arbeitsförderungsge- setzes (§ 116) (Drucksachen 13/581, Dr. -

Gegen Alle Machtblöcke Die Grünen, Der Ost-West-Konflikt Und Die Deutsche Frage
PAPERS JOCHEN WEICHOLD GEGEN ALLE MACHTBLÖCKE DIE GRÜNEN, DER OST-WEST-KONFLIKT UND DIE DEUTSCHE FRAGE ROSA LUXEMBURG STIFTUNG IMPRESSUM PAPERS 4/2019 wird herausgegeben von der Rosa-Luxemburg-Stiftung V. i. S. d. P.: Henning Heine Franz-Mehring-Platz 1 · 10243 Berlin · www.rosalux.de ISSN 2194-0916 · Redaktionsschluss: Oktober 2019 Lektorat: TEXT-ARBEIT, Berlin Layout/Herstellung: MediaService GmbH Druck und Kommunikation Jochen Weichold Gegen alle Machtblöcke Die Grünen, der Ost-West-Konflikt und die deutsche Frage 30 Jahre nach dem Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) zur Bundesrepublik Deutschland (BRD) und drei Jahrzehnte nach dem Ende der Blockkonfrontation lohnt es sich, einen Blick zurück auf diese Ereignisse und auf die daran beteiligten politischen Kräfte zu werfen. Im Folgenden soll es um die Partei Die Grünen gehen, die Entwicklung ihrer Positionen zum Ost-West-Konflikt und zur darin eingebetteten deutschen Frage. Dabei ist die Positionierung der Grünen nur adäquat nachzuvollziehen, wenn man das generelle Politikverständnis der Akteure dieser Partei berücksichtigt. «Wir sind weder rechts noch links, sondern vorn!»,1 lautete das Credo, mit dem sich Die Grünen als «Alternative zu den herkömmlichen Parteien»2 Ende der 1970er Jahre präsentierten und sich quer zum bestehenden Parteiensystem in der BRD verorteten. Mit gleicher Radikalität postulierten sie in ihrem Saarbrücker Bundesprogramm von 1980 ihre Gegnerschaft zu den sogenannten Industriegesellschaften in Ost und West: «Sowohl aus der Wettbewerbswirtschaft als auch aus der Konzentration wirtschaftlicher Macht in staats- und privatkapitalistischen Monopolen gehen jene ausbeuterischen Wachstumszwänge hervor, in deren Folge die völlige Verseuchung und Verwüstung der menschlichen Lebensbasis droht.»3 Die Partei machte sich für einen ökologisch-humanistisch-pazifistischen dritten Weg stark. -

Interview: Antje Vollmer: „Jeder Wirkliche Fortschritt Ist Pazifistisch“
1 Berliner Zeitung vom 19. Juli 2020 Interview: Antje Vollmer: „Jeder wirkliche Fortschritt ist pazifistisch“ Die frühere Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags und Grünen-Politikerin über Deutschland, Europa und den Abbau von Feindbildern. 19.6.2020 - 21:13, Michael Maier Antje Vollmer in der Bundespressekonferenz. Foto: Imago/Metodi Popow Die Grünen-Politikerin Antje Vollmer, evangelische Theologin und viele Jahre Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, ist überzeugt: Jede wirklich fortschrittliche Zeit ist in ihrer Grundtendenz pazifistisch. Sie erzählt über ihre Bemühungen einer deutsch-deutschen Annäherung und erklärt, warum der Frieden eine europäische Aufgabe ist – und was sie an den Grünen von heute vermisst. Berliner Zeitung: Frau Vollmer, die Worte „Frieden“ und „Pazifismus“ scheinen aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden zu sein … Antje Vollmer: Alle sprechen davon, dass wir an einer Zeitenwende stehen. Aber ich kann mir keine neue Poli- tik vorstellen ohne ein pazifistisches Moment. Jede wirklich fortschrittliche Zeit war tendenziell pazifistisch. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Völkerbund ins Leben gerufen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Uno entstanden. Die Auflösung des Kalten Krieges begann mit der Entspannungspolitik von Willy Brandt, sein Ende mit der Friedensbewegung in Deutschland und Europa. Die Deklaration von Helsinki eröffnete eine gewaltredu- zierende Perspektive. Es ist katastrophal, dass wir diese Chancen nach 1990 vertan haben. Was ist 1990 schiefgelaufen? Es gab einen unverantwortlichen westlichen Triumphalismus. Wir reden immer nur von den Verdiensten der Bürgerrechtler und vergessen die sensationellen Entwicklungen damals im Kreml. Gorbatschow hat den Afgha- nistan-Krieg beendet. Und man kann sich kaum vorstellen, welche Leistung es war, 1989 die Soldaten in den Kasernen zu lassen und so eine Gewalteskalation zu vermeiden. -

Chapter 6: the (Anti-)Politics of Autonomy
CHAPTER 6: THE (ANTI-)POLITICS OF AUTONOMY Almost without exception, revolutionary social movements in the twentieth century have sought to conquer national political power -- either to take over nation-states through elections or overthrow them through violence. The goal of autonomous movements is to transcend nation- states, not capture them. Since autonomists are singularly uninterested in what is normally regarded as politics (campaigns, votes, fundraising, party formation, etc.), is it possible to speak of the politics of autonomy? An affirmative answer rests upon a redefinition of politics, one that considers civil Ludditism and confrontational demonstrations to be forms of political action. In this chapter, I compare autonomous (anti-) politics with these those of the Greens and of the Left. In so doing, I hope to demarcate the boundaries of autonomous movements and speculate on their possible applicability to other contexts. As will become clear in the course of my discussion, one of the principal weaknesses of contemporary political movements has been their tendency to adopt ready- made theories from previous waves of activism. In order to mitigate such dogmatic behavior in future autonomous movements, I develop a detailed critique of the theories of Antonio Negri, the Italian autonomist whose notions of revolutionary strategy vary widely from those I understand as most effective and relevant. In contrast to Negri's call to adopt the cyborg as a model of action, I propose a rationality of the heart and a reconsideration of the role of spontaneity and militance. Unlike Social Democracy and Leninism, the two main currents of the twentieth century Left, the Autonomen are relatively unencumbered with rigid ideologies. -

11. Februar 1987: Fraktionssitzung
DIE GRÜNEN – 11. WP Fraktionssitzung: 11. 2. 1987 [6.] 11. Februar 1987: Fraktionssitzung AGG, B.II.1, 2135. Überschrift: »Fraktionssitzungsprotokoll vom 11. 2. 87 laut Stimmenauszählungsübersicht von Uwe Günther«. Anwesend: Abgeordnete1 (Die unterstrichenen Personen sind in den jeweiligen Ausschuß gewählt.) TOP 1: Wahl der Ausschußmitglieder2 1. Verteidigungsausschuß / 2 Sitze 40 abgegebene Stimmen / Quorum 21 / 5 Enthaltungen Gertrud Schilling: 31 Alfred Mechtersheimer: 34 2. Finanzausschuß / 3 Sitze 37 abgegebene Stimmen / Quorum 19 / Keine Enthaltung Uwe Hüser: 32 Thomas Ebermann: 31 Otto Schily: 19 3. Petitionsausschuß / 2 Sitze 30 abgegebene Stimmen / Quorum 16 / 2 Enthaltungen / 1 Stimme ungültig Christa Nickels: 27 4. Landwirtschaftsausschuß / 2 Sitze Wahl abgesetzt 5. Ausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit / 2 Sitze 1.Wahlgang: 36 abgegebene Stimmen / Quorum 18 / 7 Enthaltungen / 2 ungültige Stimmen Uschi Eid: 27 2. Wahlgang: 37 abgegebene Stimmen / Quorum 19 / 3 Enthaltungen Ludger Volmer: 25 Wilhelm Knabe: 9 6. Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen / 2 Sitze 36 abgegebene Stimmen / Quorum 19 / 4 Enthaltungen Karitas Hensel: 29 Wilhelm Knabe: 23 1 Eine Anwesenheitsliste liegt für diese Fraktionssitzung nicht vor. – Informationen über anwesende Mitarbeiter der Fraktion liegen – abgesehen vom Protokollanten Günther – nicht vor. 2 Nicht überliefert in den Fraktionsprotokollen ist die Wahl der Mitglieder des Auswärtigen Ausschusses. Zur endgültigen Besetzung der Ausschüsse vgl. Dok. 14, Anlage A. Copyright © 2018 KGParl 1 DIE GRÜNEN – 11. WP Fraktionssitzung: 11. 2. 1987 7. Ausschuß für Verkehr/ 2 Sitze 32 abgegebene Stimmen / Quorum 17 Helga Brahmst-Rock: 31 Michael Weiss: 31 8. Ausschuß für Bildung und Wissenschaft / 2 Sitze 33 abgegebene Stimmen / Quorum 17 Imma Hillerich: 33 9. Rechtsausschuß / 2 Sitze 35 abgegebene Stimmen / Quorum 18 / Enthaltungen 4 Dietrich Wetzel: 31 10.