Mendelssohn Bartholdy
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
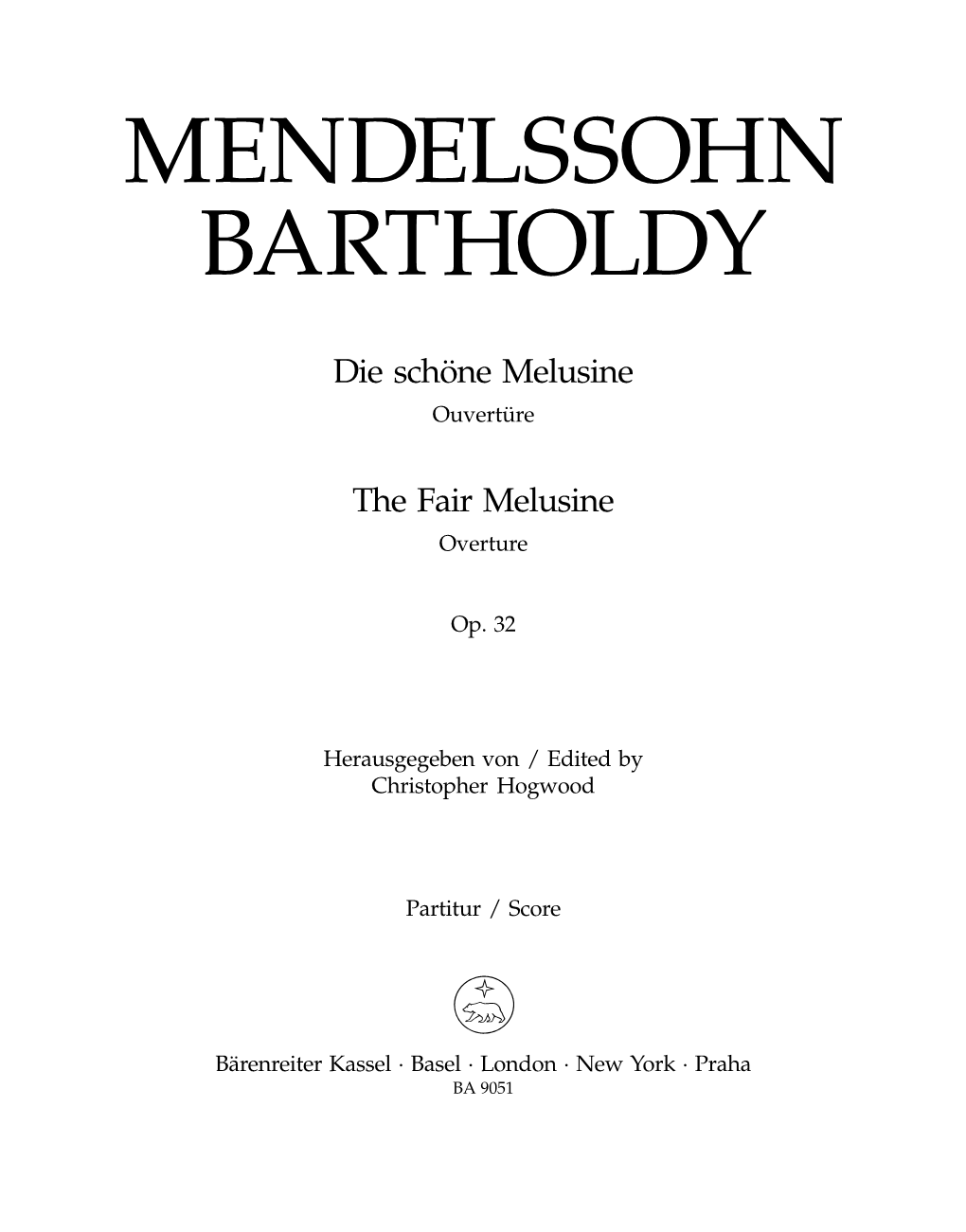
Load more
Recommended publications
-

Felix Mendelssohn Bartholdy (Geb
Felix Mendelssohn Bartholdy (geb. Hamburg, 3. Februar 1809 — gest. Leipzig, 4. November 1847)Die Die Loreley Op. 98 Vorwort Mendelssohn spielte wahrlich keine bedeutsame Rolle bei der Weiterentwicklung der Oper. Trotzdem wurde die Frage seines Beitrags zum Genre in der Zeit nach seinem Tod leidenschaftlich diskutiert. Einige Kritiker — am berüchtigtsten Richard Wagner— hielten den Komponisten für schlichtweg unfähig, solche Werke zu schreiben. Für andere dagegen war das Oratorium Elijah ein Neustart, das den Weg bereitete — wie ein zeitgenössischer Kritiker bemerkte — für ein neues Stadium der dramatischen Musik, das Die Loreley einleiten sollte. Aus dieser Sicht war Mendelssohns frühzeitiger Tod ein doppelter Schlag: gerade im Begriff, einen substantiellen Beitrag zur Oper zu leisten, der mit anderen Ansätzen gut hätte konkurrieren können, blieb seine Verheißung jedoch unerfüllt. Daß Mendelssohn als Enddreißiger die Welt der Oper noch nicht hatte erobern können, ist kennzeichnend für seine vielschichtige Einstellung diesem Genre gegenüber. Dramatische Musik hatte ihn vom Beginn seiner kreativen Unternehmungen beschäftigt: im Alter zwischen 11 und 15 Jahren schrieb er vier komische Opern für hausmusikalische Aufführungen; Die Soldatenliebschaft (1820), Die beiden Pädagogen (1821), Die wandernden Komödianten (1821) and Die beiden Neffen, oder Der Onkel aus Boston 1822-23). Diese Werke rührten aber nicht von seinem Kompositionsunterricht bei dem Berliner Komponisten, Dirigenten und Pädagogen Carl Friedrich Zelter her, sondern sie entsprangen Mendelssohns eigener kreativer Schaffenslust. Das letztere Werk — Der Onkel aus Boston — ist charakteristisch für Mendelssohns altersgemäße Entwicklung: nach der ersten Generalprobe des Werkes am fünfzehnten Geburtstag des Komponisten bemerkte Zelter darin genügend Fortschritt und Originalität, um Mendelssohn "den Gesellenbrief…im Namen Mozarts, im Namen Haydns und im Namen des Altmeisters Bach" zu verleihen. -

Einleitung Zu SON
XII Einleitung Von den in dem Band „Weitere Orchesterwerke“1 vorgeleg- Wohnort vorgelegt.4 Doberan war 1793 nach südenglischem ten Kompositionen Felix Mendelssohn Bartholdys bildet die Vorbild als erstes Ostseebad von Friedrich Franz I. ( 1756– 1837) Ouver türe für Harmoniemusik C-Dur op. 24 MWV P 1 inso- eingerichtet worden. Der kunstbeflissene Monarch, seit 1785 fern eine Besonderheit, als sie in mehreren Fassungen existiert Herzog zu Mecklenburg und seit 1815 Großherzog von Meck- und deshalb als einzige Komposition dieser Werkgruppe für lenburg-Schwerin, nutzte Doberan als Sommerresidenz.5 Er den Inhalt des vorliegenden Bandes in Frage kam. Es handelt unterhielt in Ludwigslust eine Hofkapelle, deren Ruf weit über sich um eine zu Lebzeiten Mendelssohns unveröffentlichte Fas- den unmittelbaren Wirkungsort ausstrahlte.6 Einige Musiker sung für elf Blasinstrumente von 1826 sowie um zwei Arrange- versahen ihren Dienst in den Sommermonaten in Doberan, ments für Klavier zu vier Händen, die 1838 im Zusammenhang also an jenem Ort nahe der Ostsee, den Mendelssohn als „ein mit der Hauptfassung für 23 Blasinstrumente und Janitscha- hübsches Dorf im Sande“7 bezeichnete. reninstrumente entstanden. Die herausgehobene Stellung wird Durch insgesamt zehn erhaltene Briefe, die zwischen 3. und zudem durch eine beachtliche Quellenvielfalt, etliche mit der 31. Juli 1824 von Doberan nach Berlin geschickt wurden, ist Entstehung zusammenhängende ungelöste Fragen sowie durch die Nachwelt detailliert über die dortigen Ereignisse und die den Umstand unterstrichen, dass die Ouvertüre in der erweiter- Eindrücke der verreisten Mendelssohns informiert.8 Drei Tage ten Bläserfassung als einziges Stück dieses Werkbestandes vom nach Ankunft resümierte der Fünfzehnjährige humorvoll: „Wir selbstkritischen Komponisten für wert befunden wurde, veröf- haben hier gräulich viel zu thun. -

German Virtuosity
CONCERT PROGRAM III: German Virtuosity July 20 and 22 PROGRAM OVERVIEW Concert Program III continues the festival’s journey from the Classical period Thursday, July 20 into the nineteenth century. The program offers Beethoven’s final violin 7:30 p.m., Stent Family Hall, Menlo School sonata as its point of departure into the new era—following a nod to the French Saturday, July 22 virtuoso Pierre Rode, another of Viotti’s disciples and the sonata’s dedicatee. In 6:00 p.m., The Center for Performing Arts at Menlo-Atherton the generation following Beethoven, Louis Spohr would become a standard- bearer for the German violin tradition, introducing expressive innovations SPECIAL THANKS such as those heard in his Double String Quartet that gave Romanticism its Music@Menlo dedicates these performances to the following individuals and musical soul. The program continues with music by Ferdinand David, Spohr’s organizations with gratitude for their generous support: prize pupil and muse to the German tradition’s most brilliant medium, Felix July 20: The William and Flora Hewlett Foundation Mendelssohn, whose Opus 3 Piano Quartet closes the program. July 22: Alan and Corinne Barkin PIERRE RODE (1774–1830) FERDINAND DAVID (1810–1873) Caprice no. 3 in G Major from Vingt-quatre caprices en forme d’études for Solo Caprice in c minor from Six Caprices for Solo Violin, op. 9, no. 3 (1839) CONCERT PROGRAMS CONCERT Violin (ca. 1815) Sean Lee, violin Arnaud Sussmann, violin FELIX MENDELSSOHN (1809–1847) LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) Piano Quartet no. 3 in b minor, op. 3 (1825) Violin Sonata no. -

Mendelssohn Handbuch
MENDELSSOHN HANDBUCH Herausgegeben von Christiane Wiesenfeldt Bärenreiter Metzler Auch als eBook erhältlich (isbn 978-3-7618-7218-5) Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar. © 2020 Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH & Co. KG, Kassel Gemeinschaftsausgabe der Verlage Bärenreiter, Kassel, und J. B. Metzler, Berlin Umschlaggestaltung: +christowzik scheuch design Umschlagabbildung: Wilhelm von Schadow: Mendelssohn, Ölgemälde (verschollen), Düsseldorf, ca. 1835; aus: Jacques Petitpierre, Le Mariage de Mendelssohn 1837–1937, Lausanne 1937; Reproduktion: dematon.de Lektorat: Jutta Schmoll-Barthel Korrektur: Daniel Lettgen, Köln Innengestaltung und Satz: Dorothea Willerding Druck und Bindung: Beltz Grafische Betriebe GmbH, Bad Langensalza isbn 978-3-7618-2071-1 (Bärenreiter) isbn 978-3-476-05630-6 (Metzler) www.baerenreiter.com www.metzlerverlag.de Inhalt Vorwort . IX Siglenverzeichnis XII Zeittafel . XIV I POSITIONEN, LEBENSWELTEN, KONTEXTE Romantisches Komponieren (von Christiane Wiesenfeldt) . 2 Mehrdeutigkeit als Deutungsproblem 2 Romantik als Deutungs-Option 5 Romantik im Werk 10 Mendels- sohns Modell von Romantik 15 Literatur 18 Jüdisch-deutsche und jüdisch-christliche Identität (von Jascha Nemtsov) . 21 »Lieben Sie mich, Brüderchen!«: Die Heimat 21 »Jener allweltliche Judensinn«: Die Aufklärung 23 »Hang zu allem Guten, Wahren und Rechten«: Die Taufe 25 »Ein Judensohn aber kein Jude«: Die Identität 27 Literatur 29 Ausbildung und Bildung (von R. Larry Todd) . 31 Mendelssohns frühe Ausbildung 31 Das familiäre Bildungsideal 32 Berliner Universität und »Grand Tour« 34 Lebenslanges Streben nach Bildung 35 Literatur 36 Die Familie (von Beatrix Borchard) . 37 Familienauftrag 38 Die Kernfamilie 39 Ehemann und Vater 42 Das öffentliche Bild der Familie Mendels- sohn 43 Literatur 45 Der Freundeskreis (von Michael Chizzali) . -

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847) Felix Mendelssohn Bartholdy war der Sohn eines wohlhabenden Bankiers namens Abraham Men delssohn und der Enkel des berühmten Philosophen und Reformators Moses Mendelssohn aus Berlin. Die philosophischen Theorien des Moses Mendelssohn, der ein Freund des Dichters Gotthold Ephraim Lessing war und diesem als Vorbild für den Charakter des Nathan in seinem Schauspiel "Nathan der Weise" diente, spielten in der liberalen Erziehung des jungen Felix eine wichtige Rolle. Als 12-jähriger spielte Mendelssohn für den alternden Johann Wolfgang von Goethe die Musik von J. S. Bach. Mit 17 etablierte er sich als Komponist mit der Ouvertüre zum „Sommernachtstraum“. Als Zwanzigjähriger dirigierte er Bachs fast 100 Jahre lang vergessene "Matthäuspassion" und leitet mit dem sensationellen Erfolg dieser Aufführung eine umfangreiche Bach-Renaissance ein. Die folgenden zweieinhalb Jahre verbrachte Mendelssohn auf ausgedehnten Reisen durch Europa, deren Früchte Werke waren wie die „Hebriden-Ouvertüre“, die „Schottische Sinfonie“ und die „Italienische Sinfonie“. Im Anschluss war er von 1833 bis 1835 Städtischer Musikdirektor in Düsseldorf, ab 1835 Kapellmeis- ter des Gewandhausorchesters in Leipzig und ab 1841 Generalmusikdirektor von König Friedrich Wil- helm IV. von Preußen. 1842 wirkte er bei der Gründung des Leipziger Konservatoriums mit. Trotz seiner zahlreichen Aktivitäten als Pianist, Dirigent und Lehrer war Mendelssohn Bartholdy ein überaus produktiver Komponist. Die von ihm komponierten Orgel- und Chorwerke gehören zu den besten des 19. Jahrhunderts. Sein umfangreiches musikalisches Schaffen im Bereich der sakralen Musik liegt wohl in der religiösen Geschichte seiner Familie und in der damit verbundenen Ausein- andersetzung des jüdischen und des christlichen Glaubens begründet. Mendelssohns frühzeitigem Tod im Jahr 1847 war eine kurze Krankheitsperiode vorangegangen, wahrscheinlich durch seine tiefe Trauer um den Tod seiner Schwester Fanny hervorgerufen. -

Mendelssohn Bartholdy
MENDELSSOHN BARTHOLDY Ruy Blas Ouvertüre / Overture Herausgegeben von / Edited by Christopher Hogwood Urtext Partitur / Score Bärenreiter Kassel · Basel · London · New York · Praha BA 9054 INHALT / CONTENTS Preface. III Introduction . IV Vorwort . IX Einführung . X Facsimiles / Faksimiles . XVI Ruy Blas Ouvertüre / Overture Version 1 / Fassung 1 . 1 Version 2 / Fassung 2 . 47 Critical Commentary . 95 ORCHESTRA Flauto I, II, Oboe I, II, Clarinetto I, II, Fagotto I, II; Corno I–IV, Tromba I, II, Trombone I–III; Timpani; Archi Duration / Aufführungsdauer: ca. 7 min. © 2009 by Bärenreiter-Verlag Karl Vötterle GmbH & Co. KG, Kassel Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved / Printed in Germany Vervielfältigungen jeglicher Art sind gesetzlich verboten. Any unauthorized reproduction is prohibited by law. ISMN 979-0-006-52290-3 PREFACE “Had Mendelssohn only titled his orchestral works in were popular in their time but set aside by Mendelssohn one movement as ‘symphonic poems’, which Liszt later and published posthumously in less than faithful ver- invented, he would probably be celebrated today as the sions. (e. g. Ruy Blas). Of his revisions, the Overture in C, creator of programme music and would have taken his op. B, received the most drastic enlargement, growing position at the beginning of a new period rather than the from a Nocturno for ? players in F@B to a full Ouvertüre end of an old one. He would then be referred to as the für Harmoniemusik (@ players and percussion) by FAF. ‘first of the moderns’ instead of the ‘last of the classics’ ” In other cases, with the exception of the Ouvertüre zum (Felix Weingartner: Die Sym phonie nach Beethoven, FGF). -

See Sample Pages
CMF10 MP3 + PDF MP3 and PDF download A Soprano’s carlfischer.com A Soprano’s Duet Book 10 Masterwork Duets from the Baroque, Duet Book Classic and Romantic Periods 10 Masterwork Duets from the Baroque, for Soprano and Another Voice Classic and Romantic Periods Compiled, Edited and Arranged by Patrick M. Liebergen for Soprano and Another Voice A Soprano’s Duet Book — Lieberbgen A Soprano’s Compiled, Edited and Arranged by Patrick M. Liebergen A Soprano’s Duet Book features ten of the world’s best-loved selections for soprano and another voice brought together for the first time in one collection. Representing a wide range of styles and composers, these selections from the Baroque, Classical, and Romantic periods are presented with historical information, IPA pronunciation guides, translations and suggestions for performance. If instrumental accompaniments were included in the original scores, then the keyboard accompaniments are reductions of those parts. Optional instrumental parts are also included for select pieces. Edited and arranged by Patrick M. Liebergen, this truly valuable collection is an indispensable resource for duet singing. ISBN 978-1-4911-5102-0 UPC www.carlfischer.com sample CMF10 CMF10cvr.indd 1-3 1/5/18 4:44 PM MP3 + PDF MP3 and PDF download A Soprano’s carlfischer.com Duet Book 10 Masterwork Duets from the Baroque, Classic and Romantic Periods for Soprano and Another Voice Compiled, Edited and Arranged by Patrick M. Liebergen sampleCopyright © 2018 by Carl Fischer, LLC International Copyright Secured. All rights reserved including performing rights. WARNING! This publication is protected by Copyright law. To photocopy or reproduce by any method is an infringement of the Copyright law. -

By Felix Mendelssohn Bartholdy
“CH’IO T’ABBANDONO” BY FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY: A DRAMATIC IMAGE OF THE EDUCATION AND APTITUDES OF THE COMPOSER Charles Turley, B.M., M.M. Dissertation Prepared for the Degree of DOCTOR OF MUSICAL ARTS UNIVERSITY OF NORTH TEXAS August 2002 APPROVED: Linda di Fiore, Major Professor John Michael Cooper, Minor Professor Jeffrey Snider, Committee Member and Voice Division Chair James C. Scott, Dean of College of Music C. Neal Tate, Dean of Robert B. Toulouse School of Graduate Studies Turley, Charles William, “Ch’io t’abbandono” by Felix Mendelssohn Bartholdy: A Dramatic Image of the Education and Aptitudes of the Composer. Doctor of Musical Arts (Performance), August 2002, 64 pages, 2 tables, 12 musical examples and illustrations, references, 39 titles. The unpublished concert aria, “Ch’io t’abbandono,” by Felix Mendelssohn Bartholdy (1825), is representative of the adolescent composer’s developing musical aesthetic. In this study, Mendelssohn’s education, work ethic, and perfectionism are revealed, paradoxically, as both the catalysts for the piece’s composition and also the reasons it was not published during Mendelssohn’s lifetime. An exploration of the text, form, thematic usage, and performance demands of the aria yields specific examples of his uniquely balanced romantic-classicist style. A consideration of possible original performers of the piece, Franz Hauser and Eduard Devrient, leads to further discussion about the nature of the work as both a reflection of Mendelssohn’s romantic self-expression and his appreciation for the Baroque melismatic style. The significance of the aria, both stylistic and biographical, is further delineated by a presentation of possible motivations for its composition. -

A Musical Cornucopia: Thirty Years of Correspondence Between Goethe and Zelter
Publications of the English Goethe Society ISSN: 0959-3683 (Print) 1749-6284 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/ypeg20 A Musical Cornucopia: Thirty Years of Correspondence between Goethe and Zelter Lorraine Byrne To cite this article: Lorraine Byrne (2005) A Musical Cornucopia: Thirty Years of Correspondence between Goethe and Zelter, Publications of the English Goethe Society, 74:1, 3-24, DOI: 10.1080/09593683.2005.11716336 To link to this article: https://doi.org/10.1080/09593683.2005.11716336 Published online: 04 Apr 2016. Submit your article to this journal Article views: 20 View related articles Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=ypeg20 Publications rif tl1e English Goetl1e Society, Volume LXXIV, 2005 A MUSICAL CORNUCOPIA: THIRTY YEARS OF CORRESPONDENCE BETWEEN GOETHE AND ZELTER By Lorraine Byrne National University oflreland, Maynooth Goethe's correspondence with Zeiter, which began in 1799 and lasted until1832, the year in which both friends died, is an important source for the poet's understanding of music, and testifies to his musical interest and intelligence. Goethe's correspondence with Zeiter not only records the poet's own constant musical activity and sincere concern to understand the art, but also highlights his interest in the history of music as part of the chronicle of human culture. His consultation with Zeiter about the music he heard provides a valuable chronicle of concert life in Germany at the beginning of the nineteenth century and yields insight into the reception of contemporary music and musicians. "While the beginning of Goethe's correspondence with Zeiter is marked by his dependence on the composer, frequently Goethe opens up their musical discussion and gradually this reliance diminishes. -

Carl Schurz Was in the Pledge Class of 1870
Appendix Gamma2: The Breslau Intellectual Line Connecting brothers of Phi Kappa Psi Fraternity at Cornell University, tracing their fraternal Big Brother/Little Brother line to the tri-Founders and their Pledges . Brother Carl Schurz was in the Pledge Class of 1870. . Carl Schurz was friends with Gottfriend . Felix Mendelssohn studied under Kinkel years . Carl Friedrich Zelter . . Gottfried Kinkel was spouse to . Carl Friedrich Zelter studied under Carl Johanna Kinkel. Friedrich Christian Fasch . . Johanna Kinkel studied music under . Carl Philipp Emanuel Bach studied Jewish musician, under Sylvius Leopold Weiss. Felix Mendelssohn . Below we present short biographies of the Breslau intellectual line of the Phi Kappa Psi Fraternity at Cornell University. “Who defends the House.” We begin with brother Carl Schurz (1870), tapped into Phi Kappa Psi at Cornell in the first class after the Founding: Carl Schurz (March 2, 1829 – May 14, 1906) was a German revolutionary, American statesman and reformer, and Union Army general in the American Civil War. He was also an accomplished author, newspaper editor and journalist, who in 1869 became the first German-born American elected to the United States Senate. His wife Margarethe Schurz and her sister Bertha von Ronge were instrumental in establishing the kindergarten system in the United States. During his later years, Schurz was perhaps the most prominent Independent The University of Bonn in American politics, noted for his high principles, his avoidance of political partisanship, and his moral conscience. Brother Schurz is famous for saying: "Our country right or wrong. When right, to be kept right; when wrong, to be put right." Many streets, schools, and parks are named in honor of him, including New York City's Carl Schurz Park. -

Yhtenäistetty Felix Mendelssohn Bartholdy
Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja 155 Yhtenäistetty Felix Mendelssohn Bartholdy Teosten yhtenäistettyjen nimekkeiden ohjeluettelo Heikki Poroila Suomen musiikkikirjastoyhdistys Helsinki 2013 Julkaisija Suomen musiikkikirjastoyhdistys Toimitustyö ja ulkoasu Heikki Poroila Toinen laitos, verkkoversio 1.0 © Heikki Poroila 2013 01.4 POROILA , HEIKKI Yhtenäistetty Felix Mendelssohn Bartholdy : teosten yhtenäistettyjen nimekkeiden ohjeluettelo / Heikki Poroila. – Toinen laitos, verkkover- sio 1.0. – Helsinki : Suomen musiikkikirjastoyhdistys, 2013. – 85 si- vua. – (Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja, ISSN 0784- 0322 ; 155). – ISBN 978-952-5363-54-8 (PDF) ISBN 978-952-5363-54-8 Lukijalle Felix MENDELSSOHN BARTHOLDY (Hampuri 3.2.1809 – Leipzig 4.11.1847) kuuluu saksalaisen varhaisromantiikan keskeisiin nimiin, mutta ei täysin kiistatta. Mendelssohnin aseman ristirii- taisuutta kuvastaa hyvin se, että vaikka monet hänen suosituimmista teoksistaan (esim. orato- riot Elias ja Paulus , viisi aikuisiän sinfoniaa tai musiikki Shakespearen Kesäyön unelmaan ) kuuluvat edelleen tavanomaiseen ohjelmistoon, hänen sävellystuotantoaan on tutkittu vähän ja ensimmäinen kunnollinen teosluettelo valmistui vasta vuonna 2009. Mendelssohnin suosio lienee edelleenkin suurempi esimerkiksi Isossa-Britanniassa kuin Saksassa. Suomessakaan Mendelssohn ei ole koskaan ollut erityisen suuressa suosiossa. Näin esimerkiksi Sulho Ranta teoksessa Sävelten mestareita (1945): “Mendelssohnia säveltäjänä oikein ymmärtääksemme on parasta unohtaa hänen -

The Development of a Fach System for the Tenor Oratorio Repertoire
James Madison University JMU Scholarly Commons Dissertations The Graduate School Spring 2017 The evelopmeD nt of a Fach System for the Tenor Oratorio Repertoire Randall C. Ball James Madison University Follow this and additional works at: https://commons.lib.jmu.edu/diss201019 Part of the Music Education Commons, Music Pedagogy Commons, Music Performance Commons, and the Music Practice Commons Recommended Citation Ball, Randall C., "The eD velopment of a Fach System for the Tenor Oratorio Repertoire" (2017). Dissertations. 145. https://commons.lib.jmu.edu/diss201019/145 This Dissertation is brought to you for free and open access by the The Graduate School at JMU Scholarly Commons. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of JMU Scholarly Commons. For more information, please contact [email protected]. The Development of a Fach System for the Tenor Oratorio Repertoire Randall Criswell Ball A Doctor of Musical Arts document submitted to the Graduate Faculty of JAMES MADISON UNIVERSITY In Partial Fulfillment of the Requirements for the degree of Doctor of Musical Arts School of Music May 2017 FACULTY COMMITTEE: Committee Chair: Kevin McMillan, M.M. Committee Members/Readers: Don Rierson, Ph.D. Jo-Anne van der Vat-Chromy, Ph.D. DEDICATION Soli Deo Gloria ii ACKNOWLEDGEMENTS First of all, I would like to thank my committee for their exceptional guidance throughout this process. Each one brought unique talents and singular perspective to my degree program and the scholarship involved in this document. I would like to thank Kevin McMillan for being my mentor, advisor, voice teacher, chair of my committee, cheerleader, and colleague throughout my doctoral program.