Der Nidwaldner Kaiserjass Und Seine Geschichte
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
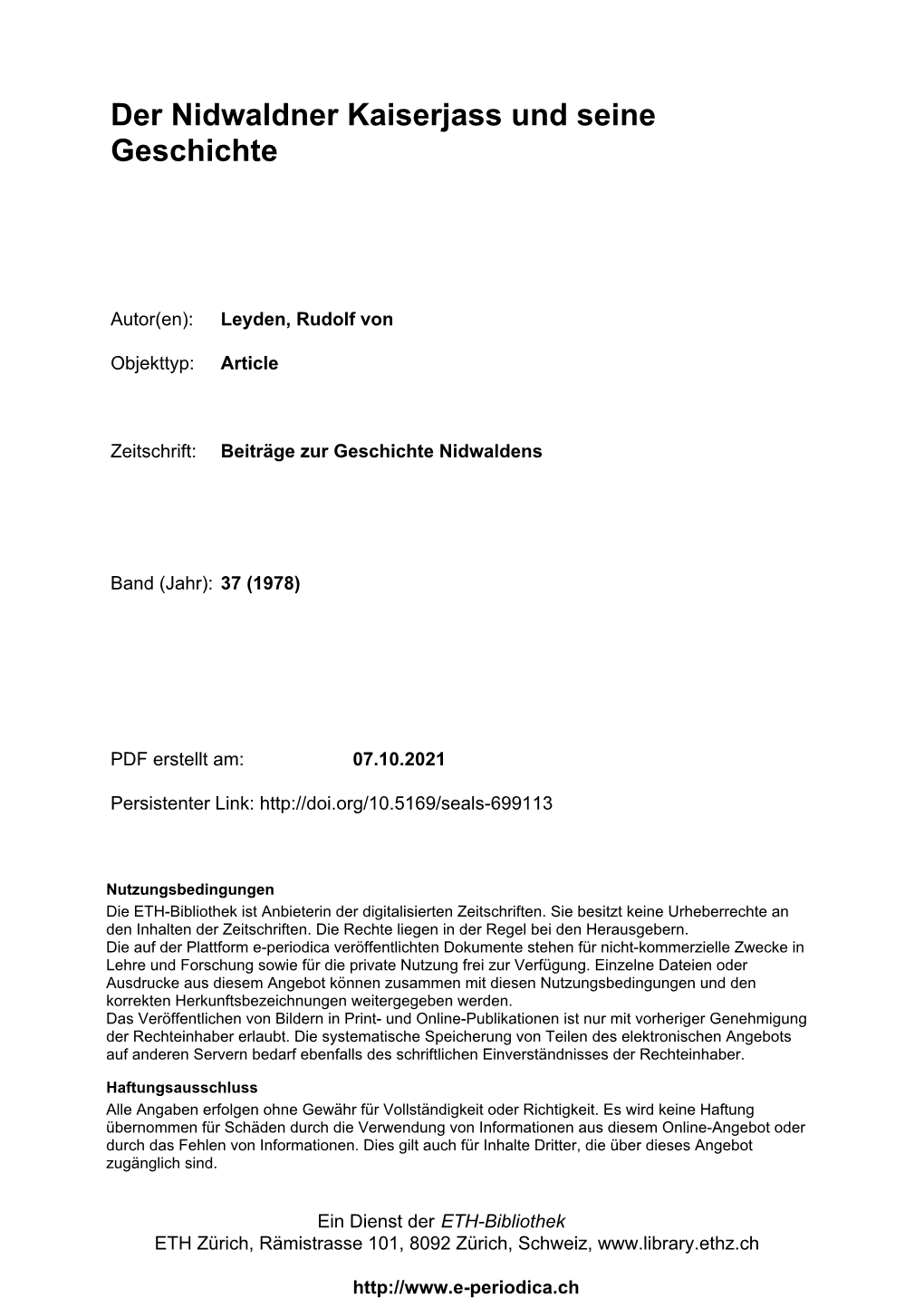
Load more
Recommended publications
-

Ab in Den Sand
VOLLEYBALL-TRAINING Ab in den Sand Rüdiger Naffin aus Schleswig- Holstein beschreibt in seinem Beitrag, wie man Schulkinder ohne großen Aufwand für Beach- volleyball begeistern kann Der Sommer beginnt, die Sonne scheint schon morgens, es wird rien sind also nicht drin. Dennoch müssen die Bälle Mindestan- ein schöner Tag. Ich freue mich schon auf viele strahlende forderungen erfüllen. Als wichtigste Eigenschaften haben sich Kindergesichter. Die Chance ist da, Schüler für Volleyball – vor ein angenehmes Kontaktgefühl auf den Armen beim Baggern allem Beachvolleyball – zu begeistern. Dabei ist es völlig egal, und eine gewisse Formstabilität herausgestellt. wie alt die Kinder sind, ob es sich um normalen Sportunterricht oder um eine Sport-Arbeitsgemeinschaft handelt. Ideen sind gefragt Die Beachanlage und die Spielfelder müssen schon vor der Ein Feld, 29 Schüler – das geht Stunde aufgebaut sein. Für eine große Zahl an Schülern werden Einer Klasse mit 29 Kindern Beachvolleyball beizubringen, das möglichst viele kleine Spielfelder benötigt. Auf einem normalen ist eine komplexe und interessante Aufgabe. Es geht darum, 29 Beachfeld lassen sich auf jeden Fall acht Kleinfelder einrichten Schüler auf dem einen Beachfeld unterzubringen, über das die (siehe Abbildung unten), bei entsprechendem Freiraum hinter Schule verfügt. Es dürfte also kuschelig eng werden. Eine Sport- dem Großfeld noch weitere Spielflächen. stunde von 45 Minuten erbringt höchstens 35 Minuten reine Für das Spiel eins gegen eins ergeben sich so für 24 Schüler Unterrichtszeit. Doch auch solch ungünstige Konstellationen Spielmöglichkeiten. Da ein dritter Spieler – zumindest auf den können gemeistert werden. Außerdem verfügen wir über einen äußeren Spielflächen –integrierbar ist, findet sich also auch für geringen Sportetat, Beachvolleybälle aus höheren Preiskatego- eine große Klasse ausreichend Platz. -

Weltmeister HE O40: Thorsten Hukriede
62. Jahrgang | 6. September 2019 | Ausgabe Nr. 9 Weltmeister HE O40: Thorsten Hukriede Foto: Pascal Histel YONEX.DE /yonexdeutschland /yonex.de RAPID FIRE ANYTIME YOU WANT Blue Green Red NANOFLARE ist die erste YONEX Racket-Generation, in der die neue Hochleistungs-Carbonfaser TORAYCA® M40X zum Einsatz kommt. Die aerodynamische, kopfl eichte Rahmenkonstruktion ermöglicht hohe Schwunggeschwindigkeiten und beste Manövrierfähigkeit. Das bringt entscheidende Speed-Performance und eine gewaltige Rückschlagpower in jeden Schlag. YONEX GMBH • 47877 Willich • Tel. 0 21 54 / 9 18 60 • Fax 0 21 54 / 91 86 99 • e-mail: [email protected] Impressum 3 Herausgeber: Inhalt Badminton-Landesverband NRW e.V. Geschäftsstelle: Weltmeisterschaft O35-O75 4 45470 Mülheim/Ruhr, Südstraße 23 Telefon: (02 08) 36 08 34 Silber & Bronze bei der Tokio-Generalprobe 10 Telefax: (02 08) 38 01 22 Redaktion: 1. NRW-RLT: Sieger in den Doppeldisziplinen 14 Geschäftsstelle 45470 Mülheim/Ruhr, Südstraße 23 Länderspiel: Deutschland - Niederlande 16 Herstellung: Sandra Bleich Fortbildungen 17 45470 Mülheim/Ruhr, Südstraße 23 Talent Scout Ausbildung 2020wieder in NRW 18 Erstellung Konzept und Layout: 25/8 Workshop „attrAktives Ehrenamt“ 21 Büro für Strategie, Design und Kommunikation Tußmannstraße 63 40477 Düsseldorf [email protected] www.25-acht.de Ligen. 22 Erscheinungsweise: 4. Arbeitstag im Monat Redaktions-/Anzeigenschluss: 14 Arbeitstage vor Monatsende Anzeigenpreise sind bei Amtliche Nachrichten [email protected] zu erfragen. ... Geschäftsstellen-Infos 27 ... aus dem Spielbetrieb 36 ... aus den Bezirken 38 Ansprechpartner beim BLV-NRW 40 Redaktionsschluss für die BR 10/2019 ist der 22.09.2019 (Posteingang). BLV-Geschäftsstelle: Badminton-Landesverband NRW Südstraße 23, 45470 Mülheim/Ruhr Telefon (02 08) 36 08 34 Telefax (02 08) 38 01 22 E-Mail: [email protected] Öffnungszeiten: Mo.-Do. -

Expertise Moll
Expertise Zur Bewerbung des traditionellen Kartenspieles „Perlåggen“ aus Alt-Tirol – heute noch verbreitet in Nord- und Südtirol – in die nationale Liste des immateriellen Kulturerbes Österreichs. Antragsteller ist das Institut für Alpenländische Traditionskartenspiele (Vorstand Hubert Auer). Das vorliegende Gutachten wurde von Bernhard Moll erstellt. Die nachfolgenden Ausführungen und Erklärungen beziehen sich auf das oben genannte Kartenspiel. Grundlage des Schreibens sind die von der Österreichischen UNESCO-Kommission veröffentlichten „Kriterien zur Aufnahme von Elementen in das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes“. 1. Perlåggen – Historisches allgemein Ursprung des Perlåggens: Die Anfänge des Perlaggens können auf etwa 1830 festgelegt werden. Schriftlich erwähnt wurden erste Spiele im Jahr 1833 im Gasthaus „Zum Pfau“ in Bozen. Seinen Ursprung hat es in heimischen Tiroler Spielen, u.a. dem Giltspiel. Die wahren Erfinder dieses Spieles – später beim Perlaggerkongress am 19. April 1890 in Innsbruck definitiv festgelegt – waren folgende vier Herren: Die Kanzlisten Alois von Perkhammer und Josef Pfonzelter und die Forstbeamten Ferdinand Gile und Johannes Sarer. Neben dem Spiel „Perlåggen“ wurden auch bevorzugte Karten im selbigen Spiel als „Perlagg“ getauft. Diese Bezeichnung kam vermutlich aus der Salurner Gegend. Dorthin war Herr Gile versetzt worden und hatte dort diese neue Arte des Giltens eingeführt. Die dortige Bevölkerung, die beide Landessprachen beherrscht, fand für diese Karten den ihnen zukommenden Namen. „Berlicche“ bedeutet den Teufel, und ein solcher ist auch unsere Karte - er erscheint in jeder gerade passenden Form. (Quellen: Quelle 1 - Büchlein „Das Tiroler National oder Perlagg-Spiel“ v. 1853, Verlag der Wagner’schen Buchhandlung; Quelle 2 - Taschenbuch „Perlåggen“ von 2014, Edition Raetia). Verbreitung des Perlåggens: Das Spiel fand großen Anklang und rasche Verbreitung in Nord- und Südtirol. -

Universitäts- Und Landesbibliothek Tirol
Universitäts- und Landesbibliothek Tirol Innsbrucker Nachrichten. 1854-1945 1906 11.10.1906 Bezugs -Preise : Am platze monatlich 80 h ; mit täglicher postver- lluf : Anzeigen werden billigst nach Tarif berechnet. — Bei mehrmaliger irndung in Gesterreich-Ungarn vierteljährig L 4 .—, nach Deutschland ^ , . r ; * f Einschaltung entsprechender Rabatt . — Unsere Verwaltung und jedes IC H.—. nach den übrigen Ländern des Weltpostvereins K 8.—. SchristleiMLg si5 . MerVattAirg 135 . Inseraten -Vureau des In - und Auslandes nimmt Aufträge entgegen V - 1 " - -- - - . — ' .. .. —- - 1 Donnerstag Nr . 288 11. Oktober 1906. Wochenkalend er: Montag 8. Brigitta . Dienstag 9. Dionysius . Mittwoch 10. Franz Borgias . Donnerstag 11. Emilian . Freitag l2 . f Maximilian . Samstag 18. Eduard , 2. Goldener Samstag . Sonntag 14. G 19 Burchard. dann soll die Wahlkreiseinteilung nur unter Hauptnutznießer der Wahlreform sind. Die Die Verhandlungen über die den Schutz einer Zweifünftelmajorität gestellt Tschechen müssen sich, ob sie wollen oder nicht, sein. in der Frage der Zweidrittelmehrheit über¬ Wahlreform. stimmen las,en, wenn sie nicht auf die erhöhte Damit wird er den Ansprüchen der Deut¬ Geltung Verzicht leisten wollen, die ihnen die Das allergrößte Interesse sämtlicher Parteien schen keineswegs gerecht, die die Wahlkreisein¬ und der Regierung wendet sich gegenwärtig dem Wahlkreiseinteilung mit einer so gewaltigen teilung, welche ihren nationalen Besitzstand dar¬ Paragraphen 42 der Reichsratswahl¬ Vermehrung ihrer Vertreterzahl in Aussicht stellen soll, gerade für die ferne Zukunft sichern ordnung zu , der, wie alle deutschen Volkspar¬ stellt. wollen. In den ersten Sessionen ist eine neuer¬ teien einmütig verlangen, den Schutz der Wahl¬ Der Ministerpräsident Freiherr von Beck hatte kreiseinteilung gegen eine Abänderung zum In¬ liche Wahlreform ohnehin so gut wie ausge¬ vorgestern abend eine bis halb. -

Das Kaiserspiel : Nidwaldner Spielkarten Aus Dem 16
Das Kaiserspiel : Nidwaldner Spielkarten aus dem 16. Jahrhundert Autor(en): Baumgartner, Christoph Objekttyp: Article Zeitschrift: Traverse : Zeitschrift für Geschichte = Revue d'histoire Band (Jahr): 22 (2015) Heft 3: Scandale! = Skandal! PDF erstellt am: 06.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-650805 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch -

Kaisern (Kartenspiel) – Wikipedia
Kaisern (Kartenspiel) – Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Kaisern_(Kartenspiel) Kaisern (Kartenspiel) aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie Das Kaiserspiel oder Kaisern (genannt Cheisärä) ist ein Kartenspiel, das mit 48 Karten gespielt wird. Oft wird fälschlicherweise auch der Begriff Kaiserjass genannt, obwohl das Kaisern nichts mit Jassen zu tun hat. Inhaltsverzeichnis 1 Geschichte 2 Kartenblatt 2.1 Bezeichnungen 3 Das Karnöffelspiel 3.1 Spieler 3.2 Stichwert der Karten 3.3 Spielablauf 4 Das Silener Kaiserspiel 4.1 Spieler 4.2 Karten 4.3 Stichwert der Karten 5 Literatur 6 Weblinks Geschichte Das Kaiserspiel ist eine Ableitung vom Karnöffel (Karniffel), eines der ältesten bekannten Kartenspiele wenn nicht das älteste überhaupt. Karnüffeln wird im Jahre 1426 zum ersten Male genannt. Das lässt vermuten, dass es schon einige Jahre früher bekannt gewesen sein muss. Das Karnöffelspiel war in Nördlingen (1426) erlaubt und später in Würzburg und Zürich erwähnt (1443). In Augsburg war das Karnöffelspiel ausdrücklich verboten (1446), während andere Spiele erlaubt waren. Eine Aussage von Johann Geiler von Kaysersberg (1496) soll belegt, dass das Kaiserspiel identisch mit dem Karnöffelspiel ist. Karnöffelspiel Der Karnöffel ist der Name für einen groben Landsknecht. Das (der) Karnöffel war ein vulgärer Ausdruck für einen Hodenbruch oder ein Hodengeschwür. Gegen Ende des 15. und im 16. Jahrhundert war es eines der bekanntesten und verbreitetsten Kartenspiele. Die Landsknechte sorgten für eine weite Verbreitung. Der Karnöffel, der Trumpf- Untermann, ist die höchste Karte im Spiel. Er sticht Papst und Kaiser, König und Obermann. Somit konnte er zum Sinnbild einer revolutionären Zeit werden, da die niedrigen Karten (Fussvolk) die hohen Stecher sind. -

4 Lerne Watten Lerne Watten 5 Inhalts- Verzeichnis 2.2
4 Lerne Watten Lerne Watten 5 Inhalts- verzeichnis 2.2. Anzahl der Spieler .................................................................................................................................................... 14 2.3. Die drei Kritischen ................................................................................................................................................... 15 Vorwort ..........................................................................................................................................................................................................2 2.4. Ziel des Spiels .............................................................................................................................................................. 16 Inhaltsverzeichnis ..........................................................................................................................................................................................4 Impressum ..........................................................................................................................................................................................................8 3. Der Ablauf eines Spiels ....................................................................................................................................................... 18 3.1. Das Verteilen der Karten ................................................................................................................................. -

Kaiser-Kartenspiel Nach Lungerer-Art Zentralschweiz
Kaiser-Kartenspiel nach Lungerer-Art Zentralschweiz Spielen ist eine lustvolle Allmende - Seite II Spielanleitung - Seite 1 Bilddarstellung der Machtpositionen - Seite 19 frei, DrDr Johannes Gasser, Lungern / Wiesendangen, 2015- 2017 [email protected] Weitere Angaben: www.kaisern.flow-akademie.ch Kaiser-Reglement Lungerer Art - II - Copyright frei zum Spiel DrDr. Johannes Gasser 2015 >Top Vorwort zur Allmende des Spielens Dieses Reglement wurde zusammengestellt und mit Innovationen ergänzt durch DrDr. Johannes Gasser. Diese Spielanleitung ist frei verfügbar gemäss den Normen und der Achtsamkeit von --> “creativ commons”, mit Verweis auf den Ursprung. Der Grund für dieses freizügige zur-Verfügung-Stellen liegt im Wesen des Spiels. Spielen ist die freie und elementare Auseinandersetzung mit aller Wirklichkeit. Deshalb gehören alle Spiele zu Allmenden. Ein Allmende ist eine frei verfügbares Gut (ein Gemeingut), das allen Menschen unentgeltlich zur Verfügung steht. Früher waren das Weideplätze, die allen interessierten Bauern zur Verfügung standen. Heute sind öffentliche Strassen und Plätze Allmenden (“commons” = Plätze für alle). Ebenso sind wissenschaftliche For- schungen und Erkenntnisse Allmenden, wie auch die Menschenrechte. Alle lebendigen Spiele sind Allmenden und stehen allen Menschen frei verfügbar, ohne Kosten und Pflichten, und ist nur mit dem Ruf nach Achtsamkeit verbunden. Die Spiel-Regeln können ergänzt oder variiert werden. Sie sind frei. Das gehört zum Wesen des Spiels. Diese Spielanleitung (Reglement) steht im Dienste eines sehr raffinierten Spiels, das seit dem 15. Jahrhundert geeignet ist, grosse Leidenschaft zu entfachen, lustvollen Austausch zu gewähren und das Listkunde benötigt. Es hat Verwandtschaft mit dem Tarot (Tarock) und dem Poker. Seine Vorläufer sind die “trionfi”-Spiele Italiens, auch “Imperatori-Spiele” (Kaiser-Spiele) genannt (in der ersten Hälfte des 15. -

Gasthof Grauer Bär : 1
Universitäts- und Landesbibliothek Tirol Innsbrucker Nachrichten. 1854-1945 1909 4.12.1909 Jahrgang. 1909. Bezugs -Preise : Km platze monatlich SO h ; mit täalicker poitver - - Nttf ' Anzeigen werden billigst nach Tarif berechnet. — Lei mehrmaliger senüung in Gelterreich-Unaarn vierteljährig L 4.—. nachDeutschland^ , / -J* « Einschaltung entsprechenderRabatt. — Unsere Verwaltung und jedes K ö.—. nach den übrigen Ländern des Weltpostvereins K S.—. Schrrfltnrung 211 . Kermatluug 13o . Inferaten -Vureau des In - und Kurlande » nimmt Kufträgr entgegen. Samstag Nr . 2784 . Dezember 1909 Wochenkalender: Montag 28. Ratbot . Dienstag 30. Andreas , Apostel. Mittwoch 1. Eligius . Donnerstag 2. Bibiana I . Freitag 3. ff Franz Xaver. Sams¬ tag 4. Barbara K. Sonntag 5. Tabbas , Abt. angemaßt, auch nicht bezüglich der tschechischen Zur Tagesgeschichte. Die slavischen Landsmannminister, deren persönliche Qualifi¬ Wünsche. kation und politische Distinktion nicht im ge¬ Österreich-Ungarn. Wir haben gestern den Inhalt jenes Be¬ ringsten an die der bisherigen Träger des deut¬ schen Vertrauensamtes heranreicht. Man erin¬ Mji l i tä r i scheK o ns er en zen..Gestern vor-" schlusses der Slavischen Union mit geteilt, wel¬ mittags begannen in der Hofburg die mit- chen die Herren Kramarsch und Schusterschitznert sich, daß erst die beispiellose Einflußnahme der tschechischen Landsmannminister aus sämt¬ tärischen Beratungen unter dem Vorsitze des als geeignet erachten, eine Verständigung mit Kaisers. An ihnen nahmen teil : Erzherzog den regierungsfreundlichen Parteien -

The Classified Encyclopedia of Chess Variants
THE CLASSIFIED ENCYCLOPEDIA OF CHESS VARIANTS I once read a story about the discovery of a strange tribe somewhere in the Amazon basin. An eminent anthropologist recalls that there was some evidence that a space ship from Mars had landed in the area a millenium or two earlier. ‘Good heavens,’ exclaims the narrator, are you suggesting that this tribe are the descendants of Martians?’ ‘Certainly not,’ snaps the learned man, ‘they are the original Earth-people — it is we who are the Martians.’ Reflect that chess is but an imperfect variant of a game that was itself a variant of a germinal game whose origins lie somewhere in the darkness of time. The Classified Encyclopedia of Chess Variants D. B. Pritchard The second edition of The Encyclopedia of Chess Variants completed and edited by John Beasley Copyright © the estate of David Pritchard 2007 Published by John Beasley 7 St James Road Harpenden Herts AL5 4NX GB - England ISBN 978-0-9555168-0-1 Typeset by John Beasley Originally printed in Great Britain by Biddles Ltd, King’s Lynn Contents Introduction to the second edition 13 Author’s acknowledgements 16 Editor’s acknowledgements 17 Warning regarding proprietary games 18 Part 1 Games using an ordinary board and men 19 1 Two or more moves at a time 21 1.1 Two moves at a turn, intermediate check observed 21 1.2 Two moves at a turn, intermediate check ignored 24 1.3 Two moves against one 25 1.4 Three to ten moves at a turn 26 1.5 One more move each time 28 1.6 Every man can move 32 1.7 Other kinds of multiple movement 32 2 Games with concealed -

Grundsätzliches Zum Watten. Bieten & Perlaggen 8 Allgemeine
Inhaltsverzeichnis Grundsätzliches zum Watten. Bieten & Perlaggen 8 Die Spielkarten 10 Allgemeine Kartenspielbegriffe 12 Etwas vom Watten 15 Watten 16 Zweier- und Viererwatten 17 z.ammheben und Geben 17 Das Vergeben 17 Trumpf und Schlag bestimmen 18 Schläge“ 19״ Rechte“ und die״ Der Schönere und Schlagtauch 21 Falche Reihenfolge beim Geben 22 Stichemachen 22 Spiel“ gewonnen ist 23״ Wann ein DieSchrift 24 Gestrichen“ sein 24״ Der Schneider und der z ’ruckschneider 25 Das Bieten beim Watten 25 Das Bieten auf die letzte Karte 27 Das Bieten bei,,Gestrichen“ 28 Das Jagen/Bluffen 28 beim 29 Gegenseitige spieierhaftung 29 Das Deuten 30 Wie gedeutet wird 31 Strafwürdige Regelverstöße 32 Die Regeln des Tiroler Wattervereins 33 ״ Casinos Austria33״ Die Regeln der Einfache Varianten des Wattens 34 Stichwatten 35 BlindesStichwatten 35 Beliebte Varianten des Wattens 36 Ladinisch-Watten/Blindwatten 36 Verschiedene Varianten des Ladinisch-Wattens 39 Kritisch-Watten 43 Kritisch-Watten mit 33 Karten 43 Kritisch-Watten mit 32 Karten/Bayrisch-Watten 44 TTT 45 י ו י זז Besonderheiten beim Bayerisches Vokabular 47 Weitere Varianten 48 Kritisch-Ladinisch 48 “Guaten״ Kritisch-Ladinisch mit dem für acht Spieler 48 üppet 48 Bîeten/Laubbîeten 50 Abheben und Geben 51 Ausspielen und Stechen 51 DieFiguren 52 Die Bewertung der Figuren 54 Das Bieten 54 Jagen/Bluffen beim Bieten 57 Farbverleugnen/Regelverstoß 57 Gestrichen/Gespannt 59 Das Ausgehen 59 Das Vorgebotene geht aus 60 Variante Welibieten 61 Variante Spitzbieten 62 Das Perlaggerlied 64 Perlaggen бб Wie die Trumpffarbe bestimmt wird 67 DiePerlåggen 68 Perlaggen taufen 68 Übersicht Perlåggen & Trümpfe 70 SonderregelungbeimAbheben 72 Sonderregelung beim Trumpfaufschlagen 72 Die Figuren 73 Das Deuten 76 DasBieten 77 Jagen/Bluffen beim Perlaggen 78 in natur“ 79״ Figur le man ausmacht/ausgeht 79 Eichelperlaggen 82 Die Perlaggen beim Eichelperlaggen 83 Aufschlagen und Austauschen 84 Deuten beim Eichelperlaggen 85 Das Gilten/Giltspiel 87 وﺀ Kleines Leidkon Watterlatein. -

IV. Bewerbungsformular
IV. Bewerbungsformular 1. Kurzbeschreibung des Elements Betreffend die nachstehenden Punkte 3 – 9. Maximal 300 Wörter. Perlåggen : Ein altes, geselliges, gleichzeitig strategisch anspruchsvolles Kartenspiel aus Alt-Tirol (heute noch verbreitet in Nord- und Südtirol). 33 Spielkarten mit deutschen Farbzeichen (Eichel, Laub, Schell, Herz) – in Nordtirol „Doppeldeutsche“. In Südtirol (Autonome Provinz Bozen – Südtirol) wird überwiegend mit den „Einfachdeutschen“ gespielt. Die richtige Benennung ist „Salzburger Blatt“. (Kurioserweise sind diese Spielkarten im Lande Salzburg in heutiger Zeit nicht mehr in Verwendung, ja praktisch unbekannt.) Gespielt wird hauptsächlich zu viert, wobei sich zwei Teams kreuzweise gegenübersitzen (kann auch zu zweit, zu dritt oder zu sechst gespielt werden). Einige Spielelemente kennt man von den in Alt-Tirol ebenfalls altüberlieferten Kartenspielen „Watten“, „Laub-Bieten“ und „Kritisch-Watten“. Das Besondere beim Perlaggen ist aber, dass je nach Ort und Situation sechs oder sieben oder gar acht Spielkarten mit einer Sonderfunktion ausgestattet sind und zwar, dass sie in jede beliebige Karte verwandelt werden können, geradeso wie der in England nach 1860, also ca. 30 Jahre später eingeführte „Joker“ in anderen Kartenspielen. 2. AntragstellerInnen Nur die Gemeinschaft, die das immaterielle Kulturerbe tradiert oder ein/e von ihr ernannte/r VertreterIn kann sich um die Eintragung einer Tradition in das österreichische Verzeichnis bewerben. Institut für Alpenländische Traditionskartenspiele (Watten, Bieten, Gilten