Röderhof Und Huysburg
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
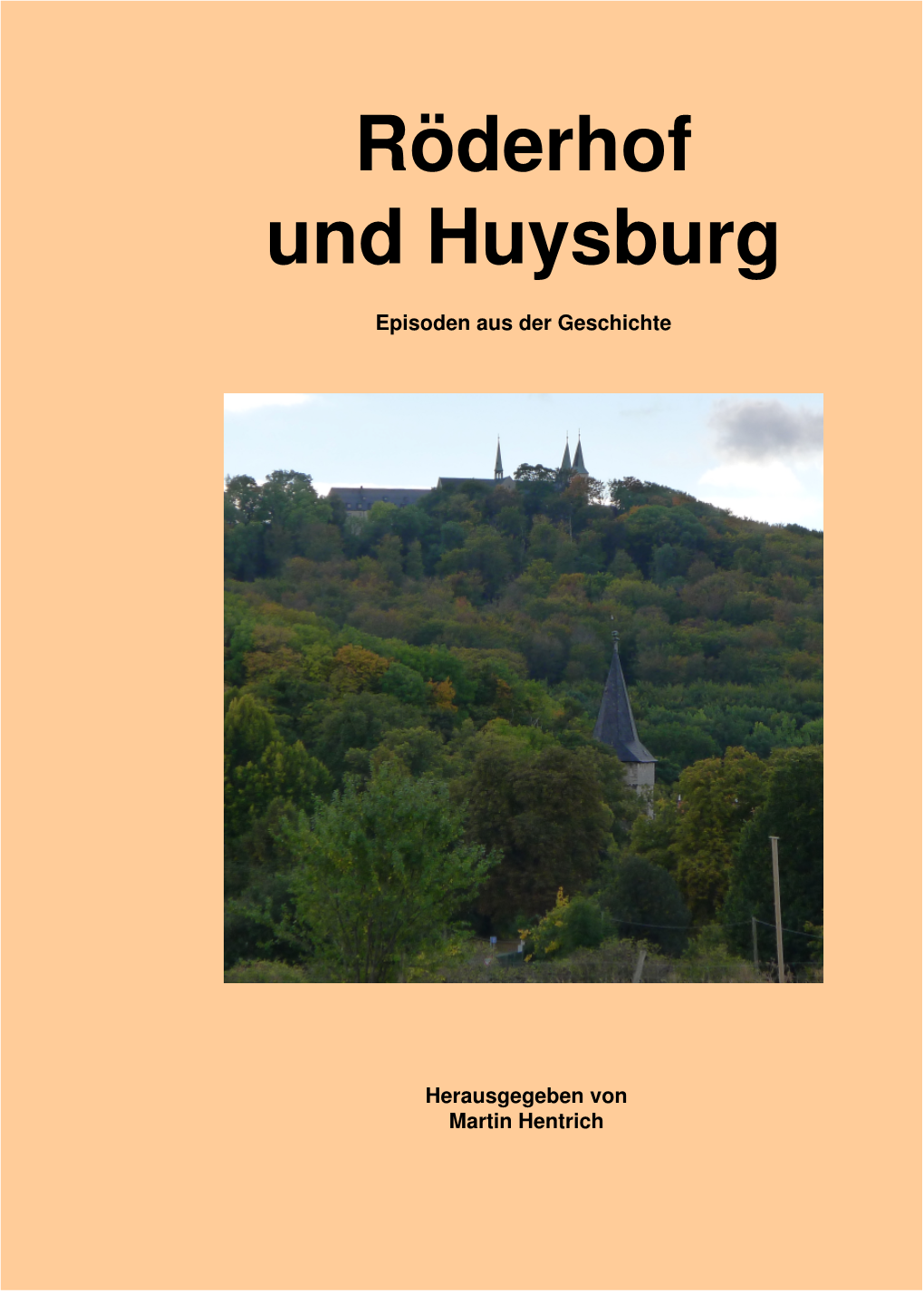
Load more
Recommended publications
-

Wernigerode Schermke Bundesstraße Wald Osterode Neuwegersleben Landstraße Über Gasthaus Steinerne Renne Hornburg Länge: Ca
Ausgewählte Landkreisgrenze Ortschaft LANDKREIS HARZ Autobahn See Brockenaufstiege Ampfurth Fluss Hamersleben Bundeskraftfahrtstraße Gunsleben Großer Grab en Ausgangspunkt: Wernigerode Schermke Bundesstraße Wald Osterode Neuwegersleben Landstraße über Gasthaus Steinerne Renne Hornburg Länge: ca. 14 km (ca. 850 Höhenmeter zu überwinden) Veltheim Dedeleben Aderstedt Hessen Eisenbahn Dauer: ca. 4,5 Stunden OSCHERSLEBEN Schladen Pabstorf Peseckendorf Markierung: durchgängige Markierung roter Punkt im Dreieck Schmalspurbahn Rohden Rohrsheim Schlanstedt Strecke: GROSSER Vogelsdorf Klein Germersleben B 245 Wulferstedt Klein Oschersleben – OT Hasserode / Floßplatz, Gasthaus Steinerne Renne, Hannecken B 79 bruch (MolkenhausChaussee), links abbiegen in den Höllenstieg bis FALLSTEIN B 244 A 395 Gemeinde Huy UNESCO Oranierroute zum Glashüttenweg, rechts abbiegen, Brockenstraße bis zum Gipfel Groß Germersleben Straße der Romanik Eilsdorf Hordorf Welterbe Bühne Deersheim Wülperode Anderbeck über Thumkuhlental, Glashüttenweg Badersleben Deutsche Standorte Länge: ca. 18 km (ca. 850 Höhenmeter zu überwinden) Dardesheim Eilenstedt Großalsleben Gartenträume Dingelstedt Hadmersleben Fachwerkstraße Dauer: ca. 5 Stunden Lüttgenrode Krottdorf Kleinalsleben Markierung: verschiedene Osterwieck Schwanebeck Strecke: Vienenburg Wiedelah Huy Neinstedt B 244 Röderhof – OT Hasserode / Floßplatz, Drängetal, Lossendenkmal, Thumkuhlental Ilse Wanderwege Radwege (Geologischer Lehrpfad), Ellenbogenchaussee (Bergwachthütte), Berßel Westeregeln Glashüttenweg (HarzerHexenStieg), -

Auf Diesen Bus-Linien Gilt HATIX
ê Braunschweig Alt Wallmoden ê Magdeburg ê 650 Klein Mahner ê Beuchte 822 Dardesheim 834 ê Neu Wallmoden ê 860 ê Hildesheim 212 Deersheim Huy Schwanebeck ê Braunschweig ê Bredelem 833 Vienenburg 210 Berßel 214 ê Hessen Osterwiek Nienhagen Schauen Zilly Sargstedt Hahausen Aspenstedt ê Dardesheim 222 236 Neuerkrug ê Liebenburg 852 Athenstedt 220 ê Dedeleben 273 Gröningen 801 802 803 Abbenrode 836 ê Rhüden Langelsheim 213 Groß Quenstedt Emersleben Astfeld 804 805 806 821 Wasserleben 210 Bornhausen Deesdorf Langeln Innerstestausee Wolfshagen Schachdorf Danstedt im Harz Goslar 874 Stöbeck Oker Veckenstedt Heudeber 832 Rammelsberg 866 873 1 2 11 12 Stapelburg Granestausee 810 871 272 Halberstadt 13 14 15 16 859 Seesen 271 275 234 Bad Harzburg Baumwipfelpfad 270 Harsleben Wegeleben Lautenthal Reddeber Minsleben 231 Herrhausen Hahnenklee Rabenklippen 201 202 Derenburg Ilsenburg Langenstein Kirchberg 861 830 Drübeck 203 204 Silstedt Hedersleben Radau-Wasserfall 875 Münchehof 205 831 Bockswiese Wernigerode 837 Plessenburg Darlingerode Schulenberg Okerstausee ê Ildehausen Schloss 233 Regenstein Eckerstausee Benzingerode Höhlenerlebnis- Wildemann 841 Ditfurt zentrum 250 Heimburg 820 274 842 Brocken Bad Grund 1.141 m Michaelstein Westerhausen 235 232 ê Heteborn/Gatersleben/ Altenau Torfhaus 264 Clausthal- 230 206 Nachterstedt Gittelde 460 Schaubergwerk Blankenburg Schaubergwerk Zellerfeld Büchenberg 252 Hohnehof Büchenberg Cattenstedt Teufelsmauer Windhausen Oderbrück 261 Schloss Timmenrode 251 Quedlinburg Buntenbock Warnstedt Badenhausen 840 Stieglitzecke -

Entsorgungskalender Halberstadt
Entsorgungskalender 2021 Stadt Halberstadt und Osterwieck sowie Gemeinde Huy und Vorharz INHALT 2 Inhalt Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! Es freut mich, dass Sie den neuen Entsorgungskalender in Ihren Händen halten. Er bietet Ihnen alle Informationen rund um die Abfallentsorgung. Das Jahr 2020 stellte uns alle mit dem Ausbruch des Coronavirus vor unvorstellbare Veränderungen. Jeder von uns leistete seinen ganz eigenen Beitrag. Ich bin stolz, dass es durch das Engagement der Beschäftigten in der öffentlichen 22 Vorwort Abfallentsorgung dennoch gelungen ist, alle Leistungen uneingeschränkt aufrechtzuerhalten. Ob Sammlung der Abfälle an den ca. 70.000 Grundstücken 16 Abfuhr Weihnachtsbäume oder Betrieb der acht Wertstoffhöfe, die Dienstleistungen wurden vollständig fortgeführt. Mein Dank richtet sich deshalb an die Mitarbeiter der von der 20 Tourenplan Hausmüll enwi beauftragten Entsorgungsunternehmen, der Wertstoffhöfe, der weiteren Einrichtungen und der Verwaltung. 24 Entsorgung Was gibt es Neues im Jahr 2021? Leichtverpackungen Gelbe Tonne statt Gelber Sack - Markant wird die vorgesehene Umstellung in weiten Teilen des Landkreises Harz vom Gelben Sack auf die Gelbe Tonne 26 Gebührenübersicht sein. Sie betrifft mehr als 80 Prozent der Orte. Die Entsorgungsintervalle bleiben bestehen. Obwohl die Sammlung des Dualen Systems komplett 28 Tourenplan Altpapier privatwirtschaftlich organisiert und finanziert wird, sind wir stolz, die Wünsche der Städte und Gemeinden gegenüber den privaten Betreibern des Systems vollständig durchgesetzt zu haben. Die Ortsbilder werden gewinnen und die 32 Tourenplan biologische unangenehmen Nebeneffekte des Gelben Sackes entfallen. Zwar benötigt Abfälle die Gelbe Tonne im Vergleich zum Gelben Sack etwas mehr Platz auf dem Grundstück, doch in der Abwägung liegen die Vorteile der Systemumstellung 34 Tourenplan Schadstoffmobil auf der Hand. -

Protokoll Der 11
Protokoll der 11. Sitzung der LAG „Rund um den Huy“ vom 02.07.2020 Wo: „Edelhofhalle“, Edelhof 48, 38835 Deersheim Beginn: 18:00 Uhr Ende: 20:45 Uhr Sitzungsleitung: Herr Bogoslaw, LAG-Vorsitzender Referent: Herr Schmidt, LEADER-Manager Frau Mielchen Protokoll: Frau Birkholz Teilnehmer: 21 von 26 LAG-Mitgliedern (81 %); davon: 16 von 21 WiSo- Partnern, davon 3 mit Vertretungsvollmacht 5 von 5 Kommunalvertretern; davon 1 Vertretungsvollmacht Gäste: Herr Dietrich, Landesverwaltungsamt Halle Frau Horn, ALFF Mitte, Halberstadt Frau Dill, Landkreis Harz Tagesordnung: 1. Begrüßung, Protokoll der 10. LAG-Sitzung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 2. Projektwettbewerb zur Prioritätenliste 2020b - Vorstellung, Bewertung und Beschluss der Projekte - Beschluss der Prioritätenliste 2020b 3. Information zum Umgang mit Restmitteln ELER/ESF 4. Stand der Planung „Neue Förderperiode“ zu Top 1 – Begrüßung und Protokoll Herr Bogoslaw eröffnet die Sitzung um 18:00 Uhr, begrüßt die LAG-Mitglieder sowie die anwesenden Gäste. Feststellung der Beschlussfähigkeit: Der LAG-Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit der 11. Sitzung der LAG „Rund um den Huy“ fest. Die Tagesordnung wird bekannt gegeben und einstimmig angenommen. Protokoll: Das Protokoll der 10. LAG-Sitzung vom 24.10.2019 wird mit 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt. Herr Bogoslaw belehrt über den Interessenkonflikt und bittet um Beachtung bei der Be- schlussfassung. Der Vorsitzende begrüßt Herrn Steckhahn, der seine Bereitschaft zur Mitarbeit in der LAG „Rund um den Huy“ erklärt hat und bittet ihn um Vorstellung seiner Person. Herr Steckhahn stellt sich vor. Er ist aus Berlin in den OT Dingelstedt am Huy/Gemeinde Huy gezogen und erachtet LEADER aus eigener Erfahrung als gutes Förderprogramm für den ländlichen Raum. -

Polizeirevier Harz
Polizeimeldung: 182/2021 Halberstadt, den 15.06.2021 Polizeirevier Harz Kriminalitätsgeschehen Frau verliebt sich und wird um mehrere tausend Euro betrogen Gemeinde Huy – Eine 61-jährige Frau aus der Gemeinde Huy wurde Opfer des sogenannten Love-Scamming. Die Frau hatte sich über eine Internetplattform angemeldet, um neue Kontakte, im besten Fall eine neue Liebe zu finden. Über diese Plattform lernte sie Ende April 2021 einen Mann kennen. Er konnte sehr schnell das Vertrauen der Frau gewinnen und man schrieb sich privat. Nach einigen Tagen bat der Mann die Frau erstmals um Geld. Seit Mai bis Anfang Juni 2021 überwies die Frau immer wieder Geldbeträge, insgesamt über 20.000 Euro. Eine Bankangestellte kam dies seltsam vor und sprach die Frau darauf an. Diese war im Begriff weiteres Geld zu überweisen. Erst jetzt erkannte sie, dass sie auf eine Betrugsmasche hereingefallen war. Die Betrugsmasche ist nicht neu. Sogenannte Love-Scammer nutzen die Einsamkeit der Menschen aus. Auf Online-Dating- Plattformen oder in sozialen Netzwerken werden potenzielle Opfer gesucht. Hat der Täter ein passendes Mitglied gefunden, fangen sie wie in jeder anderen anbahnenden Internet-Bekanntschaft mit einem Chat an. Die Täter schenken ihrem Opfer besondere Aufmerksamkeit, sie melden sich oft und sind sehr charmant. Oftmals telefonieren die Täter auch mit den Opfern, sind sehr interessiert an ihrem Leben und erzählen auch von ihrem Leben. In kürzester Zeit wird ein sehr enges Verhältnis aufgebaut. Meist wird dann eine Notlage geschildert, die die Überweisung oder Übergabe von größeren Geldsummen erforderlich macht. Die Opfer sind gutgläubig und überweisen oft ohne Zweifel das Geld. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche eindringlich. -

Broschüre Schätze LAG Rudh
veRborgenE schäTze aN der stRasse der roManik Entdeckungen in der Region Rund um den Huy Liebfrauenkirche Halberstadt Verborgene Die Broschüre „Verborgene Schätze an der Straße der Romanik” ist ein Projekt der Schätzeander Lokalen Aktionsgruppe Rund um den Huy und wurde mit LEADER-Mitteln aus dem Straße der Romanik Europäischen Struktur- und Investitionsfonds und dem Land Sachsen-Anhalt gefördert. Inhalt Schatzsucher auf Entdeckungstour |04 Zukunftsträchtige Perspektiven |05 Paradies für Naturfreunde und Urlauber |06 Chancen der Region stärken | 07 InhaltGeburtsstunde eines Erfolgsprojektes | 08-09 Stationen der Straße der Romanik Dedeleben: Burg Westerburg |10 Osterwieck: St. Stephani |10 Kloster Huysburg |11 Kloster Gröningen mit Klosterkirche St. Vitus |11 Halberstadt: Dom, Domschatz und Liebfrauenkirche |12 St. Vitus in Drübeck und Kloster Ilsenburg |12 Zisterzienserkloster Michaelstein bei Blankenburg |13 Quedlinburg: St. Servatius und Basilika St. Wiperti |13 Übersichtskarte | 14-15 Stationen der Verborgenen Schätze an der Straße der Romanik der LAG Rund um den Huy 1 Rohrsheim | 16-17 2 Hessen | 18-19 3 Schlanstedt | 20-21 4 Eilenstedt | 22-23 5 Osterwieck | 24-25 6 Ströbeck | 26-27 7 Halberstadt | 28-31 8 Langenstein | 32-33 9 Nienhagen | 34-35 Ob per pedes oder mit dem Fahrrad |36 Kontakte |38 Impressum |39 Titelseite: Schloss Hessen der RomAnik an der StrAsse schÄtze VerBoRgeNe 3 Schatzsucher auf Entdeckertour ichts ist spannender als Geschichte, wenn ihre Ge- Felsenwohnungen in Langenstein Nschichte detailreich und faszinierend erzählt ist. Egal, ob sie in der Urzeit, dem Mittelalter, der Re- naissance, Aufklärung, Industrialisierung oder in der Jetzt- zeit spielt – die Menschen wollen gerührt und entführt werden. Gerade im mitteldeutschen Raum und, im Spe- ziellen, in der Region um Magdeburg kann man sie heute auf Zeitreisen erkunden. -

Hochwasserrückhaltebecken Wippra
Umweltbericht zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 25 - Entwurf „Parkplatz Glasmanufaktur Harzkristall“ Stadt Wernigerode (Harz) Auftraggeber: Glasmanufaktur Harzkristall GmbH & Co KG Im Freien Felde 5 38895 Derenburg Sylvestristraße 4 38855 Wernigerode Tel.: 03943 92 31 0 Mail: [email protected] Projektbearbeiter: Dipl. Biol. Dorothee Wolf Marco Jede Datum: 25.05.2018 Büro für Umweltplanung Dr. Friedhelm Michael Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ................................................................................................................ 1 1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes ........................................... 1 1.1.1 Geltende Rechtsgrundlagen ..................................................................................................... 1 1.1.2 Belange des Umweltschutzes im Planvorhaben ....................................................................... 2 1.1.3 Bezüge aus den Fachplanungen zum Planvorhaben ............................................................... 3 2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen ................................. 10 2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale 10 2.1.1 Schutzgut Mensch .................................................................................................................. 11 2.1.2 Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt ................................................................. 12 2.1.3 Schutzgut Luft und Klima ....................................................................................................... -
The Brocken in Harz National Park the Brocken I 1
LEGENDARY MOUNTAIN The Brocken in Harz National Park THE BROCKEN I 1 Dear National Park guests 1 Views of the Harz foothills Do you want to know why the spruce on Brocken are barely From board 1 you see lying in front of you not only Renne- taller than 5 metres, when the Brocken Railway first reached ckenberg, Hohnekamm and Jägerkopf, but also Wernigerode the mountain top, or when the National Park was established? Castle (13 km) and Halberstadt (32 km). Then this brochure should accompany you during your visit to When you look closely you will notice that the Harz foothills the highest mountain in northern Germany. are characterized by intensive industrial and agricultural use, Even if you have chosen one of the more than 300 foggy days while forestry predominates in the Harz. Ordered, equal- in the year, the approximately 1.6 km long circular walk offers height treetops in geometric areas show where natural forests much to see. On a clear, dry day the maximum visibility is at were converted into managed spruce forests long before the least 230 km. designation of the National Park. However, original nature Numbers guide you along the path and could survive where the economic activities of man could not, through this booklet (on the walk, look for especially at high altitudes or on the steep slopes of the valleys. white numerals on a dark wooden sign). For a plan of the Brocken, see page 12. 2 Brocken Railway Please contact us if you want to know more about Harz Nati- As early as 1899 the 100 cm gauge Brocken Railway onal Park and Brocken. -

Vol55 No1 A03.Pdf (856.6Kb)
43-63 Eiszeitalter und Gegenwart 55 Hannover 2005 3 Abb., 1 Tab. Das Pleistozän des nördlichen Harzvorlands – eine Zusammenfassung H-J W, L F H B*) Keywords: quaternary, harz foreland, glaciofl uvial/ periglaziale Bedingungen, unter denen der Nieder- fl uvial deposits, terrace stratigraphy terrassen-Schotter in den bereits vorher existieren- den Tälern abgelagert wurde. Kurzfassung: Das nördliche Harzvorland liegt im Grenzbereich zwischen der ehemaligen nordischen Abstract: Th e northern Harz foreland is the border- Vereisung und dem Perigazialraum Mitteleuropas. land between the former northern glaciation and Die ältesten pleistozänen Sedimente bilden Terras- the periglacial area of Central Europe. Th e oldest senkiese, die vor der Elstereiszeit abgelagert wurden sediments of the Pleistocene period are fl uvial gravel und einem nicht näher datierbaren Oberterras- deposited before the Elster glacial period. Th ey can sensystem zugeordnet werden. Die Elstereiszeit ist not be exactly dated and were assigned to a system durch Terrassenkies und glazifl uviatile Sande über- called “Oberterrasse” (upper terrace). liefert. Die folgende Holstein-Warmzeit lässt sich Th e Elster glacial period is documented by fl uvial nur an wenigen Stellen pedologisch nachweisen. Für gravel and melt water sand. Th e following Holstein den Saale-Komplex wird erstmals eine litho- und pe- interglacial period is verifi ed only by a few pedologi- dostratigraphische Gliederung für das Harzvorland cal sites. Th e early Saale period can be divided for the vorgestellt. Die Fuhne-Kaltzeit und die Dömnitz- fi rst time in this area into periglacial sediments, ice Warmzeit lassen sich anhand von Fließerden, Kalt- wedges and soils. In the top of these layers follows zeitindikatoren sowie Böden belegen. -

Wanderkorridore Für Wildkatze Und Rothirsch in Der Nationalparkregion Harz
Wanderkorridore für Wildkatze und Rothirsch in der Nationalparkregion Harz Der Lebensraumverlust vieler Wild- tiere in Deutschland hat im 20. Jahr- hundert ein bis dahin nie erreichtes Ausmaß erlangt. Ursachen sind die enormen Siedlungserweiterungen, Bau von Verkehrsachsen und gravie- rende Landnutzungsveränderungen in den letzten 100 Jahren. In den 1960er Jahren war in den alten Bun- desländern eine Fläche von ca. 6% der Landesfläche verbaut. 25 Jahre später hatte sich der Verbauungsgrad auf 12% der Landesfläche verdop- pelt. Aktuell werden in Deutschland jedes Jahr ca. 40.000 ha Fläche ver- baut! Entlang der niedersächsischen Rand- lagen des Nordharzes erreichte der Flächenverbrauch zwischen 1960- 2000 ein Ausmaß vergleichbar mit der Zeitspanne von 1500 bis 1960. In nur 40 Jahren wurde entlang der nördlichen Harzrandlagen genauso viel Fläche verbraucht wie in 460 Jah- re zuvor. Derartig massive Eingriffe führen zu „Zerschneidungen“ der Lebensräu- me, vor allem bei großräumig leben- den Säugetieren wie der Wildkatze Die Wildkatze wurde in Deutschland auf ca. 5% ihres ursprünglichen Verbreitungs- und dem Rothirsch. Eine Trennung gebietes zurückgedrängt (Foto Frank Raimer) von Populationen, Verkleinerung der Populationsgrößen bis hin zu einem lokalen, regionalen und überregio- kehrswegeplanungen Wildkatzen- räume aufgezeigt werden. Für den nalen Verschwinden der naturnah lebensräume, so ist grundsätzlich Zeitraum ab 1990 belegen Beobach- gebundenen Arten ist nachweisbar. eine Umweltverträglichkeitsprüfung tungen, Fänge und Verkehrsopfer -
11701-16-A0017 RVH Landmarke 14 Eng 3. Auflage 2016.Indd
Landmark 14 Huysburg Monastery ® On the 17th of November, 2015 in the course of the 38th General Assembly of the UNESCO, the 195 members of the United Nations organization agreed to introduce a new label of distinction. Under this label Geoparks can be designated as UNESCO Global Geoparks. The Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen is amongst the fi rst of 120 UNESCO Global Geoparks worldwide in 33 countries to be awarded this title. UNESCO-Geoparks are clearly defi ned, unique areas in which sites and landscapes of international geological signifi cance can be found. Each is supported by an institution responsible for the protection of this geological heritage, for environmental education and for sustainability in regional development which takes into account the interests of the local population. Königslutter 28 ® 20 Oschersleben 27 18 14 GoslarGoslarr HalHHalberstadtlbberrstaddt 3 2 8 1 Quedlinburgdlilinbnburg 4 OsterodeOsterode a.H. 9 11 5 131 15 16 6 10 17 19 7 Sangerhausen Nordhausen 12 21 In the year 2004, 17 European and eight Chinese Geoparks founded the Global Geoparks Network (GGN) under the auspices of the UNESCO. The Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen was incorporated in the same year. In the meantime, there are various regional networks, among them the European Geoparks Network (EGN). The regional networks coordinate the international cooperation. The summary map above shows the position of all landmarks in the UNESCO Global Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen. Muschelkalk 1 Huysburg Monastery & Huy Region North of Halberstadt, the Huysburg sits on one of the highest elevations of the Huy hills. The name is derived from a former Franconian military station. -
RVH Straße Der Romanik
Im Zeichen der Dohle Zwischen Halberstadt und Großem Bruch an der Straße der Romanik ® JOHANN WOLFGANG VON GOETHE (1749-1832) Kaum wegen außergewöhnlicher Schönheit, sondern vielmehr wegen ihrer Seltenheit, erwecken bestimmte wildlebenden Tier- und Pflanzenarten das besondere Interesse von Naturliebhabern. Dort wo viele seltene Arten auf engem Raum vorkommen wurden zu ihrer Erhaltung Naturschutzgebiete ausgewiesen. Natur- schutzgebiete sind innerhalb unserer Kulturland- schaften etwas Besonderes. Meist achtlos vorbei fahren wir an den Weizenfeldern im Harzvorland, bestaunen aber Einkorn, Emmer und Dinkel als alte Nutzpflan- zen in Schaugärten. Auch hier ist die Erklärung ein- fach: Diese Getreidearten sind selten, waren bedeut- sam in der Stein- bzw. ab der Bronzezeit. Um sie heute noch bewundern zu können müssen wir lange suchen, finden sie viel- 14 leicht in einem besonderen Garten: einem Schaugar- Garten am Kloster Huysburg ® ten. 14 Interessieren wir uns außerdem für Zeugnisse verschiedener Architek- turepochen, so finden wir eindrucks- volle Jugendstilbauten vielerorts zwischen München oder Riga, bewundern die barocke Pracht des Dresdner Zwingers ebenso, wie die unzähliger bayerischer Kirchen dieser Epoche, kennen die Renais- sancerathäuser von Augsburg bis Leipzig. Älter sind die Bauwerke der Gotik wie der Kölner oder der Mag- deburger Dom. Seltener, weil noch älter, sind Bauwerke aus der Endzeit des Frühen Mittelalters. Es sind Zeugnisse romanischer Architektur, die gleichsam seltener Tier- und 12 Pflanzenarten in Naturschutz- gebieten, in kaum einer Region Blick zur Dorfkirche Eilenstedt Deutschlands in solcher Dichte und Vielfalt zu finden sind wie in der Region rings um den Harz: Von der Pfalz Tilleda, den Burgruinen Hohnstein und Osterode im Süden über die Stiftskirche Bad Gandersheim im Westen, die Klosterkirchen in Drübeck und auf dem Huy oder die Stiftskirche Quedlinburg im Norden und die Burg Freckleben im Osten.