Die Amphibien Und Reptilien Westfalens
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
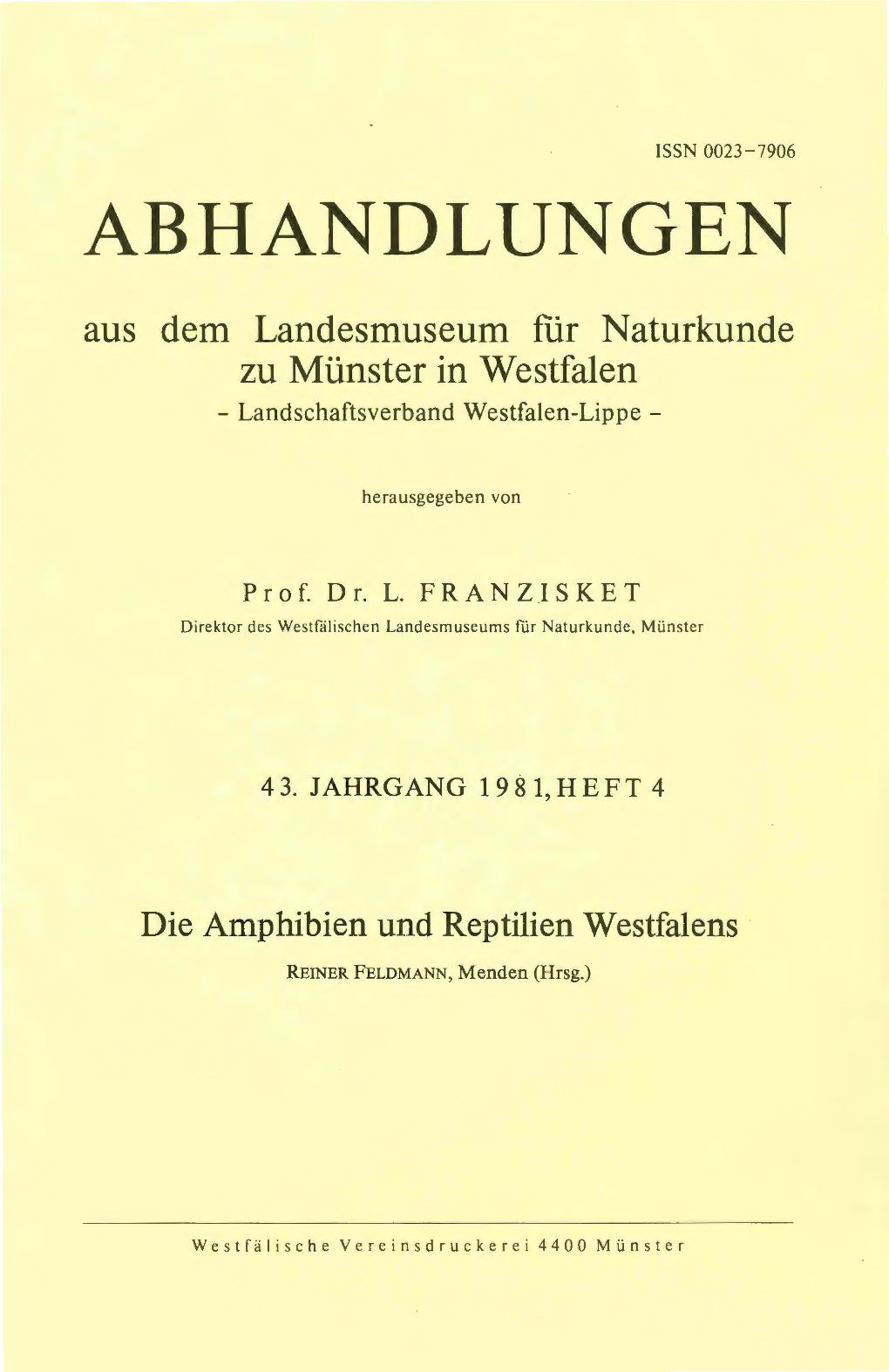
Load more
Recommended publications
-

Organigramm Der Freiwilligen Feuerwehr Der Stadt Schmallenberg
Organigramm der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schmallenberg Bürgermeister Ordnungsamt Wehrleitung Fachbeauftragte Einsatz Löschzug I Löschzug Schmallenberg Atemschutz Mit den Ortsteilen Schmallenberg, Obringhausen Löschgruppe Fleckenberg Fahrzeuge und Mit den Ortsteilen Fleckenberg, Jagdhaus, Latrop, Geräte Waidmannsruh, Wulwesort, Störmecke Löschgruppe Lenne Mit den Ortsteilen Lenne, Hundesossen, Harbecke Funk Löschzug II Vorbeugender Löschzug Bad Fredeburg Brandschutz Mit den Ortsteilen Bad Fredeburg, Ebbinghof, Altenhof, Huxel, Holthausen, Altenilpe, Heiminghausen, Gewerbepark Hochsauerland einschl. Bettenkamp Sicherheitsbeauftragter Löschgruppe Dorlar Mit den Ortsteilen Dorlar, Kirchilpe, Nierentrop Twismecke, Mailar, Sellinghausen, Berghof, Kuhberg, Hengsiepen Löschgruppe Gleidorf Mit dem Ortsteil Gleidorf Löschzug III Löschgruppe Berghausen Mit den Ortsteilen Berghausen, Wormbach Löschgruppe Felbecke Mit den Ortsteilen Felbecke, Werpe, Selkentrop, Werntrop Löschgruppe Bracht Mit den Ortsteilen Bracht, Herschede, Kückelheim, Hebbecke, Rotbusch Löschgruppe Niederberndorf Mit den Ortsteilen Niederberndorf, Oberberndorf, Keppel, Silberg, Menkhausen, Grimminghausen, Arpe und Landenbeckerbruch Löschzug IV Löschgruppe Bödefeld Mit den Ortsteilen Bödefeld, Walbecke, Osterwald, Hiege, Lanfert und Sonderhof Löschgruppe Westernbödefeld Mit den Ortsteilen Westernbödefeld, Brabecke und Gellinghausen Löschgruppe Oberhenneborn Mit den Ortsteilen Oberhenneborn, Niederhenneborn, Sellmecke und Rimberg Löschgruppe Kirchrarbach Mit den Ortsteilen -

Anlage Zur Vorlage IX/857
Anlage zur Vorlage IX/857 Stadtbezirk Straßenname Fleckenberg In der Basmecke Fleckenberg Lennestraße Fleckenberg Rönneckeroth Fleckenberg Über der Kirche Fleckenberg Jagdhauser Straße Fleckenberg Auf der Böhre Grafschaft An der Almert Grafschaft Im Kampe Schanze Schanze Gleidorf Zur Vogelstange Gleidorf Am Einheit B 236 Gleidorf Jahnstraße Gleidorf An der Gleier - Alte Straße Westfeld In der Schlade Rest Westfeld Am Birkenstück Nr. 36 - 44 Westfeld In der Walmecke Nr. 8 Abz. Waldemeiweg Ohlenbach Ohlenbach Birkenhöhenweg Ohlenbach Linke Nordenau An der Drift Oberkirchen Zur Schlade Winkhausen Am Langen Hagen Rellmecke Rellmecke Obersorpe Obersorpe Holthausen Mittelstraße Huxel Huxel Wormbach Neue Ennest Werpe Ohlweg Lenne Kehlscheidweg Lenne Lennestraße Lenne / B236 Lennestraße Bürgersteig Keppel Arpe bis Keppel Oberberndorf Oberberndorf Mailar von der Kapelle Mailar Abzweig Nr. 14 bis Radweg Mailar Nr. 15 bis Grundstücksanfang Nr. 18 Mailar ab Grundstücksanfang Nr. 18 bis Nr. 18 Heiminghausen R. Nr. 1 und 1 a Heiminghausen R. Nr. 11 und 11 a Hieninghausen vor Nr. 8 Bracht Im Ruthen Bracht Kampstraße Bracht Am Schlage Bödefeld Auf dem Stadtfeld Bödefeld Auf der Hütte Bödefeld Lingenauwer Bödefeld Alte Hansestraße Bödefeld Pfarrer-Heinrich-Marx-Straße Bödefeld Zum Kreuzberg Bödefeld Querstraße Stadtbezirk Straßenname Gellinghausen Gellinghausen Westernbödefeld Am Kampe Westernbödefeld Am Krähenberg Gellinghausen Saunei Brabecke Brabecke Sellinghausen An der Halle Altenilpe Straße zum Friedhof Altenilpe Straße nach Plett Altenilpe Straße -

Merkblatt Zur Beteiligung Der Bezirksschornsteinfegermeisterin
Merkblatt zur Beteiligung der Bezirksschornsteinfegermeisterin/ des Bezirksschornsteinfegermeisters Stadt Schmallenberg - Untere Bauaufsichtsbehörde - Nach der Vorschrift des § 43 Abs. 7 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) muss die Bauherrin/der Bauherr sich bei der Errichtung oder Änderung von Schornsteinen sowie bei Anschluss von Feuerstätten an Schornsteine oder Abgas- leitung von der Bezirksschornsteinfegermeisterin/dem Bezirksschornsteinfegermeister (BZSM) bescheinigen lassen, dass der Schornstein oder die Abgasanlage sich in ei- nem ordnungsgemäßen Zustand befindet und für die angeschlossenen Feuerstätten geeignet ist. Bei der Errichtung von Schornsteinen soll der/dem BZSM Gelegenheit gegeben werden, vor Erteilung der Bescheinigung auch den Rohbauzustand zu be- sichtigen. Die Bescheinigung braucht der Bauaufsichtsbehörde nicht vorgelegt werden. Sollten Mängel festgestellt werden, wird die oder der BZSM dies der Bauaufsichtsbe- hörde von sich aus mitzuteilen. Mit Erteilung der Baugenehmigung erhält die/der für den Bezirk zuständige BZSM au- tomatisch hierüber eine Information durch die Bauaufsichtsbehörde. Eine Übersicht über die Bezirke und der/des jeweils zuständigen BZSM ist auf der Rückseite abge- druckt und kann jeweils aktuell auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises unter www.hochsauerlandkreis.de (Dienstleistungen A - Z, Schornsteinfegerangelegenhei- ten, Kehrbezirksverzeichnis) abgerufen werden. 04/2011 Bezirke der Bezirksschornsteinfegermeister Kehrbezirk HSK 08 (Eslohe) Bezirksschornsteinfegermeister -

Schützenkönige Und Vizekönige Der Vergangenen Jahre
Schützenkönige und Vizekönige der vergangenen Jahre Schützenkönig Vizekönig 2019 Martin Schauerte Kirchrarbach Franz Babilon Mönekind 2018 Matthias Wiese Dornheim Johannes Hegener-Hachmann Hanxleden 2017 Thomas Wiese Sögtrop Hannes Steinhausen Föckinghausen 2016 Hubertus Wiethoff Oberrarbach Philipp Wüllner Sögtrop 2015 Stefan Gierse Kirchrarbach Patrick Lumme Kirchrarbach 2014 Achim Sander Kirchrarbach Henry Gierse Oberrarbach 2013 Heribert Gödeke Niederhenneborn Christian Gödeke Niederhenneborn 2012 Hubertus Hegener-Hachmann Hanxleden Frank Lumme Kirchrarbach 2011 Reinhard Mester Sögtrop Thorsten Zacharias Sögtrop 2010 Ralf Gerke-Cantow Kirchrarbach Sebastian Willmes Kirchrarbach 2009 Markus Köster Oberrarbach Christof Schulte Oberrarbach 2008 Christof Gierse Kirchrarbach Thomas Engelhard Kirchrarbach 2007 Stephan Heimes Kirchrarbach Edgar Heimes Kirchrarbach 2006 Josef Wollmeiner Sellmecke Andre Plugge Kirchrarbach 2005 Andreas Hegener-Hachmann Niederhenneborn Bernd Ewers Kirchrarbach 2004 Friedhelm Steilmann Föckinghausen Martin Schauerte Kirchrarbach 2003 Hans-Gerhard Schörmann Sögtrop Ingo Schmidt Kirchrarbach 2002 Edgar Jacobs Niederhenneborn Daniel Luttermann Sögtrop 2001 Friedhelm Engelhard Kirchrarbach Matthias Wiese Dornheim 2000 Helmut Göddeke Oberrarbach Matthias Bücker Kirchrarbach 1999 Jürgen Urban Kirchrarbach Georg Pieper Dornheim 1998 Dirk Wüllner Kirchrarbach Andreas Wiese Dornheim 1997 Ludger Büngener Kirchrarbach Markus Köster Oberrarbach 1996 Johannes Luttermann Sögtrop Andreas Lippes Oberrarbach 1995 Ulrich Willmes -

Sauerland- Wandeldorpen
Sauerland- Wandeldorpen Wandel suggesties en kaarten SAUERLAND WANDERDÖRFER sauerland-wanderdoerfer.de Mijn ontdekking – Sauerlandse 2 – Sauerlandse wandeldorpen De Sauerlandse wandeldorpen SAUERLAND WANDERDÖRFER vormen samen een wandelregio met een dicht netwerk van prachtige de Sauerland-Höhenflug, maar vooral en goed bewijzerde wandelroutes het uitgebreide net aan kwalitatief zoals het bijna nergens anders in uitstekende wandelroutes maken de Sau- Duitsland te vinden is. erlandse wandeldorpen zo bijzonder. n en om de plaatsen Brilon, Diemel- Tot de specifieke wandelbelevenissen Isee, Lennestadt & Kirchhundem, over grotendeels natuurwegen met veel Medebach, Olsberg, Schmallenberg landschappelijke en culturele bijzon- & Eslohe, Willingen, Winterberg & Hallenberg vindt u belevenisrijke wandelroutes die voor verschillende doelgroepen geschikt zijn – of het nu om de gepassioneerde sportwandelaar gaat of om genieters en gezinnen met kinderen. Op de volgende bladzijden vindt u uitgebreide informatie over de Sauerlandse wandeldorpen met daarbij speciale wandeltips. Niet alleen de lange afstandroutes Rot- haarsteig, de Sauerland-Waldroute en 3 www.sauerland-wanderdoerfer.de Van harte welkom in de Sauerlandse wandeldorpen! het beschikbare kaartmateriaal kunt u zich in de wandelregio heel gemakke- lijk oriënteren. Bovendien hebben de Sauerlandse wandeldorpen reeds verschillende kant en klare routes derheden horen vanzelfsprekend de voor u samengesteld. Maar u kunt na- gecertificeerde meerdaagse wandelrou- tuurlijk ook uw eigen route met behulp tes -

Neue Bücher Über Südwestfalen 2014
NEUE BÜCHER ÜBER SÜDWESTFALEN Literaturpräsentation der Landeskundlichen Bibliothek des Märkischen Kreises NEUE BÜCHER ÜBER SÜDWESTFALEN 2012-2014 Literaturpräsentation der Landeskundlichen Bibliothek des Märkischen Kreises Altena 2014 Vorwort Die Landeskundliche Bibliothek des Märkischen Kreises, die große und traditionsreiche wissenschaftliche Spezialbibliothek für unsere Region, präsentiert im vorliegenden Literaturspiegel knapp 260 neue Bücher über Südwestfalen. Herausgeber: Eine beeindruckend große Zahl von Autorinnen und Autoren Märkischer Kreis beschreibt die Menschen unserer Gegend, ihre Geschichte, ihren Der Landrat Humor, ihre Aktivitäten in Industrie, Kunst und Literatur, gewährt Fachdienst Kultur und Tourismus einen Blick unter und auf die Erde mit ihren Bodenschätzen und Kreisarchiv und Landeskundliche Bibliothek ihren Talsperren-, Wald- und Parklandschaften und gibt eine Fülle Bismarckstr. 15 touristischer Kletter-, Wander- und Museums-Tipps. 58762 Altena Tel.: 02352 966-7053 Die Bücher- und Zeitschriftenlandschaft der fünf südwest- Fax: 02352 966-7166 fälischen Kreise – Hochsauerlandkreis, Kreis Olpe, Kreis Siegen- E-Mail: [email protected] Wittgenstein, Kreis Soest und Märkischer Kreis – zeichnet sich www.maerkischer-kreis.de durch eine thematische Vielfalt und ein großes Engagement von Herausgebern, Redakteuren, Autoren und Verlegern aus. Die Leserschaft ihrerseits nimmt neue Titel erwartungsvoll zur 2014 Hand und nutzt das gedruckte Wort, um sich über Politik, Kirche, Brauchtum, Architektur, Sport, -

Stadt Schmallenberg
Anlage zur Vorlage IX/1048 Stadt Schmallenberg Kanalnetz Schmallenberg Abwasserbeseitigungskonzept 7. Fortschreibung für die Jahre 2018 - 2023 Erläuterungsbericht Niederlassung Arnsberg Hansastraße 3 D-59821 Arnsberg Telefon: 02931-551 170 Fax: 02931-551 162 März 2018 Stadt Schmallenberg: Abwasserbeseitigungskonzept 2018 – 2023 Erläuterungsbericht Inhaltsverzeichnis Seite 1. VERANLASSUNG 1 1.1 Rechtsgrundlagen - Allgemeines 1 1.2 Abstimmungen mit den Wasserbehörden und Ruhrverband 2 1.3 Verbindlichkeit des ABK 2 1.4 Bestandteile des ABK 3 1.5 Gemeindegebiet 3 1.5.1 Lage und Topografie 3 1.5.2 Einwohnergröße und Wirtschaftsstruktur 5 1.5.3 Flächennutzungsplan 6 1.5.4 Wasserversorgung 6 1.5.5 Schutzgebiete 6 1.5.6 Wasserrahmenrichtlinie 7 1.6 Bestehendes Entwässerungssystem und -einrichtungen 23 1.6.1 Struktur und Zustand öffentliches Kanalisationsnetz 24 1.6.2 Abwasserbehandlungsanlagen im Gemeindegebiet (Ruhrverband) 27 1.6.3 Sonderbauwerke 28 1.6.4 Einleitungen in Gewässer 29 1.6.5 Grundstücke ohne Anschluss an das öffentliche Kanalisationsnetz 29 1.7 Entwässerungsgebühren 30 1.8 Kosten der Abwasserbehandlung 31 1.9 Generalentwässerungsplanung – Zentrale Abwasserpläne 31 1.10 Integrale Entwässerungsplanung (IEP) des Ruhrverbands 32 1.11 Bestehende Ordnungs- und Sanierungsverfügungen 33 1.12 Betrieb des Kanalnetzes Schmallenberg 33 1.13 Zustands- und Funktionsprüfung von Anschlussleitungen 33 2. FREMDWASSERBESEITIGUNGSKONZEPT 35 3. NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNGSKONZEPT 37 3.1 Niederschlagswasserbehandlung und -beseitigung 37 3.1.1 Zukünftige Baugebietsentwicklung 37 4. RÜCKBLICK AUF DIE 6. FORTSCHREIBUNG DES ABK (2012-2017) 38 5. 7. FORTSCHREIBUNG DES ABK (2018 – 2023) 39 5.1 Art der Investitionsmaßnahmen 39 5.2 Schlüssel über verwendete Bezeichnungen (Ordnungsnummern) 39 W:\1 PROJEKTE\240010 Kanalbetrieb Schmallenberg\ABK\ABK_2018\01_ABK_Text\180327_ABK_Schmallenberg_2018-2023.docx Stadt Schmallenberg: Abwasserbeseitigungskonzept 2018 – 2023 Erläuterungsbericht 5.3 Investitionen 2018 - 2023 40 6. -

Nachstehender Mitgliedsverein Des Sauerländer Schützenbundes E. V
Nachstehender Mitgliedsverein des Sauerländer Schützenbundes e. V. vermietet seine Schützenhalle für Ferienlager, Jugendfreizeiten usw. Nähere Informationen beim Betreiber/Vermieter erhältlich. Ort: Allagen Stadt/Gemeinde: 59581 Warstein Region: nördl. Sauerland, Möhne, Kreis Soest Lagebezeichnung: Ortsmitte Sehenswürdigkeiten: Heimatmuseum, Möhnesee, Tierpark in 4 km Entfernung Art der Halle: Schützenhalle Nutzungsmöglichkeit: Ferienlager max. Personenzahl: 150 Betreiber/Vermieter: Schützenbruderschaft Allagen e. V. Internet / E-mail: www.schuetzen-allagen.de Informationen bei: Berthold Risse Telefon: 02925-1469 Mietpreis: 1,30 € /Pers./Tag, mind. 75,00 €/Tag Nebenkosten: Strom, Wasser, Müllabfuhr, Heizung Mietzeitraum: ganzjährig, außer 2. Wochenende im Juli es können angemietet werden: Hallenraum: 1 teilbar Küche: 1 Versammlungsraum: 1 für 50 Personen Toiletten Herren: 9 Toiletten Damen: 11 Anzahl der Duschen: 4 Waschgelegenheit kalt: 5 Waschgelegenheit warm: 5 sonstige Räume: verschiedene Nebenräume Prospekte werden zur Verfügung gestellt: leider nicht An der Halle bzw. im Ort stehen außerdem, in der Regel kostenlos, zur freien Verfügung Sportplatz: Kunstrasenplatz in 1 km Entfernung Spielplatz: direkt neben der Halle Parkplätze: 40 Stellplätze sonstige Flächen: neugestalteter Vorplatz Zeltmöglichkeit: nein Bermerkungen: direkt am Radwanderweg Möhnetal gelegen Stand: 26. 03. 2006 Zusammengestellt nach Angaben des Betreibers/Vermieters. Alle Angaben ohne Gewähr. Geschäftsstelle des Sauerländer Schützenbundes e. V., Postfach 16 41, 59856 -

Einwohnerstatistik Zum 31.12.2014
Einwohner in den Stadtteilen der Stadt Schmallenberg zum 31.12.2014 Ortsteil Wohnsitz männlich weiblich Gesamt Altenhof Hauptwohnsitz 8 5 13 Altenilpe Hauptwohnsitz 92 79 171 Almert Hauptwohnsitz 8 6 14 Arpe Hauptwohnsitz 122 114 236 Brabecke Hauptwohnsitz 113 101 214 Berghausen Hauptwohnsitz 103 103 206 Berghof Hauptwohnsitz 4 5 9 Bödefeld Hauptwohnsitz 570 524 1.094 Bracht Hauptwohnsitz 236 246 482 Dornheim Hauptwohnsitz 16 17 33 Dorlar Hauptwohnsitz 478 413 891 Ebbinghof Hauptwohnsitz 14 13 27 Felbecke Hauptwohnsitz 79 83 162 Fleckenberg Hauptwohnsitz 783 791 1.574 Föckinghausen Hauptwohnsitz 7 9 16 Bad Fredeburg Hauptwohnsitz 1.939 1.956 3.895 Gellinghausen Hauptwohnsitz 77 43 120 Grimminghausen Hauptwohnsitz 30 29 59 Gleidorf Hauptwohnsitz 709 670 1.379 Grafschaft Hauptwohnsitz 491 562 1.053 Harbecke Hauptwohnsitz 74 72 146 Hebbecke Hauptwohnsitz 4 4 8 Herschede Hauptwohnsitz 15 17 32 Heiminghausen Hauptwohnsitz 54 50 104 Hiege Hauptwohnsitz 1 2 3 Hoher Knochen Hauptwohnsitz 4 1 5 Hanxleden Hauptwohnsitz 11 5 16 Holthausen Hauptwohnsitz 278 302 580 Hengsiepen Hauptwohnsitz 2 3 5 Hundesossen Hauptwohnsitz 33 29 62 Huxel Hauptwohnsitz 73 73 146 Inderlenne Hauptwohnsitz 25 20 45 Jagdhaus Hauptwohnsitz 33 27 60 Keppel Hauptwohnsitz 3 3 6 Kirchilpe Hauptwohnsitz 21 18 39 Kirchrarbach Hauptwohnsitz 146 127 273 Kückelheim Hauptwohnsitz 46 44 90 Landenbeckerbruch Hauptwohnsitz 3 3 6 Lengenbeck Hauptwohnsitz 34 34 68 Lenne Hauptwohnsitz 153 174 327 Latrop Hauptwohnsitz 88 76 164 Lanfert Hauptwohnsitz 4 5 9 Mailar Hauptwohnsitz 68 63 131 Menkhausen -

Einwohner Nach Stadtteilen
Einwohner in den Stadtteilen der Stadt Schmallenberg zum 31.12.2011 Stadtteil Wohnsitz männlich weiblich Gesamt Almert Hauptwohnsitz 8 7 15 Altenhof Hauptwohnsitz 14 6 20 Altenilpe Hauptwohnsitz 99 85 184 Arpe Hauptwohnsitz 118 110 228 Bad Fredeburg Hauptwohnsitz 1925 1956 3881 Berghausen Hauptwohnsitz 102 101 203 Berghof Hauptwohnsitz 3 5 8 Bödefeld Hauptwohnsitz 589 535 1124 Brabecke Hauptwohnsitz 112 102 214 Bracht Hauptwohnsitz 249 250 499 Dorlar Hauptwohnsitz 486 418 904 Dornheim Hauptwohnsitz 18 16 34 Ebbinghof Hauptwohnsitz 13 12 25 Felbecke Hauptwohnsitz 80 91 171 Fleckenberg Hauptwohnsitz 774 810 1584 Föckinghausen Hauptwohnsitz 8 8 16 Gellinghausen Hauptwohnsitz 71 45 116 Gleidorf Hauptwohnsitz 713 669 1382 Grafschaft Hauptwohnsitz 477 590 1067 Grimminghausen Hauptwohnsitz 30 30 60 Hanxleden Hauptwohnsitz 12 5 17 Harbecke Hauptwohnsitz 77 73 150 Hebbecke Hauptwohnsitz 4 4 8 Heiminghausen Hauptwohnsitz 52 53 105 Hengsiepen Hauptwohnsitz 2 3 5 Herschede Hauptwohnsitz 17 18 35 Hiege Hauptwohnsitz 1 2 3 Hoher Knochen Hauptwohnsitz 3 1 4 Holthausen Hauptwohnsitz 271 293 564 Hundesossen Hauptwohnsitz 35 29 64 Huxel Hauptwohnsitz 77 73 150 Inderlenne Hauptwohnsitz 27 22 49 Jagdhaus Hauptwohnsitz 36 29 65 Keppel Hauptwohnsitz 2 3 5 Kirchilpe Hauptwohnsitz 25 18 43 Kirchrarbach Hauptwohnsitz 155 127 282 Kückelheim Hauptwohnsitz 43 50 93 Landenbeckerbruch Hauptwohnsitz 4 3 7 Lanfert Hauptwohnsitz 4 5 9 Latrop Hauptwohnsitz 83 78 161 Lengenbeck Hauptwohnsitz 30 28 58 Lenne Hauptwohnsitz 163 175 338 Mailar Hauptwohnsitz 76 66 142 Menkhausen -

2009 05 22 Pressemitteilung Baubeginn
S T A D T S C H M A L L E N B E R G Presse - Mitteilung Nr.: Datum: 22. 05. 2009 Auskunft: Herr Schörmann Deutsche Telekom beginnt mit den Bauarbeiten für das schnelle Internet in den Kooperationsgebieten der Stadt Schmallenberg Im Mai 2009 beginnt die Telekom mit den Bauarbeiten für das schnelle Internet in den Kooperationsgebieten der Stadt Schmallenberg. Die Stadt Schmallenberg hat im November 2008 Kooperationsverträge mit der Deut- schen Telekom für verschiedene Anschlussbereiche abgeschlossen mit dem Ziel, die Verfügbarkeit des schnellen Internets in diesen Bereichen bis Ende des II. Quar- tals 2009 sicherzustellen. Die Deutsche Telekom hat mitgeteilt, dass es aufgrund von Kapazitätsmangel, der Umstellung auf die neueste Technik und dem damit verbundenen erheblichen Pla- nungsaufwand zu einer Verzögerung bei der Planung und Ausführung der Ausbau- maßnahmen gekommen ist, so dass erst jetzt mit den Bauarbeiten begonnen wer- den kann. Die konkrete Umsetzung stellt sich in den einzelnen Anschlussbereichen aus Sicht der Deutschen Telekom wie folgt dar: Grafschaft Von Schmallenberg aus wird ein Glasfaserkabel über 4 km in vorhandene Rohranla- gen eingezogen. In Grafschaft selbst werden lediglich geringe Tiefbaumaßnahmen durchgeführt. Für die Kunden in Grafschaft ist das schnelle Internet ab der 30. Kalenderwoche (20. – 24.07.2009) nutzbar . Nach erfolgtem Breitbandausbau steht in Grafschaft eine Bandbreite von 6 Mbit/s – 16 Mbit/s zur Verfügung. Besuchen Sie uns auch auf unserer Internetseite unter www.schmallenberg.de . Dort finden Sie neben vielen Informationen auch unsere Pressemitteilungen. Gleidorf Von Schmallenberg aus wird ein Glasfaserkabel über ca. 4,2 km in vorhandene Rohranlagen eingezogen. Darüber hinaus sind nur geringe Tiefbaumaßnahmen not- wendig. -
Familienferien- Programm Spiel, Spaß & Abenteuer
2018 / 2. Auflage Familienferien- programm Spiel, Spaß & Abenteuer Spiel & Spaß Tipps & Termine Spannende Vorlesegeschichte Editorial Veranstaltungsübersicht nach Orten AB SEITE 12 Liebe Kinder, liebe Eltern! Herzlich Willkommen in unse- rer schönen Ferienregion! Wir möchten, dass eure Ferien ein unvergessliches Erlebnis werden. Freut euch auf spannende Ran- ger-Expeditionen, einen Besuch auf dem Bauernhof, Spiel & Spaß rund um´s Pferd und vieles mehr! Neben interessanten und un- terhaltsamen Veranstaltungen für euch, eure Geschwister und Geschichte eure Eltern erwartet euch am „Die Glitzerfunkelrutsche“ Ende dieses Heftes die spannende AB SEITE 78 Geschichte „Die Glitzerfunkel- rutsche“, die in Zusammenarbeit mit den Kindern der Klasse 4 der Grundschule Fleckenberg sowie der Malerin Anne Vollmert und dem Kinderbuchautor Kurt Was- serfall entstanden ist. Habt eine schöne Zeit! Hubertus Schmidt Tourismusmanager 2 Spiel, Spaß & Abenteuer Termine AB SEITE 16 Wimmelbildkarte SEITE 6 Impressum SCHMALLENBERGER SAUERLAND TOURISMUS Poststraße 7 57392 Schmallenberg Telefon +49 2972 9740-0 Telefax +49 2972 9740-26 www.schmallenberger-sauerland.de [email protected] www.facebook.com/Schmallenberger.Sauerland 3 Hier wimmelt’s vor Tipps Was haben das Sauerland und ein Wim- melbild gemeinsam? Richtig, es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken – speziell für Familien. Das zeigt unsere Familienkarte: Auf der einen Seite stellt sie Kindern liebevoll illustriert die vielen Freizeit- und Ausflugsziele in der Region vor. Auf der anderen Seite informiert sie Eltern, was man wo findet. Wer gern begleitet von echten Rangern des Landesbetriebs Forst und Holz NRW wandert: Während der NRW-Ferien su- chen diese regelmäßig mit kleinen und großen Naturfreunden die Spuren von Wisent, Wildkatze, Luchs & Co.