Medienbericht
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
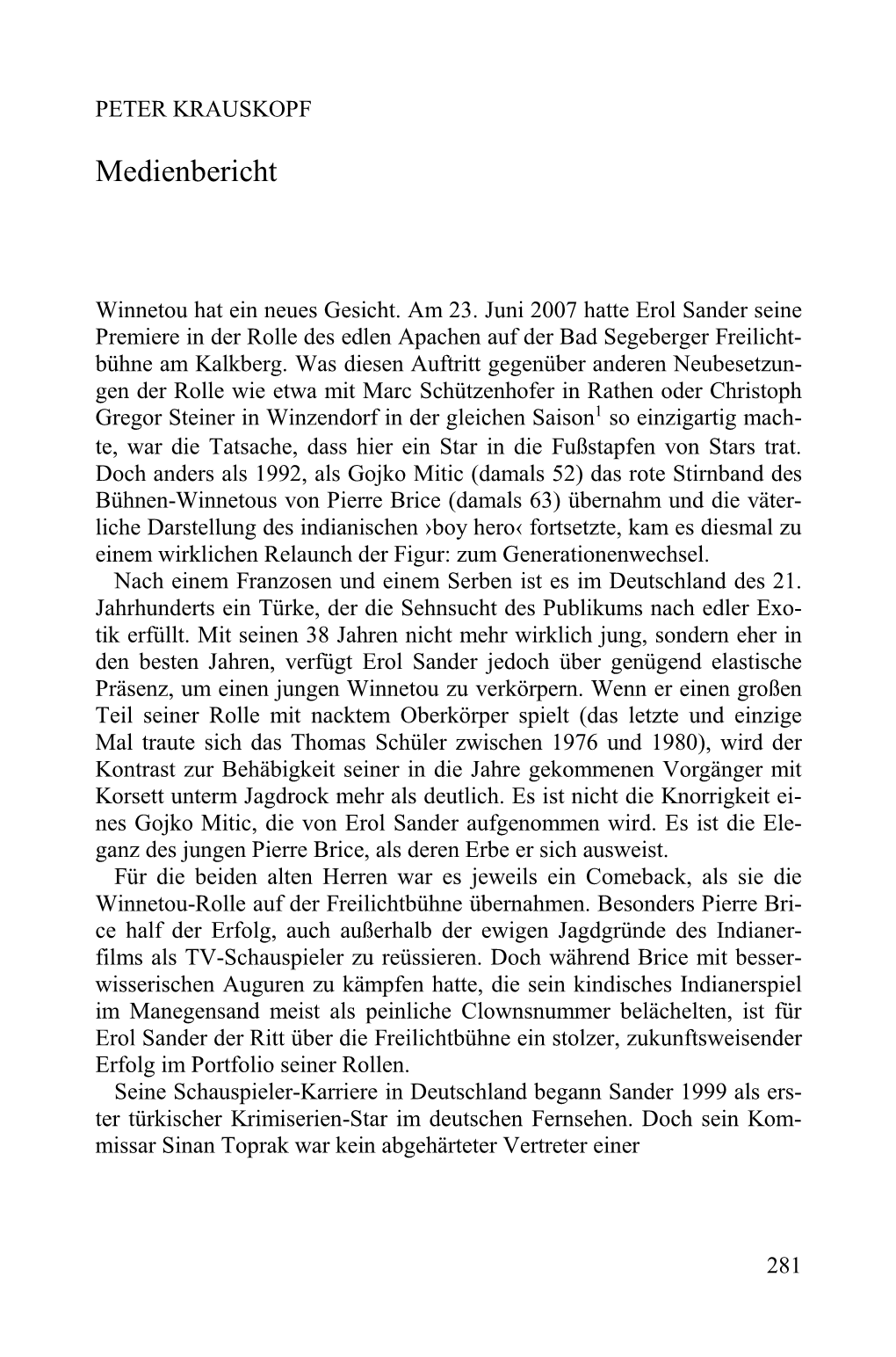
Load more
Recommended publications
-

Alexander Kluge Raw Materials for the Imagination
FILM CULTURE IN TRANSITION Alexander Kluge Raw Materials for the Imagination EDITED BY TARA FORREST Amsterdam University Press Alexander Kluge Alexander Kluge Raw Materials for the Imagination Edited by Tara Forrest Front cover illustration: Alexander Kluge. Photo: Regina Schmeken Back cover illustration: Artists under the Big Top: Perplexed () Cover design: Kok Korpershoek, Amsterdam Lay-out: japes, Amsterdam isbn (paperback) isbn (hardcover) e-isbn nur © T. Forrest / Amsterdam University Press, All rights reserved. Without limiting the rights under copyright reserved above, no part of this book may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise) without the written permission of both the copyright owner and the author of the book. Every effort has been made to obtain permission to use all copyrighted illustra- tions reproduced in this book. Nonetheless, whosoever believes to have rights to this material is advised to contact the publisher. For Alexander Kluge …and in memory of Miriam Hansen Table of Contents Introduction Editor’s Introduction Tara Forrest The Stubborn Persistence of Alexander Kluge Thomas Elsaesser Film, Politics and the Public Sphere On Film and the Public Sphere Alexander Kluge Cooperative Auteur Cinema and Oppositional Public Sphere: Alexander Kluge’s Contribution to G I A Miriam Hansen ‘What is Different is Good’: Women and Femininity in the Films of Alexander Kluge Heide -

Metallkonflikt Geht in Die Schlichtung
Telefon (05 71)882-0 Verlagshaus J.C.C. Bruns Telefax (05 71) 882-157 Unabhängige, überparteiliche Zeitung Postfach 21 40, 32378 Minden eMail: [email protected] Internet: http://www.mt-online.de | Nr. 38/7 Montag, 15. Februar 1999 Gegründet 1856 von J.C.C. Bruns Einzelpreis 1,60 DM | lokales Heinz Schubert Freitag gestorben Schauspieler hatte als „Ekel Alfred" Nation gespalten Narrenhochburg Minden Minden (mt). Daß in Minden Hamburg (dpa). Der Schauspieler beim Karneval die Post abgeht, Heinz Schubert, das „Ekel Alfred" zeigte sich wieder einmal bei der aus dem Fernsehen, ist tot. 73jährig „Großen Prunksitzung zu Ehren starb das Multitalent am Freitag in der Damen" der Kamipo. Ein Hamburg an den Folgen einer Lun- Abend voller Narretei. Seite 3 genentzündung. Das teilte sein Sohn Benjamin Schubert mit. „Krabat" als Musical Schubert hatte schon eine erfolg- Petershagen (mt). Petershäger reiche Theaterkarriere hinter sich, Gymnasiasten brachten Otfried als er 1973 mit einer Fernsehrolle Preußlers Erzählung „Krabat" bundesweit berühmt wurde: Als als Musical auf die Bühne. Be- „Ekel" Alfred Tetzlaff lockte der se- lohnt wurden sie dafür mit stan- riöse Darsteller in der ARD-Serie «.ding ovations. Seite 7 „Ein Herz und eine Seele" regelmä- ßig Millionen vor den Bildschirm. Als reaktionärer Spießer spaltete die Figur Alfred mit seinen deftigen Wetter Sprüchen die Nation. Schubert hatte seine Schauspie- lerkarriere 1950 in Berlin gestartet, als Bert Brecht ihn an das Ensem- Heinz Schubert Foto: dpa-Archiv ble holte. Seite 11 Am Morgen scheint örtlich die Sonne, später ziehen dichte Metallkonflikt geht Wolken auf. Es bleibt größten- teils trocken. Am Abend fällt Mindener Derbysieg überschattet von Frändesjö-Verletzung Schneeregen. -

Clemency in a Nazi War Crimes Trial By: Allison Ernest
Evading the Hangman’s Noose: Clemency in a Nazi War Crimes Trial By: Allison Ernest Ernest 2 Contents Introduction: The Foundations for a War Crimes Trial Program 3 Background and Historiography 10 Chapter 1: Investigations into Other Trials Erode the United States’ Resolve 17 Chapter 2: The Onset of Trial Fatigue Due to Public Outcry 25 Chapter 3: High Commissioner McCloy Authorizes Sentence Reviews 38 Chapter 4: McCloy and the United States Set the War Criminals Free 45 Conclusion: A Lesson to be Learned 52 Chart: A Complicated Timeline Simplified 57 Bibliography 58 Ernest 3 Introduction: The Foundations for a War Crimes Trial Program “There is a supervening affirmative duty to prosecute the doers of serious offenses that falls on those who are empowered to do so on behalf of a civilized community. This duty corresponds to our fundamental rights as citizens and as persons to receive and give respect to each other in view of our possession of such rights.” Such duty, outlined by contemporary philosopher Alan S. Rosenbaum, was no better exemplified than in the case of Nazi war criminals in the aftermath of World War II. Even before the floundering Axis powers of Germany and Japan declared their respective official surrenders in 1945, the leaders of the Allies prepared possible courses of action for the surviving criminals in the inevitable collapse of the Nazi regime. Since the beginning of the war in 1939, the Nazi regime in Germany implemented a policy of waging a war so barbaric in its execution that the total numbers of casualties rivaled whole populations of countries. -

Insterburg & Co, Otto, Mike Krüger, Gebrüder Blattschuss \(Zunächst Mit
Vom Volkshumor zur Comedy Streifzüge durch die Humorgeschichte des Fernsehens von Joan Kristin Bleicher Häufig bilden Zäsuren den Ausgangspunkt für historische Rückblicke. Seit wir mit dem 11. September 2001 am Ende der Spaßgesellschaft angelangt sind, so zumindest lautet das Fazit vieler Journalisten, scheint es an der Zeit, die Ent- wicklung des zentralen Spaßfaktor Humors im gesellschaftlichen Leitmedium „Fernsehen“ zu rekonstruieren. Doch bei näherer Betrachtung erweist sich die Zäsur angesichts der tatsächlichen Programmentwicklung des Fernsehens nach dem 11. September nur als Gedankenkonstrukt der Journalisten. Nach einer kurzen Sendungspause beispielsweise der Harald Schmidt Show setzte sich die humoristische Traditionslinie im Fernsehen trotz Terroranschlägen und bewaffneter Auseinandersetzungen fort. Humor ist ein unverzichtbarer Programmfaktor des Fernsehens, der nicht nur der Unterhaltung dient, son- dern auch kritische Funktionen im Rahmen der medialen Kommunikation erfüllt. Der folgende Streifzug durch die Geschichte der Fernsehkomik kann zwar Erinnerungen an eigene Fernseherlebnisse wecken, er soll jedoch vor allem Veränderungen der Programmangebote und ihrer Funktionen deutlich machen. Zur Bedeutung des Humors in der Kulturgeschichte In unterschiedlichen Bereichen menschlicher, kultureller und medialer Kom- munikation bilden Formen des Humors ein besonderes Potenzial zur Polarisie- rung und damit auch zur gesellschaftlichen Auseinandersetzung.1 „Das La- chen baut sich gleichsam seine Gegenwelt gegen die offizielle Welt, seine Gegenkirche gegen die offizielle Kirche, seinen Gegenstaat gegen den offiziel- len Staat.“2 2 Humor in den Medien Im Gewand des Unernstes ließen sich viele ernste Botschaften unterbringen, die ansonsten in der gesellschaftlichen Kommunikation tabuisiert waren. Die Erlebnisse der Schelme in Pikaresken Romanen, zu denen sich auch Günter Grass’ „Blechtrommel“ zurechnen lässt, dienten der aktuellen kritischen Ge- sellschaftsbeschreibung. -

September 2019 Dreharbeiten in Wuppertal Für Kino- Und TV
Filmstadt Wuppertal _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Stand: September 2019 Dreharbeiten in Wuppertal für Kino- und TV- Produktionen und Dokumentarfilme The Flying Train (1902) Das Abenteuer eines Journalisten (1914) mit Ludwig Trautmann, R.: Harry Piel (Kinokop-Film) Der Schritt vom Weg (1939) mit Marianne Hoppe, Karl Ludwig Diehl, Elisabeth Flickenschild, R.: Gustav Gründgens (Terra Filmkunst) Madonna in Ketten (1949) mit Elisabeth Flickenschild, Lotte Koche, Willi Millowitsch, R.: Gerhard Lamprecht Inge entdeckt eine Stadt (1954) mit Horst Tappert, R.: Erni und Gero Priemel La Valse du Gorille (1959) mit Charles Vanel, Roger Hanin, Jess Hahn, René Havard, R.: Bernard Borderie Die Wupper (1967) Fernsehfilm mit Ilde Overhoff, Horst-Dieter Sievers, Peter Danzeisen, R.: Kurt Wilhelm, Hans Bauer Acht Stunden sind kein Tag (1972) mit Gottfried John, Hanna Schygulla, Luise Ullrich, Werner Finck; R.+D.:Rainer Werner Fassbinder, P.: Peter Märthesheimer (WDR, 5-teilige Fernsehserie) Alice in den Städten (1973) mit Yella Rottländer, Rüdiger Vogler, Lisa Kreuzer, R.: Wim Wenders (Filmverlag der Autoren/ WDR) Zündschnüre (1974) mit Michael Olbrich, Bettina Porsch, Thomas Visser, Kurt Funk, Tilli Breidenbach, R.: Reinhard Hauff (WDR) Stellenweise Glatteis (1975) mit Günther Lamprecht, Ortrud Beginnen, Giuseppe Coniglio, R.: Wolfgang Petersen Der starke Ferdinand (1976) mit Heinz Schubert, Vérénice Rudolph, Joachim -

New German Critique, No. 49, Special Issue on Alexander
new critiquegqrpian I L Number49 Winter1990 SPECIAL ISSUE ON ALEXANDER KLUGE AlexanderKluge The Assaultof the Presenton the Restof Time EricRentschler RememberingNot to Forget: A RetrospectiveReading of Kluge'sBrutality in Stone TimothyCorrigan The Commerceof Auteurism:a Voice withoutAuthority HelkeSander "You Can't AlwaysGet WhatYou Want": The Filmsof AlexanderKluge HeideSchliipmann Femininityas ProductiveForce: Kluge and CriticalTheory GertrudKoch AlexanderKluge's Phantomof the Opera AlexanderKluge On Opera, Filmand Feelings RichardWolin On MisunderstandingHabermas: A Responseto Rajchman JohnRajchman Rejoinder to Richard Wolin Marc Silberman Remembering History:The Filmmaker Konrad Wolf This content downloaded on Fri, 18 Jan 2013 09:51:49 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions NEW GERMAN an interdisciplinary journal of german studies CRITIQUE Editors:David Bathrick(Ithaca), Helen Fehervary(Columbus), Miriam Hansen (Chicago), AndreasHuyssen (New York),Anson Rabinbach (New York),Jack Zipes (Minneapolis). ContributingEditors: Leslie Adelson (Columbus), Geoff Eley (AnnArbor), Ferenc Feher (New York),Agnes Heller (New York),Peter U. Hohendahl(Ithaca), Douglas Kellner (Austin),Eberhard Kn6dler-Bunte (Berlin), Sara Lennox (Amherst),Andrei Markovits (Cambridge),Biddy Martin (Ithaca), Rainer Naigele (Baltimore),Eric Rentschler (Irvine),Henry Schmidt (Columbus), James Steakley (Madison). AssistantEditors: Ned Brinkley(Ithaca), and Karen Kenkel(Ithaca). ProjectAssistant: Cynthia Herrick (Ithaca). Publishedthree times a yearby TELOS PRESS, 431 E. 12thSt., New York,NY 10009. NewGerman Critique No. 49 correspondsto Vol. 17,No. 1. ? New GermanCritique Inc. 1990.All rightsreserved. New GermanCritique is a non-profit,educational organiza- tionsupported by theDepartment of GermanLiterature of CornellUniversity and by a grantfrom the Departmentof Germanand College of Humanitiesof Ohio State University. All editorialcorrespondence should be addressedto: NEW GERMAN CRITIQUE, Departmentof GermanStudies, 185 GoldwinSmith Hall, CornellUniversity, Ithaca, New York 14853. -

Newsletter 13/11 DIGITAL EDITION Nr
ISSN 1610-2606 ISSN 1610-2606 newsletter 13/11 DIGITAL EDITION Nr. 296 - August 2011 „Einer der beeindruckendsten Filme der letzten Jahre! Unbedingt anschauen!“ www.wolframhannemann.de Michael J. Fox Christopher Lloyd LASER HOTLINE - Inh. Dipl.-Ing. (FH) Wolfram Hannemann, MBKS - Talstr. 11 - 70825 K o r n t a l Fon: 0711-832188 - Fax: 0711-8380518 - E-Mail: [email protected] - Web: www.laserhotline.de Newsletter 13/11 (Nr. 296) August 2011 editorial Hallo Laserdisc- und DVD-Fans, liebe Filmfreunde! Herzlich willkommen zu Ausgabe 296 unseres Newsletters, die eigentlich schon vor einer Woche hätte realisiert werden sollen. Doch wie so oft waren es wieder einmal viele wichtige Termi- ne, die wahrgenommen werden mussten, bevor wir uns dem neuen Newsletter zuwenden konnten. Durch die Verspätung bedingt ist der Umfang der vorliegenden Ausgabe dafür auf ganze 72 Seiten angewachsen. Und das obwohl wir aus Platzgründen bereits weitestgehend auf Bilder verzichtet haben! Somit dürfte es also genügend Lesestoff geben, auch wenn wir in die- ser Ausgabe auf Annas Gespräch mit Hollywood verzichten müssen. Die Ärmste wird augenblicklich von Ihrer Diplomarbeit voll in Anspruch genom- men, für die wir Ihr natürlich gutes Ge- lingen wünschen. Geblieben ist in die- sem Newsletter aber immerhin noch “Wolfram Hannemanns Film-Blog”, in dem Sie alles Wichtige zu aktuellen Kinofilmen erfahren können. Damit ist auf alle Fälle genügend Lesestoff vor- handen, um die Zeit bis zum nächsten Newsletter bequem zu überbrücken. Wir wünschen viel Spaß dabei. Ihr Laser Hotline Team LASER HOTLINE Seite 2 Newsletter 13/11 (Nr. 296) August 2011 Wolfram Hannemanns Film-Blog Montag, 11. -

From Weimar to Nuremberg: a Historical Case Study of Twenty-Two Einsatzgruppen Officers
FROM WEIMAR TO NUREMBERG: A HISTORICAL CASE STUDY OF TWENTY-TWO EINSATZGRUPPEN OFFICERS A thesis presented to the faculty of the College of Arts and Sciences of Ohio University In partial fulfillment of the requirements for the degree Master of Arts James L. Taylor November 2006 This thesis entitled FROM WEIMAR TO NUREMBERG: A HISTORICAL CASE STUDY OF TWENTY-TWO EINSATZGRUPPEN OFFICERS by JAMES L. TAYLOR has been approved for the Department of History and the College of Arts and Sciences by Norman J. W. Goda Professor of History Benjamin M. Ogles Dean, College of Arts and Sciences Abstract TAYLOR, JAMES L., M.A., November 2006, Modern European History FROM WEIMAR TO NUREMBERG: A HISTORICAL CASE STUDY OF TWENTY- TWO EINSATZGRUPPEN OFFICERS (134 pp.) Director of Thesis: Norman J. W. Goda This is an examination of the motives of twenty-two perpetrators of the Jewish Holocaust. Each served as an officer of the Einsatzgruppen, mobile killing units which beginning in June 1941, carried out mass executions of Jews in the German-occupied portion of the Soviet Union. Following World War II the subjects of this study were tried before a U.S. Military Tribunal as part of the thirteen Nuremberg Trials, and this study is based on the records of their trial, known as Case IX or more commonly as the Einsatzgruppen Trial. From these records the thesis concludes that the twenty-two men were shaped politically by their experiences during the Weimar Era (1919-1932), and that as perpetrators of the Holocaust their actions were informed primarily by the tenets of Nazism, particularly anti-Semitism. -

Der WDR Als Kulturakteur
100% Der WDR als Kulturakteur Anspruch • Erwartung • Wirklichkeit 90% 80% 70% 60% 50% Kulturanteilin % 40% 30% 20% 10% Der WDR als Kulturakteur 0% 1LIVE WDR2 WDR3 WDR4 WDR5 Funkhaus 1LIVE Anspruch • Erwartung • WirklichkeitEuropa Kunst Hörfunkwelle kein Kulturbezug w eiter Kulturbegriff mittlerer Kulturbegriff enger Kulturbegriff Herausgegeben vom Deutschen Kulturrat 100% Deutscher Kulturrat e.V. 90% Gabriele Schulz Chausseestraße 103 80% 10115 Berlin Stefanie Ernst 70% Tel: 030/24 72 80 14 Olaf Zimmermann 60% Fax: 030/24 72 12 45 50% Kulturanteilin % E-Mail: [email protected] 40% Internet: www.kulturrat.de 30% 20% ISBN 978-3-934868-22-9 Wirklichkeit – Anspruch • Erwartung • als Kulturakteur WDR Der 10% 0% 1LIVE WDR2 WDR3 WDR4 WDR5 Funkhaus 1LIVE Europa Kunst Hörfunkwelle kein Kulturbezug w eiter Kulturbegriff mittlerer Kulturbegriff enger Kulturbegriff Der WDR als Kulturakteur Anspruch • Erwartung • Wirklichkeit Herausgegeben vom Deutschen Kulturrat Gabriele Schulz Stefanie Ernst Olaf Zimmermann 4 Der WDR wirtschaftlich betrachtet – Ein Überblick Bibliographische Information Die Deutsche Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. 1. Auflage Berlin Dezember 2009 Alle Rechte bei Deutscher Kulturrat e.V. Konzeption: Gabriele Schulz, Olaf Zimmermann Interviews: Stefanie Ernst Redaktion: Gabriele Schulz Satz und Layout: Birgit A. Liebl ISBN 978-3-934868-22-9 Inhaltsverzeichnis -

Das Ekel Und Die Volksseele
# 2008/31 dschungel https://jungle.world/artikel/2008/31/das-ekel-und-die-volksseele Serie über Serien: »Ekel Alfred« Das Ekel und die Volksseele Von axel klingenberg Serie über Serien. »Ekel Alfred« ist ein rechter Spießer. Axel Klingenberg liebt ihn Deutsche Adaptionen ausländischer Fernsehserien funktionieren selten – en detail sind die gesellschaftlichen Voraussetzungen und die nationalen Gemüter doch jeweils zu unterschiedlich. »Ein Herz und eine Seele« – im Volksmund eher bekannt als »Ekel Alfred« – ist eines der wenigen Gegenbeispiele. Vorbild hierfür ist die britische Produktion »’till Death Do Us Part« von Johnny Speight gewesen, dessen Held Alf schon allein deshalb komisch gewesen ist, weil er als Hafenarbeiter die Tories gewählt hat – im Großbritannien der siebziger Jahre ist eben noch klar, dass die Klassenzugehörigkeit ausschlaggebend für das Wahlverhalten ist, Arbeiter haben deshalb eigentlich Labour zu wählen. Hier und heute ist das anders. Es soll sogar Putzfrauen geben, die die Grünen wählen, als bestünde tatsächlich die Aussicht, dass ihnen dies die Partei der Akademiker und Selbständigen jemals danken würde. Alfred Tetzlaff, das deutsche Pendant zu dem britischen Monarchisten, macht sein Kreuzchen selbstredend ebenfalls bei den Konservativen, denn er ist ein Kalter Krieger, ein Spießbürger, ein Möchtegern-Patriarch, der sogar die SPD für kommunistisch hält – auch das ist in den Siebzigern noch möglich. Regisseur Wolfgang Menge lässt Alfred Tetzlaff (Heinz Schubert) Dinge sagen, die eigentlich unsagbar (wenn eben auch nicht undenkbar) sind: Seine Frau ist eine »dusslige Kuh« und sein Schwiegersohn (Diether Krebs) ein »Scheißsozi«, der »nur an seine Lenden und nicht an sein Land denkt, diese Sau«. Überhaupt die Sozis: »Die sind doch froh«, schwadroniert Alfred, »wenn wir alle impotent werden. -

Transcript of the Shoah Interview with Heinz Schubert Translation by Lotti Eichorn – Volunteer – USHMM Visitor Services – Nov 2010 to June 2011 Interview with Mr
1 Transcript of the Shoah Interview with Heinz Schubert Translation by Lotti Eichorn – Volunteer – USHMM Visitor Services – Nov 2010 to June 2011 Interview with Mr. Schubert [Legend: L= Lanzmann; W= unknown woman; M= Mrs. Schubert; A= other voice; S= Mr. Schubert; H= other male voice on pages 42 and 43] L: Hello, could I talk to Mr. Schubert? W: Yes, one moment... oh, Mrs. Schubert, somebody is here M: ..... for what reason? L: I would like to talk to Mr. Schubert.... M: ..... oh, yes, one moment please.. L: yes. M: Please come in, yes... L: Yes. This is the young lady who was here once before? Is it? Have you been here before? A: No... M: You are coming from Paris? L: Yes, I am Dr. Sorel M: Please.. L: Yes M: Please have a seat. L: Yes. M: Please, yes... L: This is a nice house M: yes, yes, but do sit down. L: .................. M: so, my husband has to get himself ready first.... he will be.... L: Yes, you have a very nice home M: yes, we are very happy here M: very pleasant, yes L: yes M: yes, really, it is very nice to live outdoors L: yes it is very beautiful............ do you smoke? M: No, but please.... when one comes from the city, it is always very pleasing to arrive here where it is quiet, really, at Ahrensburg... L: yes, yes, yes. 2 M: Pleasant. L: very pleasant M: Are you coming straight from Paris? L: No, I was in Hamburg and I had the chance to come here to Ahrensburg. -
Uva-DARE (Digital Academic Repository)
UvA-DARE (Digital Academic Repository) Hans Jürgen Syberberg und das Modell Nossendorf. Räume und Figuren ohne Ort und Zeit Nouwens, P. Publication date 2012 Link to publication Citation for published version (APA): Nouwens, P. (2012). Hans Jürgen Syberberg und das Modell Nossendorf. Räume und Figuren ohne Ort und Zeit. Eigen Beheer. General rights It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons). Disclaimer/Complaints regulations If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible. UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl) Download date:01 Oct 2021 Das Modell Nossendorf Räume und Figuren ohne Ort und Zeit Kapitel 1. Die Wiederkehr des autonomen Menschen der Moderne im Kino 1.1. Die Zusammenkunft zweierlei Idealisten: Richard Wagner und Bertolt Brecht und ihre Funktion für die Syberbergsche Ästhetik 26 1.1.1. "Syberbergs feindliche Ahnen Brecht und Wagner" und der ″Film als Musik der Zukunft″ - die Theaterästhetik Richard Wagners 29 1.1.2.