Eberhard Syring Spuren Im Stadtraum Der Titel Der Ausstellung „Soviel
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
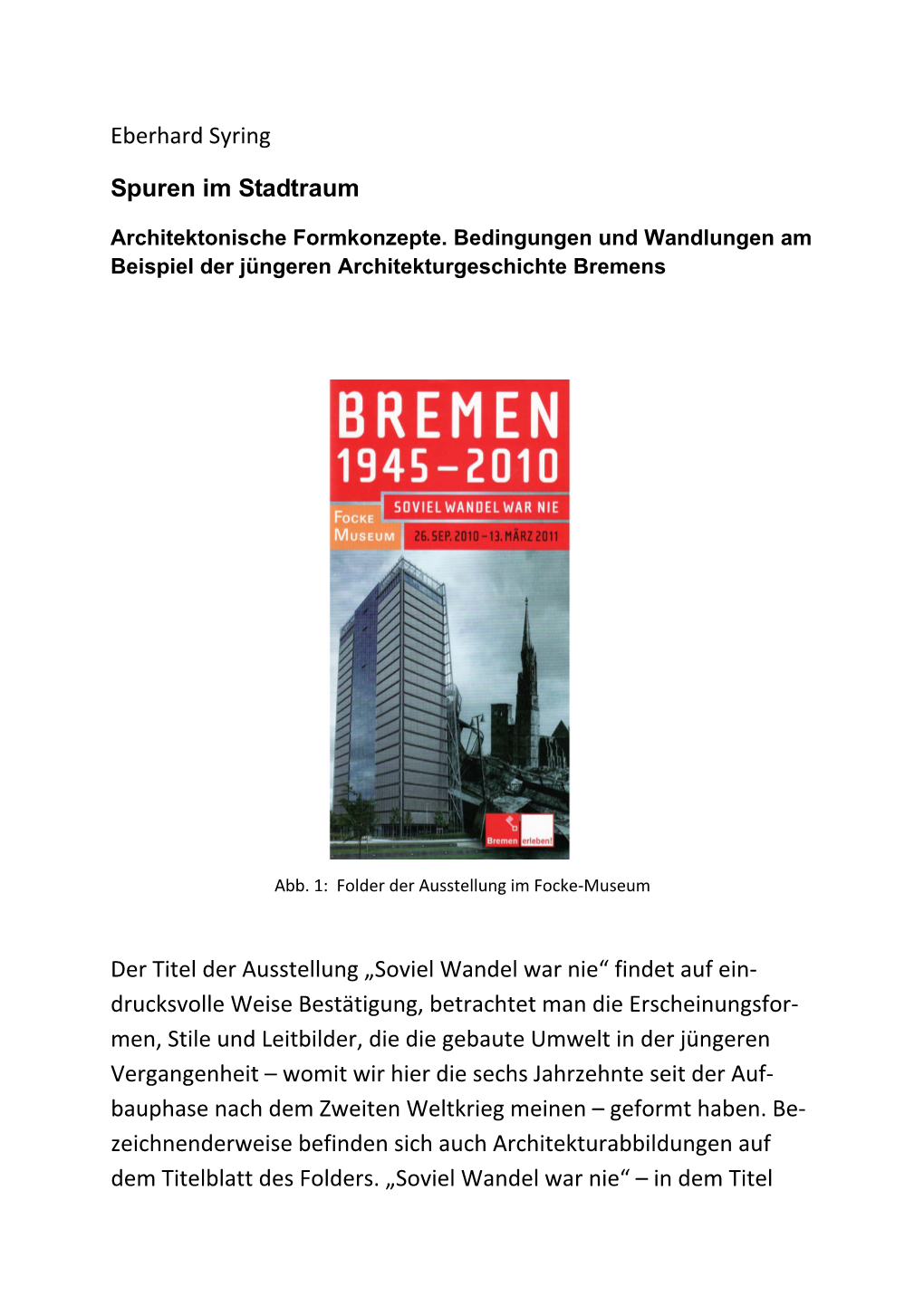
Load more
Recommended publications
-

Beteiligungsbericht 2014
Karoline Linnert, Finanzsenatorin Vorwort Mit dem Beteiligungsbericht 2014 wird ein Überblick über die Beteiligungen, Eigenbetriebe und Museumsstiftungen der Freien Hansestadt Bremen (Land- und Stadtgemeinde) sowie die Anstalt des öffentlichen Rechts „Immobilien Bremen“ vermittelt. In übersichtlicher Form werden die wichtigsten Unternehmensdaten und Personalkennzahlen dargestellt. In einer Gegenüberstellung von Beteiligungsberichten aus 81 deutschen Städten aus dem Jahr 2015 von Prof. Dr. Ulf Papenfuß, Lars Steinhauer (beide Universität Leipzig) und Dr. Bernd Peper (KPMG) wurde der Bremer Bericht insbesondere bei der Transparenz in Bezug auf die Veröffentlichung der Vergütung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat sowie bei der übersichtlichen Darstellung der Personalkennzahlen als nachahmenswertes Good-Practice- Beispiel hervorgehoben. Der Bericht 2014 bildet erstmalig den Anteil der Frauen in den Geschäftsführungen und in den Aufsichtsgremien ab, schlüsselt die Vergütung der Geschäftsführungen in ihre verschie- denen Komponenten auf und bietet eine Gesamtauswertung über spezifische Daten aller dargestellten Beteiligungen. (Karoline Linnert) Senatorin für Finanzen Inhaltsverzeichnis A. Allgemeines ...................................................................................... 7 Grundlagen für Beteiligungen der Freien Hansestadt Bremen ....................................................... 8 Wesentliche Veränderungen im Beteiligungsportfolio ..................................................................... 9 Beteiligungen in -

Bremen Mit Dem Rad Entdecken
radwegflyer_neu:radwegflyer_RZ 30.09.2008 18:31 Uhr Seite 1 Mit dem Rad durch die Stadt? – Service & Infos Adressen Womit denn sonst? In der traditions- Radstation Bremen Am Bahnhofsplatz 14a reichen Freien Hansestadt mag das 28195 Bremen Tel. 04 21 - 17 83 361 Rad vielleicht nicht erfunden worden Der Bremer Stadtweg ist Bestand - [email protected] teil des Grünen Ringes Region www.radstationbremen.de sein, aber es gilt als natürliches Bremen, einem 800 km langen www.radort-bremen.de touristischen Radwegenetz mit drei www.adfc-bremen.de Fortbewegungsmittel. Nicht nur die Ringwegen und Querverbindun - Call a bike: gen. Der Grüne Ring verbindet die Tel. 0 70 00 - 5 22 55 22 Werder-Profis machen es vor. kulturellen und landschaftlichen www.callabike.de Sehenswürdigkeiten der Stadt Bremen und der 23 niedersächsi- 1 Jugendherberge Bremen Der „Bremer schen Nachbarstädte und -gemein- Kalkstraße 6 · 28195 Bremen den. Über 30 Bahnhöfe, drei histo- Tel. 04 21 - 16 38 20 Stadtweg“ lädt rische Eisenbahnen und mehrere [email protected] Schifffahrtslinien erlauben die www.jugendherberge.de/jh/bremen alle Binnen- und Kombination mit Bahn-Bus-Boot- Schiff&Bike. 2 Camping am Stadtwaldsee Butenbremer, alle www.gruener-ring-region-bremen.de Hochschulring 1 · 28359 Bremen www.radtouren-bremen.de Tel. 04 21 - 84 10 748 Kurz- und Dauer - www.radroutenplaner-bremen.de [email protected] www.nordwesten.net www.camping-stadtwaldsee.de gäste nun ein, 3 Reisemobilstellplatz die schönsten Seiten der Stadt per – Am Kuhhirten – Kuhhirtenweg · -
Infobroschuere E 2016
E iinformation Wachstum durch Wissen - IMPORTANT PHONE NUMBERS Wissenschafft für Bremen » University Rector Prof. Dr. Bernd Scholz-Reiter | +49 (0) 421 - 218 - 600 11 Ein lebendiges Netzwerk E-Mail: [email protected] für eine exzellente Wissenschaft. » Vice Rector for Research and Young Academics Prof. Dr. Andreas Breiter | +49 (0) 421 - 218 - 600 21 E-Mail: [email protected] Schon 1961 fanden sich die unifreunde als private » Vice Rector for Studies and Education Initiative zusammen, um das Projekt einer Alma Mater Prof. Dr. Thomas Hoffmeister | +49 (0) 421 - 218 - 600 21 für Bremen engagiert zu unterstützen. E-Mail: [email protected] » Vice Rector for International Affairs and Diversity Seither sind ihre Mitgliedzahl, ihre Durchschlagskraft Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu |+49 (0) 421 - 218- 600 41 und das Spektrum der Aktivitäten stetig gewachsen. E-Mail: [email protected] » Director of Finance and Administration An der Fortschreibung Bremens als wissenschaftliches Dr. Martin Mehrtens | +49 (0) 421 - 218 - 601 01 E-Mail: [email protected] „Center of Excellence“ arbeiten die unifreunde aktiv mit. » Press Office Mehr unter +49 (0) 421 - 218 - 601 50 unifreun.de E-Mail: [email protected] » UniTransfer +49 (0) 421 - 218 - 603 30 E-Mail: [email protected] » International Office +49 (0) 421 - 218 - 603 60 E-Mail: [email protected] » Central Student Advisory Office unifreunde Bremen +49 (0) 421 - 218 - 611 60 E-Mail: [email protected] c/o KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG Postfach 104307 · 28043 Bremen Telefon 0421-3055-214 -

Sfd Jahresbericht 2018-2019
sfd Jahresbericht 2018/2019 (+ das erste Halbjahr 2020) Engagiert in Bremen – für eine lebendige & vielfältige Stadt Freiwilligen Agentur Bremen im sfd Inhalt Netzwerke schaffen: Engagement in Krisenzeiten 03 Jahresrückblicke – eine Auswahl 04 Der sfd in Zahlen 06 Finanzen 2018 08 Der sfd-Vorstand im Interview 09 Das sfd-Team im Bild 10 Kooperationspartner*innen und Förder*innen 11 Freiwilligen Agentur Bremen sfd im sfd Impressum Sozialer Friedensdienst e. V., Dammweg 18 – 20, 28211 Bremen | ViSdP: Lena Blum, Andreas Rheinländer | Redaktion: Benjamin Moldenhauer Gestaltung: agenturimturm.com | Fotos: Mohammad Ashour, Balu und Du e. V., Alexander Brending, Gesa Ferger, Susanne Frerichs, Gesche Jäger, Jugendfreiwilligendienste, Jan-Hendrik Kamlage, Thomas Schaefer, Marta Urbanelis www.sfd-bremen.de www.freiwilligen-agentur-bremen.de Mitglied bei: Die Freiwilligen-Agentur Bremen ist mit dem Gütesiegel der bagfa e. V. ausgezeichnet. Gefördert u. a. von: Freie Die Senatorin für Hansestadt Kinder und Bildung Bremen Netzwerke schaffen: Engagement in Krisenzeiten Unser letzter Jahresbericht war geprägt von den Ein- Die politische Polarisierung scheint drücken der sogenannten Flüchtlingskrise. Der aktuelle, weiter voranzuschreiten. Eine der die Jahre 2018 und 2019 und das erste Halbjahr 2020 Entwicklung, auf die wir im sfd re- abdeckt, steht wiederum unter dem Einfluss einer Krise. agieren, unter anderem indem wir Sicher ist, dass die Corona-Pandemie die Gesellschaft Rhetorik-Seminare für Freiwillige vor eine große Belastungsprobe stellt. Die Versamm- anbieten, die sich gegen Vorurteile lungsfreiheit war eingeschränkt, das Leben in Vereinen zur Wehr setzen wollen. Aktuelle Entwicklungen der und Initiativen stand still und ausbleibende Einnahmen rechten Szene in Deutschland sind seit Jahren schon The- bedrohen die Existenz vieler Menschen, Unternehmen ma auf den Seminaren in den Jugendfreiwilligendiensten. -

The State of Bremen Your Key to Germany Bremen Is the 11Th Largest City in Germany with 552,000 Inhabitants
THE STATE OF BREMEN YOUR KEY TO GERMANY Bremen is the 11th largest city in Germany with 552,000 inhabitants. Bremerhaven has 110,000 inhabitants, while the region around Bremen is home to about 2 million people. Bremen is a growing city. 41. 31. German sports leagues Basketball, ice hockey, and dance sport 42. 32. Bremerhaven Zoo 39. Polar bears and sea lions 33. The fish and food industry The largest fish processing site in Germany 34. Climate House 8° East 43. 37. 38. A journey around the world along the 8th line of longitude 35. German Emigration Center Ten Reasons 44. Bringing historical migrations to life 36. University of Applied Sciences Bremerhaven TO COME AND STAY 40. Research and science by the sea 35. 37. Atlantic Hotel Sail City Experience maritime history and flair 1_Bremen is Europe‘s logistics hub 36. 38. The port Goods from all over the world are distributed in the ports and via The largest automobile import and export port in Europe the Cargo Distribution Center. There is always at least one solution 39. Container terminal for any logistical challenge in the State of Bremen. Handling 5.5 million containers annually 34. 40. Bremerhaven The second-largest port in Germany 2_Bremen is one of the top ten industrial sites in Germany 41. SAIL Globally operating companies such as Mercedes-Benz, Airbus, 31. 33. Spectacular Windjammer Festival 32. Mondelez, AB InBev, and many more have made a conscious 42. Offshore wind farms decision to be located in Bremen. Bremerhaven Wind Energy Competence Center 43. Columbus Cruise Center Modern cruise ship terminal 3_Bremen is easy to reach 1. -

BEGEGNUNGEN 2005 Bremen 2009
INITIATIVE BEGEGNUNGEN 2005 Unter der Schirmherrschaft von Hildegard Müller MdB, Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin BEGEGNUNGEN 2005 Bremen 2009 "Instruments of Peace" Spring 2009 Young people are celebrating Understanding and Peace in Bremen Together with the Choir "Meytav" Vocal-Ensemble from Rosh Ha'ayin, Israel For a democratic and understanding society - against racism and ignorance between the cultures. "Meytav" Vocal Ensemble aus Rosh Ha'ayin An international event for the Christian - Jewish Understanding in Bremen, including young people of Muslim belief 15 Israelis hosted by families in Bremen The Meytav Vocal Ensemble is from the Israeli city Rosh Haayin. It was founded in 2005 by its present conductor and music director and the following year it became a member of the Israeli Hallel Choral Organization. The ensemble, which is part of the Rosh-Haayin Music Conservatory, includes 18 singers aged 13-18 years old who come together twice a week at the Rosh-Haayin Music Institute, Meytav's home base. Soon after its establishment the Meytav Vocal Ensemble became Rosh-Haayin's most celebrated vocal group. The group regularly performs at a variety of major events including municipal, ceremonies, and at concerts throughout Israel. The young singers come from various social and economic backgrounds and often join the group with no prior musical knowledge or education. They are motivated by their talent and have a deep sense of dedication to the art of music, and a desire to perform at the highest professional level. Once they are accepted into the group, the singers undertake a program of voice and language training, instrumental training, music theory and appreciation, movement and drama. -

Blick Ins Buch
Land und Leute Reise-Infos von A bis Z Jakobsweg von Bremen nach Köln Index Jakobspilgerstele am Teutoburgerwaldkamm, 10. Etappe Tolle Aussicht von der Hohensyburg, 18. Etappe Band 301 OutdoorHandbuch Martin Simon und Klaus Engel Jakobsweg Bremen – Köln Jakobsweg Copyright Conrad Stein Verlag GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Der Nachdruck, die Übersetzung, die Entnahme von Abbildungen, Karten, Symbolen, die Wiedergabe auf fotomechanischem Wege (z. B. Fotokopie) sowie die Verwertung auf elektronischen Datenträgern, die Einspeicherung in Medien wie Internet (auch auszugsweise) sind ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages unzulässig und strafbar. Alle Informationen, schriftlich und zeichnerisch, wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und überprüft. Sie waren korrekt zum Zeitpunkt der Recherche. Eine Garantie für den Inhalt, z. B. die immerwährende Richtigkeit von Preisen, Adressen, Telefon- und Faxnummern sowie Internetadressen, Zeit- und sonstigen Angaben, kann naturgemäß von Verlag und Autor – auch im Sinne der Produkthaftung – nicht übernommen werden. Der Autor und der Verlag sind für Lesertipps und Verbesserungen (besonders per E-Mail) unter Angabe der Auflagen- und Seitennummer dankbar. Dieses OutdoorHandbuch hat 256 Seiten mit 42 farbigen Abbildungen sowie 31 farbigen Kartenskizzen im Maßstab 1:100.000, 11 farbigen Höhenprofilen, 5 farbigen Stadtplänen und einer farbigen, ausklappbaren Übersichtskarte. Es wurde auf chlorfrei gebleichtem, FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt, in Deutschland klimaneutral hergestellt und -

Information for International Master Students at the University of Bremen
Information for International Master Students at the University of Bremen 1 Before leaving your home country … 2 1.1 Visa and residence permit 2 2 General information concerning Bremen and the University of Bremen 2 2.1 The City of Bremen 3 2.2 The University of Bremen 4 3 Campus facilities 5 3.1 Campus map 5 3.2 ‘Studierendenwerk’ (Student Welfare Service) 5 3.3 ‘Zentrum für Netze’ (Computer Network Center) 6 3.4 ‘Staats- und Universitäts-Bibliothek’ (State and University Library) 6 3.5 Student counselling 7 3.6 International Office 8 3.7 ‘Allgemeiner Studierenden-Ausschuss’ (General Students’ Council) 8 3.8 Practical tips related to studies and campus 9 4 Information for Incoming Students 9 4.1 Learning German/learning English 9 4.2 Accommodation 10 4.3 Finding your way through every day 12 4.4 A little guide to German habits and other pecularities 14 5 Formalities 16 5.1 Residents’ Registration Office 16 5.2 Aliens’ Registration Authority 16 5.3 Visa renewal 16 5.4 Enrolment requirements and semester contribution 17 5.5 Opening a bank account 18 5.6 Health insurance and medical treatment 19 5.7 Other insurances 21 6 Money and finances 21 6.1 Living costs 21 6.2 Working (Employment) 22 6.3 Scholarships, grants and stipends 22 6.4 Help in difficult situations 23 1 Before leaving your Home Country… You would like to study at the University of Bremen and are now preparing for your move. You have to contact the German diplomatic representation in your home country for a visa, and arrange for certified documentation of your financial support. -

Land Bremen 2015 Tourismuskonzept Land Bremen 2015
Der Senator für Wirtschaft und Häfen Tourismuskonzept Land Bremen 2015 Ein Beitrag zum Strukturkonzept 2015 Der Senator für Wirtschaft und Häfen Tourismuskonzept Land Bremen 2015 Ein Beitrag zum Strukturkonzept Land Bremen 2015 Tourismuskonzept Land Bremen 2015 Inhaltsverzeichnis Vorwort 5 1 Vorbemerkung 7 2 Ausgangslage – Tourismus in Bremen und Bremerhaven heute – 9 3 Entwicklung des Tourismus und quantitative Ziele bis 2015 15 3.1 Tourismusentwicklung im Land Bremen 15 3.2 Tourismus in Bremen und Bremerhaven im Städtevergleich 17 3.3 Quantitative Ziele für Bremen und Bremerhaven 19 4 Zielgruppen für Bremen und Bremerhaven 21 4.1 Geschäftsreisende 22 4.2 Kulturinteressierte Städtereisende 22 4.3 Best Ager 50 plus 22 4.4 Familien 23 4.5 Ausländische Gäste 23 4.6 Kreuzfahrttouristen 24 4.7 Gruppenreisende 24 5 Inhaltliche Schwerpunkte und abgeleitete Maßnahmen 25 5.1 Bremen 25 5.1.1 Maritim: Bremen – Stadt am Fluss 25 5.1.2 Historisch/lebendig: Kultur, Geschichte und Veranstaltungen in Bremen 26 5.1.3 Innovativ: Erlebnis- und Wissenswelten in Bremen 27 5.1.4 Geschäftlich: Messe- und Kongresswesen in Bremen 28 5.2 Bremerhaven 30 5.2.1 Maritim: Bremerhaven – Stadt am Meer 30 5.2.2 Historisch/lebendig: Kultur, Geschichte und Veranstaltungen in Bremerhaven 32 5.2.3 Innovativ: Erlebnis- und Wissenswelten in Bremerhaven 33 5.2.4 Geschäftlich: Messe- und Kongresswesen in Bremerhaven 33 6 Marketing und regionale Kooperation 35 7 Tourismusförderung 37 7.1 Ausbau, Erhalt und Sanierung der öffentlich touristischen Infrastruktur 38 7.2 Unternehmensförderung -

BTZ Reisekatalog D
BREMEN REISE-KATALOG 2019 BREMEN ERLEBEN! BREMEN HAT VIELE GESICHTER Die Hansestadt ist das pulsierende Herz Nordwestdeutschlands und Heimatstadt der weltberühmten Bremer Stadtmusikanten. Eine Großstadt mit vielen Facetten – Geschichte, Tradition, Wissenschaft, Natur und Kultur vereinen sich zu einem immer wieder faszinierenden Gesamtbild. Bremen erleben lohnt sich, und das Interesse an der 1.200 Jahre alten Stadt am Fluss boomt. Kiek mol rin! Bremen, Stadt der kurzen Wege Mit der Straßenbahn in nur elf Minuten von der Innenstadt zum Flughafen Bremen, direkt vor das Hauptterminal. Vom Hauptbahnhof zum Messegelände sind es drei Gehminuten, zur Innenstadt etwa zehn. Kaum zu glauben für eine Großstadt – aber wahr! Die Stadt lässt sich wunderbar zu Fuß oder per Rad erkunden oder Sie nutzen den öffentlichen Nahverkehr. Unser Tipp dazu: die ErlebnisCARD, siehe Seite 10. Parkplatz gesucht? In unseren Hotelbeschreibungen (ab S. 68) finden Sie Informationen zu hoteleigenen Parkplätzen. Oder Sie parken kostenlos am Stadtrand und fahren entspannt mit Bus und Bahn in die Innenstadt – der Park & Ride-Service macht es möglich. (vmz.bremen.de oder brepark.de) Kostenloses W-LAN Unsere Tourist- Informationen Vor Ort in Bremen – Böttcherstraße 4 Hauptbahnhof besuchen Sie uns! Anerkannte Tourist-Informations- stelle (ATIS) für professionelle Wir geben Ihnen wertvolle Tipps Mo-Fr 9.30 -18.30 Uhr Mo-Fr 9 -18.30 Uhr Informations- und Serviceleistungen Sa 9.30 -17 Uhr Sa +So 9.30 -17 Uhr sowie qualifizierte Mitarbeiter- für Ihren Aufenthalt in Bremen weiterbildung. und freuen uns auf Ihren Besuch. So 10 -16 Uhr Eingang/Theke 2 Eingang/Theke Theke 1 Rollstuhl zum Ausleihen Sitzbreite 48 cm, Sitztiefe 42 cm, Rückenhöhe 43 cm, Sitzhöhe 50 cm, für Körpergewicht bis 130 kg, inkl. -

Lebendige Städte Lifestyle, Kultur Und Freizeit Lebendige Städte
www.germany.travel www.germany.travel 2011/2012 Lebendige Städte Lifestyle, Kultur und Freizeit Lebendige Städte Reiseland Deutschland Städte und Metropolen VORWORT dieser Region. In Baden-Württemberg feiert man 2011 das Jubiläum der Erfindung des Automobils in Deutschland – in der Hauptstadt Stuttgart, aber auch in zahlreichen größeren und kleineren Städten wie z. B. Karlsruhe und Mannheim. Und auch andere Leucht- türme der Automobillandschaft in Deutschland haben sich gerüstet, Autofans und Städtereisende aus aller Welt mit Events und Ausstellungen zu begeistern. Petra Hedorfer, Vorsitzende des Vorstandes der DZT Deutschland ist weltweit Kulturreiseziel Nummer zwei der Europäer. Doch spätestens nach dem Fuß- ballfest 2006 steht das Reiseland mit seinen Metro- Liebe Leserinnen und Leser, polen auch für Sportbegeisterung. Die aufsehener- regenden Stadien mit ihrer modernen Architektur das Reiseland Deutschland ist attraktiver denn je. und ihren technischen Errungenschaften sind An- Im abgelaufenen Jahr 2010 konnte erstmals die ziehungspunkte für Besucher aus aller Welt. Bei der TM Rekordmarke von 60 Millionen Übernachtungen FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Deutschland 2011 ausländischer Gäste durchbrochen werden. Deutsch- werden diesmal neben Berlin mit dem Eröffnungs spiel land zählt damit zu den beliebtesten internationalen auch kleinere Stadien in den Fokus des internationalen Reisedestinationen der Welt. Publikums gerückt. Insgesamt neun Städte freuen sich als Austragungsorte auf das Sommermärchen 2011. Getragen wird die Attraktivität des Reiselandes Deutschland ganz maßgeblich von den Landeshaupt- Die neue Broschüre „Lebendige Städte in Deutsch- städten und Metropolen, die unterschiedlicher und land“ gibt Städtereisenden aus dem Ausland einen spannungsreicher nicht sein könnten. Es sind ins- schnellen und umfassenden Überblick über die besondere die Städte, die Besucher aus aller Welt in Landeshauptstädte und weitere rund 40 der be- ihren Bann ziehen. -

Wegbeschreibungen Zur Jahrestagung Der Deutschen
Wegbeschreibungen zur Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Musikpsychologie in Bremen (28.-30.9.2012) Anfahrt zur Universität mit öffentlichen Verkehrsmitteln Ab dem Bremer Hauptbahnhof mit der Straßenbahnlinie 6 in Richtung Universität bis „Universität / NW 1 / Universum Science Center“. Von dort entgegen Fahrtrichtung entlang des Parkplatzes, links abbiegen in Enrique-Schmidt-Straße, auf der rechten Straßenseite vorbei am Gebäude „Cartesium“, Emmy-Noether-Straße überqueren bis zum Gebäude „SFG“. Die Tagungsräume befinden sich im Erdgeschoss des SFG. Anfahrt zur Universität mit dem Auto • Von Norden (Bremerhaven): Über die A27 bis zur Abfahrt Horn-Lehe • Von Osten (Hamburg): Über die A1 bis zum Bremer Kreuz, dann auf die A27 in Richtung Bremerhaven bis zur Abfahrt Horn-Lehe. • Von Süden (Hannover): Über die A7 bis zum Walsroder Dreieck, dort auf die A27 in Richtung Bremerhaven bis zur Abfahrt Horn-Lehe. • Von Westen (Oldenburg): Über die A28 Richtung Bremen, an der Anschlussstelle Delmenhorst-Hasport abfahren von der A28, weiter auf der B75 in Richtung Autobahndreieck Delmenhorster Dreieck, in Bremen weiter auf der Oldenburger Straße in Richtung Anschlussstelle Bremen-Neustadt, dort auf die B6 in Richtung Bremen, an der Anschlussstelle Bremen-Überseestadt halb rechts auffahren auf die A27 in Richtung Hannover/Hamburg bis zu Abfahrt Horn-Lehe. Von der Abfahrt Horn-Lehe: Auf dem Autobahnzubringer in Richtung Horn- Lehe/Universität, nach 800m 2. Ampel rechts auf Universitätsallee, nach 300m 1. Ampel rechts auf die Enrique-Schmidt-Straße und dort auf den großen Parkplatz (gebührenpflichtig: 80 Cent pro Tag). Von dort siehe Beschreibung oben. Anfahrt zur den Restaurants Restaurant Café Unique: im Erdgeschoss des Gebäudes „SFG“. Restaurant Bremer Ratskeller: von der Uni aus mit der Straßenbahn Linie 6 Richtung „Flughafen“ bis zur Haltestelle „Schüsselkorb“, rechts über den Domshof Richtung Rathaus, dort befindet sich neben der Bronzefigur der Bremer Stadtmusikanten der Eingang zum Ratskeller.