Limbourg Eupen
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
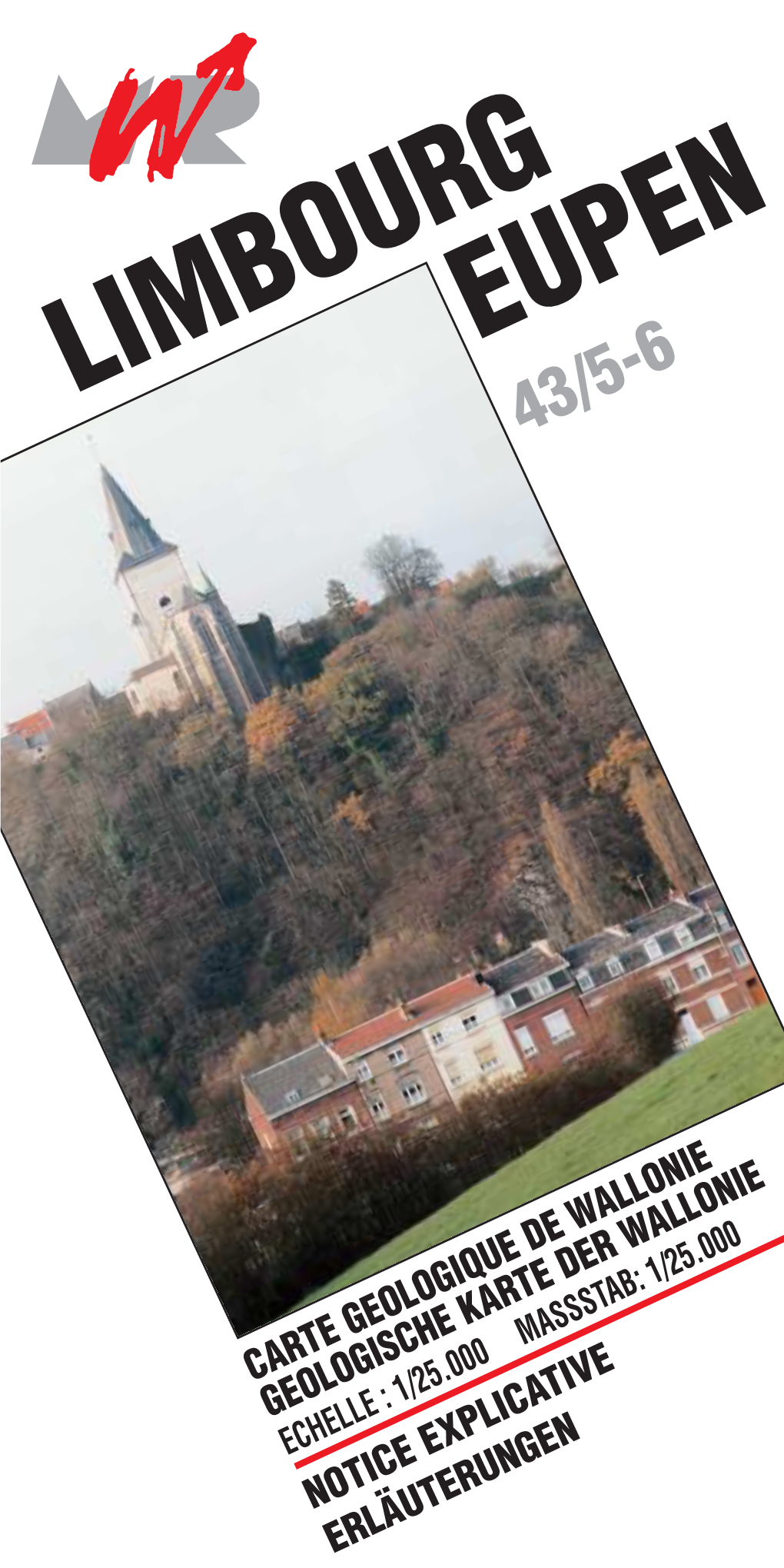
Load more
Recommended publications
-

Remplir Votre Déclaration D'impôt ? Nos Experts Vous Aident Volontiers
Remplir votre déclaration d’impôt ? Nos experts vous aident volontiers. Séances organisées par le SPF Finances en province de Liège N’oubliez pas : • Carte d’identité obligatoire • Vous venez pour une autre personne ? Apportez une copie de sa carte d’identité et une procuration Plus d’info sur la déclaration : www.fin.belgium.be > Particuliers > Déclaration 2019 Ville/commune Adresse Sur RDV ? Date Heure ANS Administration communale Uniquement sur RDV Mardi 28 mai 2019 9 h - 12 h et 13 h - 16 h Esplanade de l'Hôtel communal 1 04 247 72 94 Mercredi 29 mai 2019 4430 Ans ANTHISNES Administration communale Uniquement sur RDV Mercredi 15 mai 2019 9 h - 12 h et 13 h - 16 h Cour d'Omalius 1 04 383 99 91 4160 Anthisnes AUBEL Administration communale Uniquement sur RDV Vendredi 17 mai 2019 9 h - 12 h et 13 h - 16 h Place Nicolaï 1 087 68 01 30 4880 Aubel AWANS Administration communale Uniquement sur RDV Mercredi 22 mai 2019 9 h - 12 h et 13 h - 16 h Rue des Ecoles 4 04 364 06 51 Vendredi 24 mai 2019 4340 Awans AYWAILLE Salle des mariages Uniquement sur RDV Lundi 20 mai 2019 9 h - 12 h et 13 h - 16 h Rue de la Heid 8 04 384 40 17 Mercredi 22 mai 2019 4920 Aywaille Jeudi 23 mai 2019 Situation au 02.05.2019 - Liège 1 Ville/commune Adresse Sur RDV ? Date Heure BAELEN Administration communale Sans RDV Jeudi 23 mai 2019 9 h - 12 h Rue de la Régence 1 4837 Baelen BASSENGE CPAS Sans RDV Vendredi 17 mai 2019 9 h - 15 h Rue du Frêne 36 Vendredi 24 mai 2019 4690 Boirs BEAUFAYS Espace Beaufays Sans RDV Mercredi 5 juin 2019 9 h - 12 h et 13 h - 16 h Voie de -

Paths to the City and Roads to Death Mortality and Migration in East Belgium During the Industrial Revolution
Paths to the city and roads to death Mortality and migration in East Belgium during the industrial revolution MICHEL ORIS Professor, Department of Economic History, University of Geneva GEORGE ALTER Professor, Population Institute for Research and Training (PIRT), Indiana University INTRODUCTION For a long time, population historians have believed that urban populations in the Middle Ages and the Early Modern Period were not able to grow without migration from rural areas (De Vries, 1984, ch. 9). In a famous contribution, Sharlin (1978) emphasized the importance of differential mortality of natives and immigrants in this urban demographic dynamic. However, this question has been neglected by researchers working on the nineteenth century, while it is during that period that rural worlds became more urban and industrial (see Williamson, 1988 for a nice exception). In France (Pitié, 1979, esp. 25-29), in England (Lawton, 1989, 8-9) as well as in Belgium (Van Molle, 1983), several authors have studied the immediate perceptions of such major changes. Ur- banization, especially the industrial type, has been seen as a monster, a chaotic explosion of mines, a mass of factories and miserable houses constructed without order and caution, a cradle of new epidemics like cholera, and a society where promiscuity endangers sexual morality as well as private hygiene (Moch, 1992, 143). Moreover, the chaos of the tentacle towns (“les villes tenta- culaires” of the Belgian poet Verhaeren) consumed a rural world depicted in soft colors, as the refuge of naivety, virtues, morality, health, and so on. Naturally, the migrant was typically pictured as a rustic, morally and physi- cally destroyed by the perversity of the urban environment (Pinol, 1991, 55- 60). -

Charte Du Pass Bibliothèques
Charte du Pass Bibliothèques Réseau de la Lecture publique en province de Liège Contexte Après le lancement de la carte unique en 2008 dans le réseau local liégeois, cette carte évolue et est devenue en septembre 2010 le Pass Bibliothèques qui donne accès aux bibliothèques participantes, dont la liste complète se trouve à l’intérieur de ce document. Le graphisme du recto de ce pass est commun aux partenaires, afin de faciliter son identification. Le verso est quant à lui personnalisé selon le lieu d’obtention du pass. Les modalités pratiques de prêt restent propres à chaque bibliothèque et peuvent être obtenues sur demande auprès de la bibliothèque concernée ou sur son site Internet. Inscription Toute personne adulte qui sollicite son inscription dans une bibliothèque du réseau doit présenter sa carte d’identité. Le montant de l’inscription est de 6€ et celle-ci est valable 1 an à partir de la date d'inscription. Les jeunes de moins de 18 ans, lors de leur inscription, seront tenus de présenter une autorisation parentale. En sollicitant le Pass Bibliothèque, le lecteur s’engage à respecter le règlement intérieur de chaque bibliothèque qu’il fréquente. Dispositions particulières Les lecteurs sont tenus de signaler tout changement d’adresse à la bibliothèque de leur choix. La perte du Pass Bibliothèques doit être signalée le plus rapidement possible. Son remplacement entraîne obligatoirement une réinscription, donc la perception d’une nouvelle cotisation pour les adultes et 2€ pour les moins de 18 ans. Tous les cas non prévus par la présente charte sont tranchés de manière collective par les Directions des bibliothèques du Réseau de la Lecture publique. -

Belgium-Luxembourg-7-Preview.Pdf
©Lonely Planet Publications Pty Ltd Belgium & Luxembourg Bruges, Ghent & Antwerp & Northwest Belgium Northeast Belgium p83 p142 #_ Brussels p34 Wallonia p183 Luxembourg p243 #_ Mark Elliott, Catherine Le Nevez, Helena Smith, Regis St Louis, Benedict Walker PLAN YOUR TRIP ON THE ROAD Welcome to BRUSSELS . 34 ANTWERP Belgium & Luxembourg . 4 Sights . 38 & NORTHEAST Belgium & Luxembourg Tours . .. 60 BELGIUM . 142 Map . 6 Sleeping . 62 Antwerp (Antwerpen) . 144 Belgium & Luxembourg’s Eating . 65 Top 15 . 8 Around Antwerp . 164 Drinking & Nightlife . 71 Westmalle . 164 Need to Know . 16 Entertainment . 76 Turnhout . 165 First Time Shopping . 78 Lier . 167 Belgium & Luxembourg . .. 18 Information . 80 Mechelen . 168 If You Like . 20 Getting There & Away . 81 Leuven . 174 Getting Around . 81 Month by Month . 22 Hageland . 179 Itineraries . 26 Diest . 179 BRUGES, GHENT Hasselt . 179 Travel with Children . 29 & NORTHWEST Haspengouw . 180 Regions at a Glance . .. 31 BELGIUM . 83 Tienen . 180 Bruges . 85 Zoutleeuw . 180 Damme . 103 ALEKSEI VELIZHANIN / SHUTTERSTOCK © SHUTTERSTOCK / VELIZHANIN ALEKSEI Sint-Truiden . 180 Belgian Coast . 103 Tongeren . 181 Knokke-Heist . 103 De Haan . 105 Bredene . 106 WALLONIA . 183 Zeebrugge & Western Wallonia . 186 Lissewege . 106 Tournai . 186 Ostend (Oostende) . 106 Pipaix . 190 Nieuwpoort . 111 Aubechies . 190 Oostduinkerke . 111 Ath . 190 De Panne . 112 Lessines . 191 GALERIES ST-HUBERT, Beer Country . 113 Enghien . 191 BRUSSELS P38 Veurne . 113 Mons . 191 Diksmuide . 114 Binche . 195 MISTERVLAD / HUTTERSTOCK © HUTTERSTOCK / MISTERVLAD Poperinge . 114 Nivelles . 196 Ypres (Ieper) . 116 Waterloo Ypres Salient . 120 Battlefield . 197 Kortrijk . 123 Louvain-la-Neuve . 199 Oudenaarde . 125 Charleroi . 199 Geraardsbergen . 127 Thuin . 201 Ghent . 128 Aulne . 201 BRABO FOUNTAIN, ANTWERP P145 Contents UNDERSTAND Belgium & Luxembourg Today . -

Of One Member State and Habitually Resides in Another Member State Be
OPINION OF MR LENZ — CASE 137/84 of one Member State and habitually language other than the language resides in another Member State be normally used in proceedings before the entitled, under the same conditions as a court which tries him. Such an worker who is a national of the host entitlement falls within the meaning of Member State, to require that criminal the term 'social advantage' as used in proceedings against him take place in a Article 7 (2) of that regulation. OPINION OF MR ADVOCATE GENERAL LENZ delivered on 28 March 1985 * Mr President, trial was served on the accused in French Members of the Court, but with a German translation. Since the accused did not appear at his trial, A. (1) The reference for a preliminary ruling on 2 November 1982 the Tribunal de with which this opinion is concerned, made Première Instance [Court of First Instance], by the Cour d'Appel [Court of Appeal], Verviers, found him guilty in absentia and Liège, in connection with criminal ordered him to pay a fine. The accused proceedings, is based on the following applied to have that judgment set aside and circumstances : at the same time requested that the proceedings should take place in German. By judgment of 23 November 1982 the Tribunal de Première Instance, Verviers, in On 27 August 1981 an inhabitant of a criminal session, German-speaking municipality in eastern .Belgium clashed with members of the Belgian Gendarmerie after an extended granted the application and ordered that the 'pub-crawl'. In the course of the dispute proceedings continue in German; they came to blows. -

Petit Patrimoine, Raconte-Nous Ton Histoire
Administration communale de Dalhem Parcourir la commune de Dalhem à pied, à vélo, à moto ou en voiture procure un réel plaisir. La saison la plus belle est peut-être le printemps avec les pommiers, les poiriers et les cerisiers en fleurs ; à moins que ce ne soit l’été quand la fenaison laisse flotter dans l’air les senteurs d’herbe fraîchement coupée, non loin des moissons avec leurs ballots de paille qui décorent le paysage ; ou encore l’automne ou l’hiver ? A chacun sa préférence ! raconte-nous ton histoire Dans ce petit coin de paradis rural, bien souvent en bordure de voirie, se dressent aussi les éléments du Petit Patrimoine que des femmes et des hommes ont laissés comme traces d’événements marquants. C’est l’histoire locale qui se lit alors à travers tous ces témoins dont le dernier en date a été inauguré le 4 juillet 2020. L’Histoire n’est pas faite que du passé, elle se vit aussi maintenant. Les 121 éléments du Petit Patrimoine – fontaines, pompes, croix, potales, monu- ments militaires ou autres – vous invitent à leur découverte. PETIT Chrystel BLONDEAU PATRIMOINE raconte-nous ton histoire PETIT PATRIMOINE ADMINISTRATION COMMUNALE Avec le soutien de la Rue de Maestricht 7 4607 DALHEM [email protected] www.dalhem.be DALHEM Chrystel BLONDEAU 89148_000_Cover.indd 1 17/11/20 11:48 89148_01_Preface.indd 4 17/11/20 11:50 Administration communale de Dalhem PETIT PATRIMOINE raconte-nous ton histoire Chrystel BLONDEAU 89148_01_Preface.indd 1 17/11/20 11:50 En couverture : Pompe à eau, clos du Grand-Sart n° 6 à Mortroux Chapelle Henrard, voie des Fosses n° 19 à Feneur Girouette, rue de Visé n° 46 à Dalhem 89148_01_Preface.indd 2 23/11/20 09:13 Préface Suite à l’appel à projet lancé en janvier 2019 par l’Agence Wallonne du Patrimoine (AWaP) pour l’établissement d’un recensement du Petit Patrimoine Populaire Wallon, l’Administra- tion communale de Dalhem a envoyé un dossier de candidature qui a retenu l’attention du jury de sélection. -

Eupen Purification Plant Supplying High-Quality Water
Electricity produced by the force .com of the Vesdre River! debie www. The plant at the Vesdre Complex includes a hydro-electric power station. This power station enables Société wallone des eaux to produce green electricity. As part of project VEGI, the Eupen plant has been equipped with four new turbines. Altogether the turbines produce 5 million kWh (kilowatt hours) per year, equivalent to the annual consumption of 1,500 households. This electricity is mainly used by SWDE for supplying its own facilities, thus making large energy savings by using electricity that is completely non- polluting, since it produces no CO2 emissions. This also ensures that the purification plant’s pumps are continually supplied with electricity. Why add a nanofiltration stage to the water purification process? Société wallone des eaux is committed to › formation of a biofilm, a natural occurrence molecules that result from the injection of Eupen purification plant supplying high-quality water. This is why it in water networks. This biofilm might lime and carbonic acid that is used to make was essential to improve the operation of come loose unexpectedly according to fenland water non-corrosive to metal water (La Vesdre Complex) the Vesdre treatment plant in Eupen and the variations in flow or the level of organic pipes. the Gileppe plant in Stembert, in order to matter in the water. The consequence of this effectively remove naturally occurring and is cloudy and discoloured water, but it is not It is also necessary, therefore, to inject sodium humic organic matter (components that harmful to health. hypochlorite after the nanofiltration stage and are naturally present in the region’s soil and to replace the injection of lime and carbonic Modernised facilities to meet the new European regulations water). -

Limburg Ancien Regime
APPEL À COMMUNICATIONS COLLOQUE INTERNATIONAL D’HISTOIRE SUR LE DUCHÉ DE LIMBOURG ET LES PAYS D’OUTRE-MEUSE (DALHEM, VALKENBURG, ‘s-HERTOGENRADE) – PROVINCE DE LIMBOURG D’ANCIEN RÉGIME Sous l’Ancien Régime, la province de Limbourg constitue une des dix-sept provinces des Pays-Bas espagnols, puis autrichiens. C’est en réalité un ensemble de caractère fédéral qui rassemble quatre composantes bien distinctes : le duché de Limbourg, le pays de Dalhem, le pays de Valkenburg (Fauquemont) et le pays de ‘s-Hertogenrade (Rolduc). Ces territoires étaient apparus au moyen âge sous forme de principautés territoriales autonomes et leur rassemblement, aux XIIIe-XIVe siècles, sous un même sceptre (d’abord ducs de Brabant, puis ducs de Bourgogne, Habsbourg d’Espagne ensuite, d’Autriche enfin) entraîna leur rapprochement, mais non leur fusion (du moins jusqu’en 1778), en une seule entité politique et administrative. Autres caractéristiques importantes de ces pays : leur position frontalière aux confins des Pays-Bas méridionaux et au-delà de la Meuse, d’où l’expression « pays d’Outre-Meuse », en même temps que leur situation d’enclave des Pays-Bas au sein d’États étrangers (la principauté épiscopale de Liège, les Provinces-Unies, l’Empire, la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy, etc.). Par ailleurs, ces pays s’inscrivent dans la région naturelle d’Entre-Meuse-et-Rhin, caractérisée ici par la présence, à leurs bordures, de villes importantes comme Maastricht, Aix-la-Chapelle, Verviers et Liège. Un particularisme bien marqué, au plan tant politique et socio-économique que culturel, s’en dégagera. Au printemps 2016, sortiront des presses des Archives générales du Royaume et Archives de l’État dans les provinces, plusieurs inventaires importants réalisés par Bruno DUMONT et Sébastien DUBOIS et portant sur les archives des institutions limbourgeoises d’Ancien Régime. -

Les Fiefs Du Comté De Dalhem
Amedée de Ryckel (1859-1922) was een jurist en historicus uit Luik. Hij is de auteur van diverse publicaties over de geschiedenis van het Prinsbisdom Luik en van de Brabantse Landen van Overmaas. Eén daarvan is Les fiefs du comté de Dalhem, gepubliceerd in 1908 (Liége, D. Cormaux, imprimeur-libraire, Successeur de L. Grandmont- Donders, 22 rue Vinave-d’Ile). Het origineel waarvan ik vertrok bevindt (of bevond?) zich in de bibliotheek van het Seminarie van Luik. Willy Machiels maakte er destijds een fotokopie van. Die heb ik gescand en via een OCR- programma omgezet naar dit bestand. Het origineel telde 117 pagina’s. Ik heb in dit bestand de nummering [einde pagina] in rood aangegeven: [5]. Rik Palmans, januari 2020 1 LES FIEFS DU COMTÉ DE DALHEM Le comté de Dalhem, dont la petite ville de ce nom occupait à peu près le centre, était situé au Nord-Est de la province de Liége actuelle. Il eut d’abord des souverains particuliers, mais dès Ie milieu du XIIle siècle, il avait définitivement passé sous la domination des ducs de Brabant (1243) et suivit désormais les destinées des états de ceux-ci. Au XVIIe siècle, à la suite de la longue guerre entre l'Espagne et les Provinces-Unies, le comté fut partagé en deux parties. Le traité, qui consacra cette division, porte la date du 26 décembre 1661. Voici quelles en furent les conséquences : Les Etats généraux obtinrent les villages de Bombaye, Cadier, Feneur, Oest, Olne, Saint-André, Trembleur et la ville de Dalhem. L’Espagne conserva Aubel, Barchon, Cheratte, Fouron-Ie-Comte, Fouron-Saint- Martin, Housse, Mheer, Mouland, Mortier, Neufcháteau, Noorbeek, Richelle, Saint- Remy à peu près en entier et Warsage. -
La Date De Référence Du Census Est Le 01/01/2011. Filtres
Indicateurs géographiques (basés sur le CENSUS 2011) La date de référence du census est le 01/01/2011. Filtres: Logements construits à partir de 2001 Belgique Région Province Arrondissement Commune Province de Brabant flamand Arrondissement de Hal-Vilvorde Opwijk 19.18% Région flamande Province d’Anvers Arrondissement de Turnhout Baerle-Duc 18.99% Région wallonne Province de Luxembourg Arrondissement de Neufchâteau Léglise 18.56% Province de Flandre orientale Arrondissement de Gand Lochristi 18.50% Région flamande Province de Limbourg Arrondissement de Maaseik Overpelt 18.34% Région wallonne Province de Luxembourg Arrondissement de Bastogne Vaux-sur-Sûre 18.29% Hoogstraten 18.10% Province d’Anvers Arrondissement de Turnhout Région flamande Hulshout 18.06% Province de Flandre occidentale Arrondissement d’Ostende Bredene 17.97% Région wallonne Province de Luxembourg Arrondissement d’Arlon Attert 17.87% Province de Flandre occidentale Arrondissement de Furnes Nieuport 17.60% Province de Limbourg Arrondissement de Hasselt Tessenderlo 17.52% Province d’Anvers Arrondissement de Turnhout Geel 16.86% Région flamande Province de Flandre occidentale Arrondissement de Courtrai Espierres-Helchin 16.59% Province d’Anvers Arrondissement de Turnhout Retie 16.38% Province de Flandre occidentale Arrondissement de Furnes Koksijde 16.36% Province d’Anvers Arrondissement d’Anvers Brecht 16.32% Région wallonne Province de Liège Arrondissement de Waremme Geer 15.98% Province de Flandre occidentale Arrondissement d’Ostende De Haan 15.73% Région flamande Province -
Chambre Des Représentants Kamer Van Volksvertegenwoordigers
~:I& (19S.~ - 19H4) - N' 1 ~3£'i (191B - 1984) - N' t Chambre Kamer des Représentants van Volksvertegenwoordigers SESSION 198.1-1984 ZITTING 1983-1984 Ii IANVIER 1984 17 JANUARI 1984 PROPOSITION DE LOI WETSVOORSTEL modifiant les limites des provinces de Limbourg, tot wijziging van de grenzen van de provinciën de Liège et de Brabant, Limburg, Luik en Brabant, ainsi que de certaines communes en tot wijziging van sommige gemeentegrenzen (Déposée par M. Dillen) (Ingediend door de heer Dillen) DEVELOPPEMENTS TOELICHTING MESDAMES, MESSIEURS, DAMES EN HEREN, La loi du 8 novembre 1962 modifiant les limites de De wet van 8 november 1962 tot wijziging van provin- provinces, arrondissements et communes et modifiant la loi cie-, arrondissements- en gemeentegrenzen en tot wijziging du 28 juin 1932 sur l'emploi des langues en matière ad- van de wet van 26 juni 1932 op het gebruik van de ralen ministrative et la loi du 14 juillet 1932 concernant le ré- in besruurszaken en van de wet van 14 juli 1932, houdende gime linguistique de l'enseignement primaire et de l'ensei- de taalregeling in her lager en in het middelbaar onderwijs, gnement moyen est, en grande partie, la traduction légale kwam in belangrijke mate tot stand op grond van de resul- des résultats des études et discussions auxquelles le Centre taten van de studiën en besprekingen van het Harmelcen- Harmel s'est consacré. Ce Centre s'est fondé notamment trum. Dit Harmelcentrum steunde onder meer op de resul- sur les résultats du recensement linguistique de 1947, effec- taten van de talentelling van 1947, die in volle repressie- tué en pleine période de répression. -

Ecoles Pratiquant L'immersion (Clil-Emile) En Province De Liege 2017-2018
ECOLES PRATIQUANT L’IMMERSION (CLIL-EMILE) EN PROVINCE DE LIEGE 2017-2018 MATERNELLES ET PRIMAIRES Anglais Maternelle De la 3 ième LIEGE Ecole Fondamentale Boulevard d’Avroy, 96 21p maternelle à la Communale Lycée 4000 LIEGE Primaire 6ième primaire Léonie de Waha. Direction: M. Olivier SALMON P1-P2: 21p Tél: 04/222 01 37 P3: 18p Fax: 04/223 36 17 P4-P5-P6: 12p E-mail: [email protected] Site internet: www.multimania.com/lyceewaha/ Anglais Maternelle Accueil – P6 LIEGE Ecole fondamentale Place des Combattants, 1 21p Immersion: communale Jupille- 4020 LIEGE (Jupille) Primaire De la 3 ième Combattants Direction: M. Quentin CHANTRAINE P1-P2: 21p maternelle à la Tél: 04/362 64 73 P3: 18p 6ième primaire Fax: 04/370 27 65 P4-P5-P6: 12p E-mail: [email protected] Site internet: Tél : 04-237.23.50 Fax : 04-237.23.59 [email protected] www.maisondeslangues.be Liste2017-2018-ADR-ECOLES fond.IMMERSION DANS LA PROVINCE DE LIEGE 23/11/2017 Page 1 sur 13 Anglais Maternelle Accueil – P6 NEUPRE Ecole fondamentale Rue Duchêne, 4 13p Immersion: communale - 4120 NEUPRE Primaires 21p- de la 3 ième Implantation de Direction: Mme Catherine RINGLET 12p maternelle à la Rotheux -Plainevaux Tél: 04/371 53 79 6ième primaire Fax: 04/246 96 50 E-mail: [email protected] Anglais Maternelle Accueil – P6 ESNEUX Ecole fondamentale Chera de la Gombe, 32 13h Immersion : communale 4130 ESNEUX Primaires De la 3 ième d’Esneux - Direction : Mme Fabienne CORNIA P1-P2 :14h maternelle à la Implantation : Tél: 04/380 34 93 -04/380 34 28 P3-P4 :12h 6ième primaire Montfort GSM : 0496/52 72 82 P5-P6 :10h E-mail : [email protected] Anglais Maternelle Accueil – P6 LIMBOURG Ecole fondamentale Rue Guillaume Maisier, 56 21p Immersion : Duc de Marlborough 4830 Limbourg Primaires De la 3 ièlme Limbourg Direction : M.