Amerika, Du Hast Es Besser!
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Congressional Record United States Th of America PROCEEDINGS and DEBATES of the 104 CONGRESS, FIRST SESSION
E PL UR UM IB N U U S Congressional Record United States th of America PROCEEDINGS AND DEBATES OF THE 104 CONGRESS, FIRST SESSION Vol. 141 WASHINGTON, FRIDAY, APRIL 7, 1995 No. 65 House of Representatives The House met at 11 a.m. and was PLEDGE OF ALLEGIANCE DESIGNATING THE HONORABLE called to order by the Speaker pro tem- The SPEAKER pro tempore. Will the FRANK WOLF AS SPEAKER PRO pore [Mr. BURTON of Indiana]. TEMPORE TO SIGN ENROLLED gentleman from New York [Mr. SOLO- BILLS AND JOINT RESOLUTIONS f MON] come forward and lead the House in the Pledge of Allegiance. THROUGH MAY 1, 1995 DESIGNATION OF SPEAKER PRO Mr. SOLOMON led the Pledge of Alle- The SPEAKER pro tempore laid be- TEMPORE giance as follows: fore the House the following commu- The SPEAKER pro tempore laid be- I pledge allegiance to the Flag of the nication from the Speaker of the House fore the House the following commu- United States of America, and to the Repub- of Representatives: nication from the Speaker. lic for which it stands, one nation under God, WASHINGTON, DC, indivisible, with liberty and justice for all. April 7, 1995. WASHINGTON, DC, I hereby designate the Honorable FRANK R. April 7, 1995. f WOLF to act as Speaker pro tempore to sign I hereby designate the Honorable DAN BUR- enrolled bills and joint resolutions through TON to act as Speaker pro tempore on this MESSAGE FROM THE SENATE May 1, 1995. day. NEWT GINGRICH, NEWT GINGRICH, A message from the Senate by Mr. Speaker of the House of Representatives. -

Sowjetische Verstellungen in London Und Washington Stalin Fordert Einen Sofortigen Angriff Der Westmächte
Einzelpreis 10 Rpl., Sonnlag 15 Rpl. DIE GROSSE HEIMATZEITUNG III OSTEN DES REICHSGAUES WARTHE LAND MIT DEN AMTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN Monatlich 2,50 RM. (einschließlich 40 Rpt. Trlgerlohn), bei Postbezug 2,92 RM. elnschlleBllch 42 Rpl. Postgebühr und Nachlieferung ton Einzelnummern nur nach Vorelntendung des Betrages elnschlleBllch Porto tür Streilband. Verlag 21 Rpl. Zeitungsgebflhr bzw. die entsprechenden Beiorderungskosten hei Postzeitungsgut oder BahnhotztltungsTersand Lltzmannstadt, Adoll-Hltler-StraBe 8«. Fernruf 254-20. Schrlltleltung: Ulrlch-von-Hutten-Str. 35, Fernrul 195-80/81. 26. Jahrgang / Nr. 86 Sonnahend, 27. März 1943 Sowjetische Verstellungen in London und Washington Stalin fordert einen sofortigen Angriff der Westmächte Sch. Lissabon, 27. März (LZ.-Drahtbericht) zeltig verstärkte diplomatische Vorstellungen Viel besprochen wird in London die ge• Moskaus in London und Washington erfolgt strige Frühstücksrede des sowjetischen Bot• sind, um die Eröffnung eines Angriffes der schafters Maisky. Maisky wandte sich >n sei• Westmächte zu erzwingen. Stalin sieht be• ner Rede auf das heftigste gegen die „Ver• kanntlich aut dem Standpunkt, daß die Offen• nachlässigung" der Sowjetunion und erklärte sive in Nordafrika keine Erfüllung seiner Wün• u. a.: „Mein Land und mein Volk erwarten, sche ist. daß alle unsere Verbündeten, besonders aber Der amerikanische Vizepresident Wallace, Sturmgeschütze laden nette Munition England und die Vereinigten Staaten, nun• Nach erfolgreichem Einsatz an der Mlusfront Übernehmen Sturmgeschütze von einem I.KW. neue mehr ihr Möglichstes, und zwar In unmittel• der sich auf einer Reise durch Südamerika Munition. Jede freie Ecke In dem Panzerlelb wird mit den bei aen Sowjets gefürchtet,?» Spreng- barer Zukunft tun, um eine Verkürzung die• befindet, gedenkt nach einer allerdings noch granaten vollgepackt. -

Dragon Magazine
DRAGON 1 Publisher: Mike Cook Editor-in-Chief: Kim Mohan Shorter and stronger Editorial staff: Marilyn Favaro Roger Raupp If this isnt one of the first places you Patrick L. Price turn to when a new issue comes out, you Mary Kirchoff may have already noticed that TSR, Inc. Roger Moore Vol. VIII, No. 2 August 1983 Business manager: Mary Parkinson has a new name shorter and more Office staff: Sharon Walton accurate, since TSR is more than a SPECIAL ATTRACTION Mary Cossman hobby-gaming company. The name Layout designer: Kristine L. Bartyzel change is the most immediately visible The DRAGON® magazine index . 45 Contributing editor: Ed Greenwood effect of several changes the company has Covering more than seven years National advertising representative: undergone lately. in the space of six pages Robert Dewey To the limit of this space, heres some 1409 Pebblecreek Glenview IL 60025 information about the changes, mostly Phone (312)998-6237 expressed in terms of how I think they OTHER FEATURES will affect the audience we reach. For a This issues contributing artists: specific answer to that, see the notice Clyde Caldwell Phil Foglio across the bottom of page 4: Ares maga- The ecology of the beholder . 6 Roger Raupp Mary Hanson- Jeff Easley Roberts zine and DRAGON® magazine are going The Nine Hells, Part II . 22 Dave Trampier Edward B. Wagner to stay out of each others turf from now From Malbolge through Nessus Larry Elmore on, giving the readers of each magazine more of what they read it for. Saved by the cavalry! . 56 DRAGON Magazine (ISSN 0279-6848) is pub- I mention that change here as an lished monthly for a subscription price of $24 per example of what has happened, some- Army in BOOT HILL® game terms year by Dragon Publishing, a division of TSR, Inc. -

Growing a Modern VICTORY GARDEN Everyone Is Looking for Ways They Can Help During the Current COVID-19 Outbreak
Cornell Cooperative Extension April 2020 of Jefferson County Growing a Modern VICTORY GARDEN Everyone is looking for ways they can help during the current COVID-19 outbreak. Planting a garden can be one way for your family to get healthy, fresh vegetables, save money, potentially help others through food donations, get exercise, and relieve stress. Consider these historic facts on Victory Gardens: • World War I: In 1917 home gardeners mobilized and the first Victory Gardens were planted. In 1918, more than 5.2 million gardens were INSIDE THIS GUIDE cultivated. Page 2. No Room for a Garden? Never Fear, Container Gardens are • World War II: In 1944, an estimated 20 million Victory Gardens Here! produced 8 million tons of food. This was 40% of all the fruits and Page 4. Traditional Vegetable Gardens, i.e. Gardening in the vegetables consumed in the U.S. Earth The current COVID-19 situation Page 5. Cool and Warm Season has sparked renewed interest in Vegetables- AKA, When Can I plant? food gardening. Many people are considering vegetable Page 8. Vegetable Transplants gardens as a way to increase Page 9. Everybody Loves Tomatoes! personal food security. This Page 11. Backyard Fruit Production- spring will see first time Some Things to Consider gardens, expansion of current Page 13. Fruits and Nuts You Can Grow in Northern New York gardens, and the re-start of long Page 14. Water, Weeds and Woes dormant food gardens. Page 15. Resources For those current and past Attachment: Cornell Recommended gardeners I don’t expect this information will tell you more than you Vegetable Varieties for New already know, although you may pick up some new tips. -
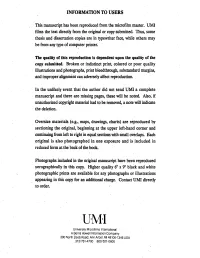
Information to Users
INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the qualify of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form atthe back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6" x 9" black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. University Microfilms International A Bell & Howell Information Company 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA .313/761-4700 800/521-0600 Order Number 00-12,166 The use of leisure and its relation to social stratification Clarke, Alfred Carpenter, Ph.D. Ohio State University, 1955 UMI 300 N. -

Selected List of Vegetable Varieties for Gardeners in New York State
Selected List of Vegetable Varieties for Gardeners in New York State 2021 (Revised 11/20) Vegetable varieties listed in this report should be well adapted for New York State community, school and home gardens. It is recognized that varieties not listed here may be satisfactory or even perform better under certain conditions. We encourage gardens to rate the varieties at: vegvariety.cce.cornell.edu Visit our Vegetable Varieties for Gardeners in New York State website for detailed descriptions and some seed sources of more than 7,000 vegetable varieties including those listed in this report. Compare varieties, read ratings and reviews by fellow gardeners, and offer your own observations of which varieties perform best in your garden. Note: Future reports will be largely based on variety ratings from this site. vegvariety.cce.cornell.edu Cornell Garden-Based Learning Horticulture School of Integrative Plant Sciences Cornell University Ithaca, NY 14853-0327 www.gardening.cornell.edu Selected List of Vegetable Varieties for Gardeners in NYS – A. Helmholdt – page 2 of 8 Key to Notation At least 4 NY gardeners’ ratings averaging # New varieties to this year’s list * >3.5 stars at: vegvariety.cce.cornell.edu Downy mildew resistant or A Alternaria stem resistant DM tolerant Tolerance to Bean Common Mosaic Powdery mildew resistant or BCMV PM Virus BV1 & NY15 tolerant Bacterial leaf spot resistant strains 1, 2, BLS R Rust resistant and 3 are noted CTV Tolerance to citrus tristeza virus SE Sugar enhanced F Fusarium resistant SH2 Supersweet LBR Late -

SW Monthly Onlinecover
Werk Thoroughbred Consultants, Inc. presents WTC’s STAKES & MAIDEN WINNERS MONTHLY October, 2009 Featuring a monthly recap of the winners of unrestricted stakes races in North America and Europe, which includes our WTC “Best of Sale” selections and Mating Recommendations. Also included is a list of all maiden winners for the month sorted by sire. Published by Werk Thoroughbred Consultants, Inc. PO Box 1926, Fremont, CA 94538-0192 (510) 490-1111 / (510) 490-4499 (fax) www.werkhorse.com email: [email protected] Copyright 2009 WERK THOROUGHBRED CONSULTANTS MATINGS and BEST OF SALE STAKES WINNERS (Domestic Stakes $25,000 and up · October 1 through October 31, 2009) NORTH AMERICAN GRADED STAKES RESULTS Grade 1 Races SHADWELL TURF MILE S. ( GI ), KEE, $600,000, 3YO/UP, 1MT, 10-10. — COURT VISION, c, 4, Gulch--Weekend Storm, by Storm Bird. WTC “BEST OF SALE” – KEESEP06 - $180,000 – 2.0 STARS – A NICK ($350,000 2yo 2007 FTFFEB.). O-IEAH Stables and Resolute Group Stables, B-W. S. Farish &Kilroy Thoroughbred Partnership (KY), $360,000. — Karelian, g, 7, Bertrando--Leaning Tower, by Theatrical (IRE). WTC “BEST OF SALE” – KEESEP03 – ($47,000)RNA – 1.5 STARS – C+ NICK O-Green Lantern Stables LLC, B-Green Lantern Stables (KY), $120,000. — Mr. Sidney, h, 5, Storm Cat--Tomisue's Delight, by A.P. Indy. WTC “BEST OF SALE” – KEESEP05 - $3,900,000 – 3.5 STARS – A NICK O-Circle E Racing, B-Hilbert Thoroughbreds (KY), $60,000. JOE HIRSCH TURF CLASSIC INVITATIONAL S. ( GI ), BEL, $600,000, 3YO/UP, 1 1/2MT, 10-3. —INTERPATATION, g, 7, Langfuhr--Idealistic Cause, by Habitony. -

THE CORE SVIN Newsletter December 2014
THE CORE SVIN Newsletter December 2014 In This Issue President’s Message p. 2-4 Editor’s Corner p. 5 The Westin Diplomat Hotel, Hollywood, FL SVIN 2014 Meeting Highlights p. 6-8 Interventional Stroke Trials p. 9-11 The Evolving Technology of Flow Diversion p. 12-15 Pipeline and Antiplatelets p. 16-18 Field Administration of Stroke Therapy-Magnesium Phase III Results p. 18-19 ‘Basilar Artery’ SVIN FUNDRAISER SVIN Cilostazal Editorial 30% of proceeds go to SVIN p. 19-21 Journal Core Review of ARUBA Leah Guzman presented her beautiful Brain Series paintings at the 2014 p. 21-22 SVIN Annual Meeting and donated 30% of her proceeds to SVIN. She has offered this promotion again for any purchases generated from the December 2014 Newsletter. To view her artwork and make your purchase, please visit her website: www.leahguzman.com Leah Guzman, ATR-BC President’s Message At the crossroads of history: SVIN meeting witnesses news that will forever change acute stroke treatment paradigms It is a momentous time for patients with acute is- chemic stroke, their families and medical profes- sionals who treat them. Tudor Jovin, MD SVIN members, its supporters and friends had the privilege to live together moments of historical SVIN President importance at the SVIN’s 8-th annual meeting in Hollywood, Florida, which has just concluded on November 10-th 2014. During the two and a half entirely with stentrievers. The study, by now pub- days event superbly organized by Robin Nova- lished in the New England Journal of Medicine kovic MD, meeting chair, together with the rest of demonstrated a shift in the distribution of the pri- the meeting’s organizing committee, events have mary-outcome scores in favor of the intervention. -

RAMMSTEIN 2012 Natourannouncement 11.14.2011
RAMMSTEIN CONFIRMS NORTH AMERICAN TOUR 2012 THE WORLD’S MOST EXPLOSIVE ROCK BAND RETURN TO NORTH AMERICA FOR 21 DATES IN SUPPORT OF THEIR RETROSPECTIVE ALBUM RELEASE “MADE IN GERMANY 1995-2011” LOS ANGELES, CA (November 14, 2011) - RAMMSTEIN , the Berlin-based band known for their incendiary live performances, will bring their brand new live production to North America this spring for 21 dates kicking off April 20 th in Ft. Lauderdale. Tickets for the tour, promoted by Live Nation, will go on sale beginning Friday, November 18 th and will be available at Ticketmaster.com, and LiveNation.com. Demand for Rammstein's pyrotechnic-laden performances has been so great in Europe, where they regularly play capacity level soccer stadiums, the band spent nearly a full decade without setting foot on North American shores. In December 2010, the sextet returned to North America for two sold out shows including a performance at Madison Square Garden. Rammstein followed with a 9-day trek of major North American cities in spring 2011. The Los Angeles Times described the live experience as “...epic stagecraft on a Wagnerian scale, several notches up from most arena rock.” The tour announcement comes on the heels of news of the band's first retrospective release, Made In Germany 1995 - 2011 , which will be available in North America (through a distribution deal between Universal Germany and Vagrant Records) on December 13. Rammstein recently released " Mein Land ," a new four-track digital single that features two new songs: the title track and "Vergiss uns Nicht " as well as remixes from BossHoss and Mogwai. -

Medien – Zeit – Zeichen. Dokumentation Des 19. Film- Und Fernsehwissenschaftlichen Kolloquiums 2006 2007
Repositorium für die Medienwissenschaft Christian Hißnauer, Andreas Jahn-Sudmann u.a. (Hg.) Medien – Zeit – Zeichen. Dokumentation des 19. Film- und Fernsehwissenschaftlichen Kolloquiums 2006 2007 https://doi.org/10.25969/mediarep/14360 Veröffentlichungsversion / published version Buch / book Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Hißnauer, Christian; Jahn-Sudmann, Andreas (Hg.): Medien – Zeit – Zeichen. Dokumentation des 19. Film- und Fernsehwissenschaftlichen Kolloquiums 2006. Marburg: Schüren 2007 (Film- und Fernsehwissenschaftliches Kolloquium 19). DOI: https://doi.org/10.25969/mediarep/14360. Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under a Deposit License (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, non-transferable, individual, and limited right for using this persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses document. This document is solely intended for your personal, Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für non-commercial use. All copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle protection. You are not allowed to alter this document in any Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument document in public, to perform, distribute, or otherwise use the nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie document in public. dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke By using this particular document, you accept the conditions of vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder use stated above. -

Rammstein. 100 Seiten * Reclam 100 Seiten *
Wicke | Rammstein. 100 Seiten * Reclam 100 Seiten * Peter Wicke, geb. 1951, bis 2016 Inhaber des Lehr- stuhls für Theorie und Geschichte der Populären Musik an der Humboldt-Universität in Berlin; Mitglied der International Association for the Study of Popular Music und des Deutschen Musikrates. Peter Wicke Rammstein. 100 Seiten Reclam Für Tatjana 2019 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen Umschlaggestaltung: zero-media.net Umschlagabbildung: FinePic® Infografik (S. 52/53): Infographics Group GmbH Bildnachweis: Autorenfoto: © Peter Wicke; letzte Seite © Alexander Kiensch Druck und Bindung: Kösel GmbH & Co. KG, Am Buchweg 1, 87452 Altusried-Krugzell Printed in Germany 2019 reclam ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart iSBN 978-3-15-020536-5 Auch als E-Book erhältlich www.reclam.de Für mehr Informationen zur 100-Seiten-Reihe: www.reclam.de/100Seiten Inhalt 1 Intro 7 »Rammstein« – Das Debüt 14 »Engel« – Die Band 26 »Feuer Frei!« – Provokation als Gesamtkunstwerk 39 »Links 2 3 4« – Im Stechschritt gegen Rechts 49 »Amerika« – Auf dem Gipfel des Ruhms 61 »Mehr« – Der Rammstein-Sound 74 »Mein Herz brennt« – Romantik auf die harte Tour 83 »Mein Land« – Suche nach der verlorenen Identität 95 Outro Im Anhang Rammstein zum Hören Rammstein zum Sehen Rammstein zum Lesen V VI Intro Wenn ihr ohne Sünde lebt Einander brav das Händchen gebt Wenn ihr nicht zur Sonne schielt Wird für euch ein Lied gespielt Rammstein, »Ein Lied« Es ist der 23. Juli 2005. Über die Arènes des Nîmes, ein Amphi- theater nach dem Vorbild des römischen Kolosseums aus der zweiten Hälfte des 1. -

5049841-5C1e38-635212060629.Pdf
THE DIVINE MUSE ARTIST’S NOTE One of the challenges of being in a recital Haydn, Schubert and Wolf (who all came from 1 Vedi, quanto adoro, D.510 Franz Schubert (1797-1828) [4.29] duo is finding new and interesting ways to the same lineage of Austrian composers) each 2 Son fra l’onde, D.78 Franz Schubert [1.48] present programmes to our audiences. When took the Lied art form into new harmonic and 3 Die Götter Griechenlands, D.677 Franz Schubert [4.06] researching, one is often flooded with songs expressive realms during their lifetimes and, 4 Ganymed, Goethe Lieder No. 50 Hugo Wolf (1860-1903) [5.26] about love or springtime, loss or longing and above all, what they shared was a love of poetry 5 Zum neuen Jahr, Mörike Lieder No. 27 Hugo Wolf [1.51] it can be difficult to find originality of theme and text. All three composers clearly found 6 Seufzer, Mörike Lieder No. 22 Hugo Wolf [2.34] (not that it is always necessary to have a inspiration when setting these texts to music, 7 Gebet, Mörike Lieder No. 28 Hugo Wolf [2.38] theme of course). So the idea for this album creating with them some of Lied’s greatest 8 Gesang Weylas, Mörike Lieder No. 46 Hugo Wolf [1.43] came when Joseph Middleton wanted to create works. We very much hope you enjoy this 9 Ganymed, D.544 Franz Schubert [4.06] a programme that reflected my interest album and the stories within. Arianna a Naxos, Hob XXVIb:2 Joseph Haydn (1732-1809) in mythology and the history of religion (I 0 No 1, Recitative: Teseo mio ben! [4.54] read Anglo-Saxon, Norse and Celtic Studies Mary Bevan, 2019 q No 2, Aria: Dove sei, mio bel tesoro? [4.16] at Cambridge).