Beiträge Zur Geschichte Des Lötschentals
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
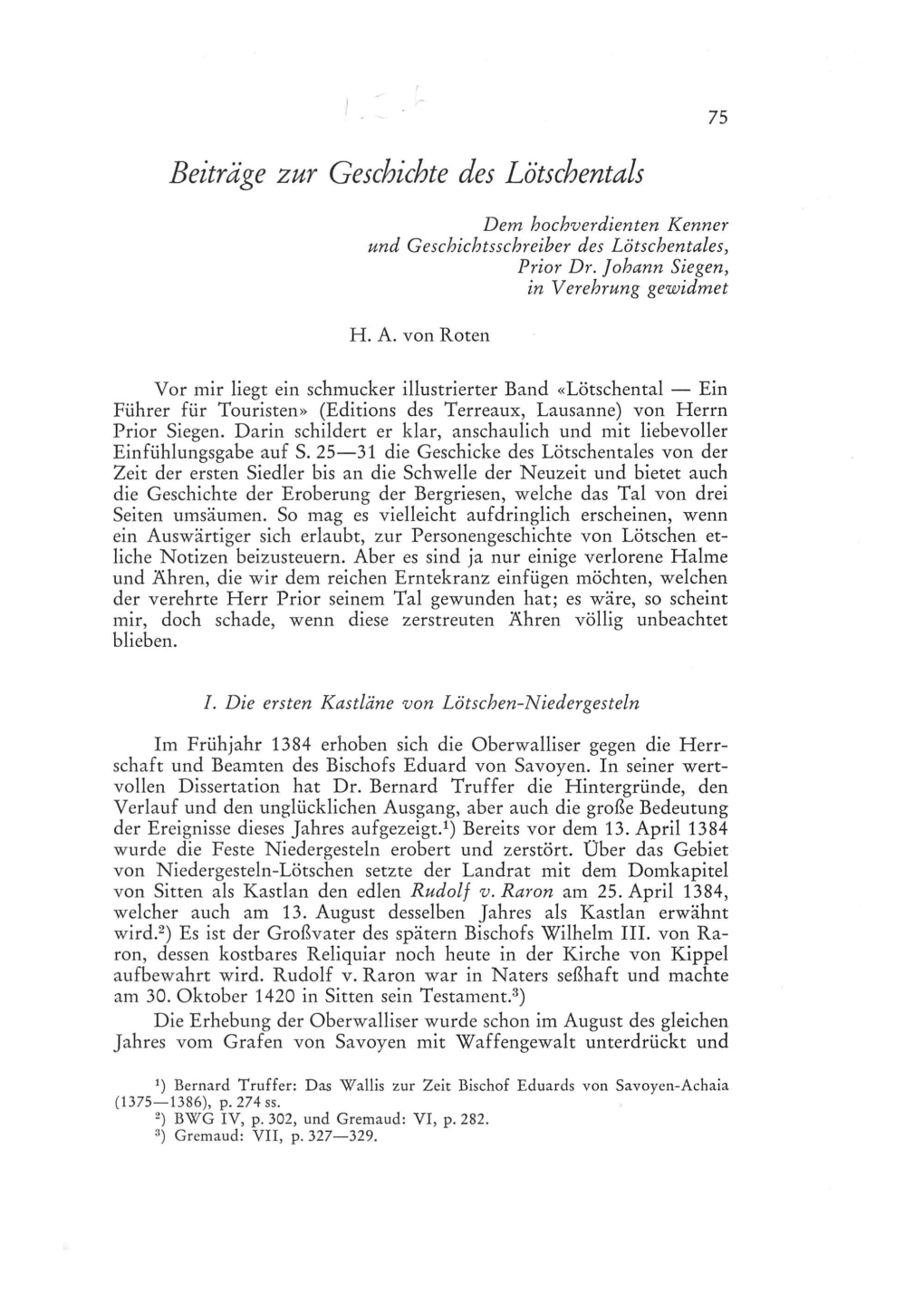
Load more
Recommended publications
-

Die Familie Von Turn Von Sitten Und Niedergesteln Geschichte Dokumentation Forschungsideen Dossier Zu Handen Der Stiftung Pro Ca
Die Familie von Turn von Sitten und Niedergesteln Geschichte Dokumentation Forschungsideen Dossier zu Handen der Stiftung Pro Castellione eingereicht im November 2010 leicht verändert und ergänzt im März 2011 von lic. phil. Philipp Kalbermatter Philipp Kalbermatter, Kantonsstrasse 14, 3946 Turtmann Inhaltsverzeichnis Vorwort 1. Die Familie von Turn 1.1 Geschichte der Familie 1.2 Hauptvertreter der Linie von Turn-Gestelnburg 1.3 Besitzungen und Rechte 2. Dokumentation 2.1 Archivbestände 2.2 Quellensammlungen 2.3 Literatur 3. Forschungsthemen 3.1 Geschichte der Familie von Turn 3.2 Die von Turn und die Zurlauben 3.3 Die von Turn und die Abtei Saint-Maurice 3.4 Die von Turn und Niedergesteln 3.5 Die von Turn und das Berner Oberland 3.6 Biographie von Peter V. von Turn 3.7 Biographie von Anton I. von Turn Vorwort Die Stiftung Pro Castellione, die ursprünglich zum Zweck der Rettung der Burgruine von Niedergesteln gegründet wurde, ist heute eine kulturell ausgerichtete Institution. Sie befasst sich seit einiger Zeit mit dem Gedanken, die geschichtliche Erforschung der Familie von Turn und ihres Machtzentrums in Niedergesteln neu zu beleben. Das soll durch die Herstellung von Kontakten zu interessierten Kreisen (Forscher, Institute usw.) oder auch durch finanzielle Unterstützung (für Archivstudien, Publikationen usw.) erfolgen. Diese Forschungen können auf Hochschulebene durchgeführt werden, sei es in Form von Seminar-, Lizentiats- oder Doktoratsarbeiten bzw. im heutigen Kontext in Form von Bachelor- oder Masterarbeiten. Die wissenschaftliche Begleitung würde dabei den historischen Instituten und deren Leitung obliegen. Zwar hat die Darstellung der Geschichte der Familie von Turn recht früh durch Louis de Charrière (1867) einen erfolgreichen Anfang genommen, doch ist später nur noch Victor van Berchems Studie über Johann I. -

Gemeinde Und Priorat Niedergestein
Gemeinde und Priorat Niedergestein Von Dr. Johann Siegen, Prior ST ^^fiHW M4JJ i -m. ..»'-' >. T^"» •-. ALT'-v . ^ f».^. ffr - *jà — r p > - k WPI.k.v'W •.•-** . .• k. ^*r> . 4*v "J^ ' %' W^M^ £ • — V ' • •s '^P^T"* ifefc, > • ,, 1 ,j '**»- t#v? ^ i - " ' « j s- *• - Ï *v -*^Cfc? i j^v ik;2 -vit;, ^ ; (Swiss Air Photo) Flugaufnahme lies Dorfes Niedergesteln (Wallis) Inhaltsverzeichnis Vorwort 445 Die Gemeinde Niedergestein 1. Die Ortschaft 447 2. Die Bürgschaft 448 3. Das Schloß 448 4. Die Schlacht hei Niedergesteln 451 5. Die Freiherren von Turii-Gestelnhnrg 452 6. Die Kastlanei Niedergestein 457 7. Als seihständiges Gemeindewesen 460 Das Priorat Niedergestein 1. Die Gründung 465 2. Die Tochterpfarreien 466 3. Die Kirche 467 4. Kunstwerke 471 5. Kapellen und Bethänschen 473 6. Prioratspfriinde und Pfarrhaus 474 7. Die Herrschaft Giesch 477 8. Altaristenpfründen, Bruderschaften und Spenden . 477 9. Die Prioren 480 10. Die Pfarrbücher 482 11. Pfarrarchiv 484 12. Visitationen 485 Ausblick 489 445 Vorwort Niedergestein verdankt seine Bedeutung im Hochmittelalter einem der mächtigsten Adelsgeschlechter des Wallis. Auf dem ins Rottental vorspringenden Felsrücken am Ufer des Ijollihaches hatten die Frei herren von Turn ihre nach damaligen Verhältnissen unbezwingbare Feste errichtet. Um den Burgfelsen gruppierte sich eine Ansiedlimg mit eigenem Gotteshaus. Wenn die Leute als Untertanen auch mancher Unterdrückung ausgesetzt waren, so genossen sie doch wieder Schutz in unsicheren Zeiten. Durch die Macht- und Handelspolitik der Frei herren stieg Niedergestein zu einem wichtigen Ort des Wallis mit an sehnlichem Wohlstand empor. Mit dem Sinken und Erlöschen des Adelsgeschlechtes verlor es aber auch wieder an Bedeutung und wurde mit dem Lötschental bis zum Ausgang des 18. -

1 Introduction Landscapes Are Dynamic Patterns of Natural And
96 Erdkunde Band 60/2006 700 YEARS OF SETTLEMENT AND BUILDING HISTORY IN THE LÖTSCHENTAL, SWITZERLAND With 5 figures, 3 photos and 1 supplement (II) ULF BÜNTGEN,IGNAZ BELLWALD,HANS KALBERMATTEN,MARTIN SCHMIDHALTER, DAVID C. FRANK,HENNING FREUND,WERNER BELLWALD,BURKHARD NEUWIRTH, MARCUS NÜSSER and JAN ESPER Zusammenfassung: 700 Jahre Siedlungs- und Baugeschichte im Lötschental, Schweiz Alle 2.317 gegenwärtig im Lötschental existierenden Gebäude wurden inventarisiert, zeitlich eingeordnet und kartiert. 1.432 von diesen Gebäuden konnten mit Hilfe von Inschriften, Jahrringen und/oder Archivdokumenten jahrgenau datiert werden. 885 Gebäude wurden durch Schätzungen zeitlich in Jahrhunderte eingeordnet. Diese Datierungen dienen als Grund- lage für die Erstellung einer Karte, welche erstmals die Gebäudealter eines gesamten alpinen Tales im Überblick darstellt. In der Karte, welche als Ergebnis einer interdisziplinären Untersuchung unter Einbeziehung lokaler Wissenssysteme und Bezeichnungen verstanden werden muss, werden sowohl Wohn- als auch Wirtschaftsgebäude integriert. Zusätzlich wurden 116 lokale Flurnamen aufgenommen und die Gebäudealter zurück bis AD 1299 in einem Histogramm dargestellt. Die Zusammenarbeit von Historikern, Volkskundlern und Geographen sowie die aus den jahrgenauen Datierungen ge- wonnenen Erkenntnisse zu geschichtlichen Bauformen und Konstruktionstechniken ermöglichten die zeitliche Einordnung von Objekten. In diesem begleitenden Text beschreiben wir die Datierungsmethoden, wesentliche Bautypen und Konstruk- tionstechniken und diskutieren alte Siedlungsmuster und ausgewählte Gebäude. Die Ergebnisse werden unter Berücksichti- gung des Kulturlandschaftswandels und der die siedlungsgeschichtlichen Entwicklungen steuernden Faktoren wie Lawinen, Dorfbränden und sozioökonomischen Prozessen diskutiert. Summary: All 2,317 current buildings within the Lötschental were registered, chronologically assigned and mapped. Annual construction dates of 1,432 of these objects based on inscriptions, tree-ring dating and/or documentary evidence were derived. -

Fact Sheet Wohnbauförderung Im Kanton Wallis
Fact Sheet Wohnbauförderung im Kanton Wallis Förderobjekt Bau, Renovation und Kauf von Erstwohnungen im Berggebiet und im ländlichen Raum (vgl. nachstehender Wirkungsperimeter). Zweitwohnungen sind von der Wohnbauhilfe ausgeschlossen. Wirkungsperimeter Wohnbauhilfe kann für die Periode 2018-2021 in den folgenden 29 Oberwalliser Gemeinden, die spezifische Problemstellungen des Berggebiets und des ländlichen Raums aufweisen, ge- währt werden: Bezirk Goms: Bellwald, Binn, Ernen, Goms, Lax, Obergoms Bezirk Östlich Raron:, Bettmeralp, Bister, Grengiols Bezirk Brig: Gondo-Zwischbergen, Simplon Bezirk Visp: Eisten, Embd, Randa, Saas-Almagell, Saas-Balen, Saas-Grund, Staldenried, Törbel, Visperterminen Bezirk Westlich Raron: Blatten, Eischoll, Ferden, Kippel Bezirk Leuk: Albinen, Oberems, Ergisch, Guttet-Feschel, Inden Aus Gemeinden, die den Status „Gemeinde mit spezifischen Problemen des Berggebietes und des ländlichen Raums“ gegenüber der letzten Vierjahresperiode verloren haben, können in den Jahren 2018 und 2019 weiterhin Gesuche zur Wohnbauhilfe gestellt werden: Bezirk Westlich Raron: Bürchen, Unterbäch Empfänger der Wohnbauhilfe Natürliche und juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts. Finanzielle Bedingungen Minimale Investitionskosten von CHF 200‘000. Gesuche, bei denen die Eigenmittel 33 Pro- zent der gesamten Investitionskosten überschreiten, werden abgelehnt. Art und Höhe der Hilfe Grundsätzlich A-fonds-perdu-Beiträge von sechs Prozent der Investitionskosten, höchstens aber CHF 25‘000 pro Gesuchsdossier, -

Wohnbauförderung Im Kanton Wallis
Fact Sheet Wohnbauförderung im Kanton Wallis Förderobjekt Bau, Renovation und Erwerb von Erstwohnungen im Berggebiet und im ländlichen Raum (vgl. nachstehender Wirkungsperimeter) Zweitwohnungen sind von der Wohnbauhilfe ausgeschlossen. Wirkungsperimeter Wohnbauhilfe kann zurzeit in den folgenden 38 Oberwalliser Gemeinden, die spezifische Problemstellungen des Berggebiets und des ländlichen Raums aufweisen, gewährt werden: • Bezirk Goms: Binn, Blitzingen, Ernen, Fieschtal, Grafschaft, Münster-Geschinen, Niederwald, Obergoms und Reckingen-Gluringen • Bezirk Östlich Raron: Betten, Bister, Grengiols, Martisberg und Riederalp • Bezirk Brig: Bigisch, Mund, Simplon Dorf und Zwischbergen • Bezirk Visp: Eisten, Emd, Saas-Almagell, Saas-Balen, Saas-Grund, Randa, Täsch, Törbel, Visperterminen und Zeneggen • Bezirk Westlich Raron: Blatten, Bürchen, Eischoll, Ferden, Kippel, Unterbäch und Wiler • Bezirk Leuk: Albinen, Oberems und Ergisch Empfänger der Wohnbauhilfe Natürliche und juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts Finanzielle Bedingungen Minimale Investitionskosten von CHF 200‘000; Gesuche, bei denen die Eigenmittel 33 Pro- zent der gesamten Investitionskosten überschreiten, werden abgelehnt. Art und Höhe der Hilfe Grundsätzlich à fonds perdu-Beiträge von sechs Prozent der Investitionskosten, höchstens aber CHF 25‘000 pro Gesuchsdossier, ausschliesslich an natürliche Personen Innerhalb von alten Dorfteilen bei Renovationen oder bei Kauf und Renovation à fonds per- du-Beiträge von zehn Prozent der Investitionskosten, höchstens aber CHF 50‘000 pro Ge- suchsdossier, ausschliesslich an natürliche Personen. Zinsgünstige oder zinslose Darlehen mit einer maximalen Laufzeit von 20 Jahren aus- schliesslich an juristische Personen. Die Darlehen betragen maximal 25 Prozent der anre- chenbaren Kosten. Vorzeitiger Baubeginn Mit den Bauarbeiten darf nicht begonnen werden, bis der Subventionsentscheid vorliegt. Ausnahmsweise kann die Kantonale Dienststelle für Wirtschaftsentwicklung DWE eine schriftliche Bewilligung zum vorzeitigen Baubeginn erteilen. -

Bernese Alps, Archaeology of the Lötschen Pass
Selden Have you found anything in or around the ice? 0 1000m – Do not recover the object or only if it is directly threatened. – Photograph the object and its wider surroundings. – Mark the location. – Write down the coordinates of the location or mark it Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement du canton du Valais on a map. Service des bâtiments, monuments – Archaeological finds belong to the canton in which et archéologie they were found. Report them to the relevant cantonal Departement für Mobilität, Raumentwicklung authority. und Umwelt des Kantons Wallis Dienststelle für Hochbau, Denkmalpflege Archäologischer Dienst des Kantons Bern und Archäologie Brünnenstrasse 66 Case postale, 1950 Sion Postfach Téléphone +41 27 606 38 00 3001 Bern +41 31 633 98 98 [email protected] [email protected] www.vs.ch/web/sbma/patrimoine-archeologique www.be.ch/archaeologie Service des bâtiments, monuments et archéologie Erziehungsdirektion des Kantons Bern Avenue du midi 18 Direction de l’instruction publique du canton de Berne Case postale 1950 Sion Amt für Kultur | Office de la culture +41 27 606 38 00 Archäologischer Dienst des Kantons Bern [email protected] Service archéologique du canton de Berne www.vs.ch/web/sbma/patrimoine-archeologique Postfach, 3001 Bern Telefon +41 31 633 98 00 Thank you very much! [email protected] For archaeological services of other cantons and Lötschenpasshütte www.be.ch/archaeologie information www.alparch.ch Lötschen Pass 1 Lauchernalp The Lötschen Pass as a hiking destination Nowadays, the Lötschen Pass is a popular and worthwhile BERNESE ALPS hiking destination. -

Das Ritterdorf
Jahrgang 14 - Nr. 2 - September 2015 ...das Ritterdorf Seite 2 inhaltimpressum Seite 03 Aus dem Gemeinderat Persönlich ... Seite 04 Stipendien und Ausbildungsdarlehen Seite 05 Geschtjier Agenda Seite 06 Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde in unserem Bezirk: Rückblick 2014 Seite 07 Lufu-Trail Seite 08 Niedergesteln in mehr als 150 Jahren Volkszählungen Seite 10 Wärmetechnische Gebäudesanie rung Schulhaus mit Turnhalle Niedergesteln Seite 11 Fronleichnam Seite 12 Aus dem Pfarrei- und Kirchenrat Seite 13 Gesamtsicht Kirchenrechnung 2014 Alpfest 2015 im Joli Seite 14 Korrigenda Seite 15 Haus der Generationen St. Anna Seite 16 Schulspaziergang 2015 der 1./2. Klasse und des Kindergartens Seite 17 Schulfoto Schuljahr 2015 - 2016 Seite 18 Schulverlegung und Besuch auf dem Bauernhof der 3./4. Klasse Seite 19 SchuB – Schule auf dem Bauernhof Telefon : Seite 21 Bildungslandschaft Raron +41 (0)27 934 19 12 Gedichte und Sprüche Seite 22 Weinübergabe „Chateau de la Tour“ Pro Castellione Für das Fotoalbum Fax : Seite 23 Der Bischofsmord +41 (0)27 934 29 06 Seite 26 Aus dem Tambouren- und Pfeiferverein Seite 27 „Schüälspaziärgang fa ischum Mittagstisch“ Burnout bei (Haus-) Frauen und Müttern – öffentlicher Vortrag von Frau Alice Stucky lic. phil. Internet : Seite 28 Vereinsausflug der FMG ins magische Tal www.niedergesteln.ch Steinbockbläser Steg erfolgreich am Eidgenössichen www.3942.ch Jagdhornbläsertreffen Seite 29 Rassensieger auf hohem Niveau Grosse Erfolge E-Mail : Seite 30 Aus dem Kirchenchor [email protected] Seite 33 Dominic Walker am Race-Day in Ulrichen Seite 34 Geschtjier Schützen Infizierte Zecken auch in Niedergesteln Seite 35 Aktionen Dorfladen Impressum Herausgeber: Kommunikationsteam: Nächste Ausgabe: Gemeinde Niedergesteln Josef Pfammatter Dezember 2015 Kirchgasse 6 3942 Niedergesteln Manuela Imstepf Redaktionsschluss für die nächste Trudy Kalbermatter Ausgabe: 02. -

Protokoll Der GV Diana Westlich Raron Vom 27
Protokoll der GV Diana westlich Raron Vom 27. November 2011 in Kippel 1. Begrüssung Präsident Manfred begrüsst die anwesenden Jägerinnen und Jäger zur diesjährigen Generalversammlung. Besonders begrüsst er Scheibler Peter von der Kantonalen Jagdabteilung, das Ehrenmitglied Schwestermann Alex, Altstaatsrat Willy Schnyder, die Wildhüter Amacker Walter, Bellwald Richard und Imboden Thomas sowie die Altwildhüter Bellwald Anton, Brunner Anton und Rieder Willy, der Vertreter der Gemeinde Vizepräsident Meyer Karl und den Dianafähnrich Roth Gilbert. Entschuldigt haben sich folgende Personen: Korrespondent Roland Walker, Brigger Alban Forst Kreis II, Bellwald Siegfried Forst Kreis III, Pfammatter Anton, Pfammatter Dionys, Henzen Michel, Salamin Michel, Salzgeber Walter, Ehrenmitglied Murmann Ru- dolf, Fryand Carlo, von Roten Heinrich, Wyer David, Rubin Walter, Schnyder Oliver und Schmid Louis 2. Wahl der Stimmenzähler Als Stimmenzähler wurden gewählt: Bellwald Adrien, Imboden Richard, Koder Werner und Schmid Edwin. 3. Protokoll der letzen GV Das Protokoll der letzten GV wurde der Einladung beigelegt. Es gab keine Fragen oder Einwände zum Protokoll. Das Protokoll wurde mit Applaus genehmigt. 4. Kassa- und Revisorenbericht Die Jahresrechnung wurde von Kassier Bellwald Richard verlesen. Die Einnahmen belaufen sich auf Fr. 16'089.10 und die Ausga- ben auf Fr. 14'561.45. Das Vermögen beträgt neu Fr. 38'304.85 Der Revisorenbericht wurde vom Revisor Gattlen Joachim verlesen, er beantragt dem Kassier Entlastung zu erteilen. Die Kassa wurde mit Applaus genehmigt. 5. Jahresbericht des Präsidenten Der diesjährige Jahresbericht wird wie in den letzten Jahren üblich in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil lässt Präsident Manfred das verflossene Jahr kurz Revue passieren. Insbesondere erwähnt er, dass an der DV in Mörel des Oberwalliserjagdverbandes mit Daniel Ferdinand Lauber aus Zermatt ein neuer Präsident gewählt wurde. -

Achten Auf Das Wohl Des Kindes
Walliser Bote WALLIS Freitag, 20. Mai 2016 7 Gesellschaft | Wenn Eltern scheiden Achten auf das Wohl des Kindes VISP | In der Schweiz wur - die geplante alternierende den letztes Jahr 16 671 Obhut ein wichtiger Entscheid. Ehen geschieden. Das Ob sich diese bewährt, wird entspricht 40,7 Prozent. sich zeigen. Sicher ist, dass Im Wallis lag die Schei - das Aufenthaltsbestimmungs - dungsquote 2015 bei recht auch Konfliktstoff birgt. 43 Prozent. Das Wohl der Dieser verschärft sich beispiels - Scheidungskinder ist weise fast schon automatisch eine immerwährende beim Wegzug eines der beiden Herausforderung. Partner. Rieder: «Ich überlasse es Ihrem Urteil, ob der Obhuts - Rund um diese Thematik wird wechsel im Interesse des Kin - diese Woche an der Hochschule deswohls ist», sagte Rieder. Im - Wallis von verschiedenen Insti - mer mehr zum Thema wird ein tutionen ein zweitägiges Kollo - Konkubinatsvertrag für Paare, quium durchgeführt. Beteiligt die nicht heiraten wollen. In ei - sind daran das internationale ner Art «Ehe light» sollen den Institut für das Recht des Kin - Kindern die gleichen Rechte des, die Universität Genf, die zustehen wie in einer konven - HES-SO Wallis, die Pädagogi - tionellen Ehe. sche Hochschule Wallis und der Kanton Wallis mit dem Jugend - amt sowie dem Zentrum für «Kinder haben Entwicklung und Therapie. für die Bewälti - Den Auftakt erlebte die Tagung an einer öffentlichen Podiums - gung von Krisen Eltern scheiden, Kinder nicht. Zu diesem Thema referierten und diskutierten in Visp Romaine Schnyder, Allan Guggenbühl, veranstaltung am Mittwoch - eine gewisse Wi - Thierry Schnyder, Kathrin Heitmann-Säuberli, Danielle Estermann, Olivier Hunziker und Manuela Fertile (von links). FOTO WB abend in Visp. Fachleute, Lehr - personen und Eltern nahmen derstandskraft» daran teil. -

Ouvrages D'art À L'étude En 2013
TRAVAUX A L’ETUDE EN 2013 / STRASSENARBEITEN IN DER STUDIENPHASE IM JAHRE 2013 OUVRAGES D’ART / KUNSTBAUTEN 1 174 Anschluss Embd und Derfji Embd, Tschongbach Embd : Lawinengalerie Tschongbach Embd 2 28 Anschluss Agarn Agarn : Durchlass Märätschibach 3 A213 Illas – Täsch St. Niklaus : Ersatz Brücke Bielzigji 4 24 GoppensteinBlattenFafleralp Blatten : Instandsetzung Lonzabrücke 5 1013 BlitzingenBodmen Blitzingen : Rottenbrücke Bodmen 6 16 StaldenStaldenried Staldenried : Wendeplatte Furrers Hüs 7 A19 BrigFurkapass Obergoms : Instandsetzung Brücke Belvedere 3 8 183 TurtmannOberemsGruben Eischoll : Brücke Turtmänna 2 9 24 GoppensteinBlattenFafleralp Ferden, Brücke Ferdubach : Sanierung Brücke Ferdubach (Ferden, Kippel) 10 1 NatersBlatten Naters : Brücke Rischinen Bruchji 11 24 GoppensteinBlattenFafleralp Kippel : Sanierung Golmbachgalerie 12 247 GueurozTaillaCrêtaz Blatten : Ersatz Brücke Äussere Talbach 13 30 SustenLeukerbad Inden : Sanierung Dalabrücke Rumeling 14 13 TäschZermatt Zermatt : Neue Bielbrücke 15 10 LaldenBrigerbadGamsen BrigGlis : Brücke über SBB MGB Gamsen 16 809 St NiklausSchwidernen St. Niklaus : Durchlass Birchmattenbach 17 11 Anschluss Lalden Lalden : Laldnerbrücke über Rotten SBB BVZ 18 5 GrengiolsVierteHockmattenBinn Grengiols : Brücke Milibach Bächerhyschere 19 1 NatersBlatten Naters : Unterführung Wieri 14 / 27 20 A19 BrigFurkapass Obergoms : Instandsetzung Brücke Belvedere 2 21 3 OberWaldUnterwasser Obergoms : Rottenbrücke Oberwald 22 719 StegMittal (Alte A509) StegHohtenn : Brücke Klösterli -

Www. Loetschental.Ch Lötschental
lötschental - das magische tal Transport / Tranportation / Transport Angebote Fahrplan / Timetable / Horaire 06.06.2020 - 25.10.2020 Sommerinfo & Panoramakarten Lötschentaler Wander- und Freizeitpass de Wiler und Lauchernalp ab: Freie Nutzung von Lauchernalp Bergbahn Postauto (Gampel/Steg- Fafleralp) 07.25 # 10.25 13.25 15.55 18.15 h Free use of Gsteinät Minigolf en 08.25 10.55 13.55 16.25 18.25 i Usilisation Lötschentaler Museum gratuit de Hallenbad Steg fr 08.55 11.25 14.25 16.55 20.15* h 09.25 11.55 14.55 17.25 20.25* i 3 Tage/Days/ 8 Tage/Days/ 09.55 12.15 15.25 Jours Jours Erwachsene/Adult/Adultes CHF 49.00 CHF 85.00 # nur auf Voranmeldung bis 17.00 Uhr/only on prebooking till 5pm/seulement sur réservation jusqu‘à 17h00 + 6-16 CHF 75.00 CHF 129.00 * nur/only/seulement 11.07.2020 - 16.08.2020 Familienkarte / Family Card / Carte de famille (109.00 CHF) Tarife / Prices / Tarifs Luftseilbahn Wiler-Lauchernalp Beinhaltet die Nutzung der Lauchernalp Bergbahn, Parkplatz in Wiler und Fahrbewilligung für Gäste auf der Lauchernalp Einzelbillette einfach retour Includes the use of Lauchernalp Gondola, Parkingspace in Wiler Single Tickets single retrun Billets individuels simple retour and Licence to drive to Lauchernalp for Guests with restidance at Lauchernalp. Erwachsene/Adult/Adultes CHF 18.00 CHF 24.00 Comporte l‘utilisation de la télecabine Lauchernalp, place de Kind6-16, 1/2-Tax, Hund CHF 9.00 CHF 12.00 parque à Wiler et autorisation de monté sur la Laucheralp si vot- Gästekarte/Guest Card/ Carte de sejour CHF 15.00 CHF 20.00 re destiation est la Laucheralp. -

Name Vorname Ort Abgottspon Bruno Grengiols Abgottspon Konrad
Name Vorname Ort Abgottspon Bruno Grengiols Abgottspon Konrad Stalden Alpenhotel Zur Wildi Wiler Bacher Rosi Münster Bacher Rudolf Münster Bellwald Peter Susten Blatter Urs Susten Blatter-Locher Marlis Susten Bregy Alain Susten Bregy Beatrice Steg Briw Anton Ernen Burchard Ulrich Ried-Brig Clausen Angelina Ernen Clausen Nicole Ernen Clausen Stephan Ernen Coppex Blanche Bern Coppex Philippe Steffisburg Eggel Cornelia Ried-Brig Eggel Hans-Peter Ried-Brig Eggel Hans-Ruedi Naters Eggel Thomas Termen Escher Beat Termen Eyholzer Erwin Gamsen Fercher Irmgard Lalden Fercher Werner Lalden Fux Anton Embd Fux-Clausen Jasmine Glis Gasser Alfreda Lalden Gasser Hugo Lalden Grand Helmut Steg Grand-Brenner Eliane Steg Grichting Alfred & Marianne Leukerbad Grichting Fabian Leukerbad Grichting Jean-Lou Leukerbad Heinzen Georg Brig-Glis Henzen Herbert Steg Hutter Bruno Lalden Hutter Ernest Lalden Hutter Ludwig Lalden Imboden Armin Glis Imboden Beat Raron Imboden Marco & Karin Glis Imboden Stefan Zuzwil Imoberdorf André & Eveline Münster Imoberdorf Peter & Susanne Münster Imseng Bruno Blatten Imstepf Lilian Lalden Imstepf Willi Lalden Jaggi Georg Kippel Jaggi Leonie Kippel Jaggi-Bellwald Ernestine Kippel Jeitziner Roland Lalden Jeitziner Rosmarie Lalden Jergen Christian Münster Julen René Glis Kalbermatter Rolf Ried-Brig Kalbermatter Rudolf St. Niklaus Knubel Elsbeth Bürchen Kuonen Walter Lalden Lauper Doris Brig Lehner Richard Sion Leiggener Ludi Ausserberg Lochmatter Manuela Brig-Glis Lochmatter Robert Brig-Glis Loretan Arthur & Hedy Varen Loretan Carmen