Europas Verratene Soehne.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
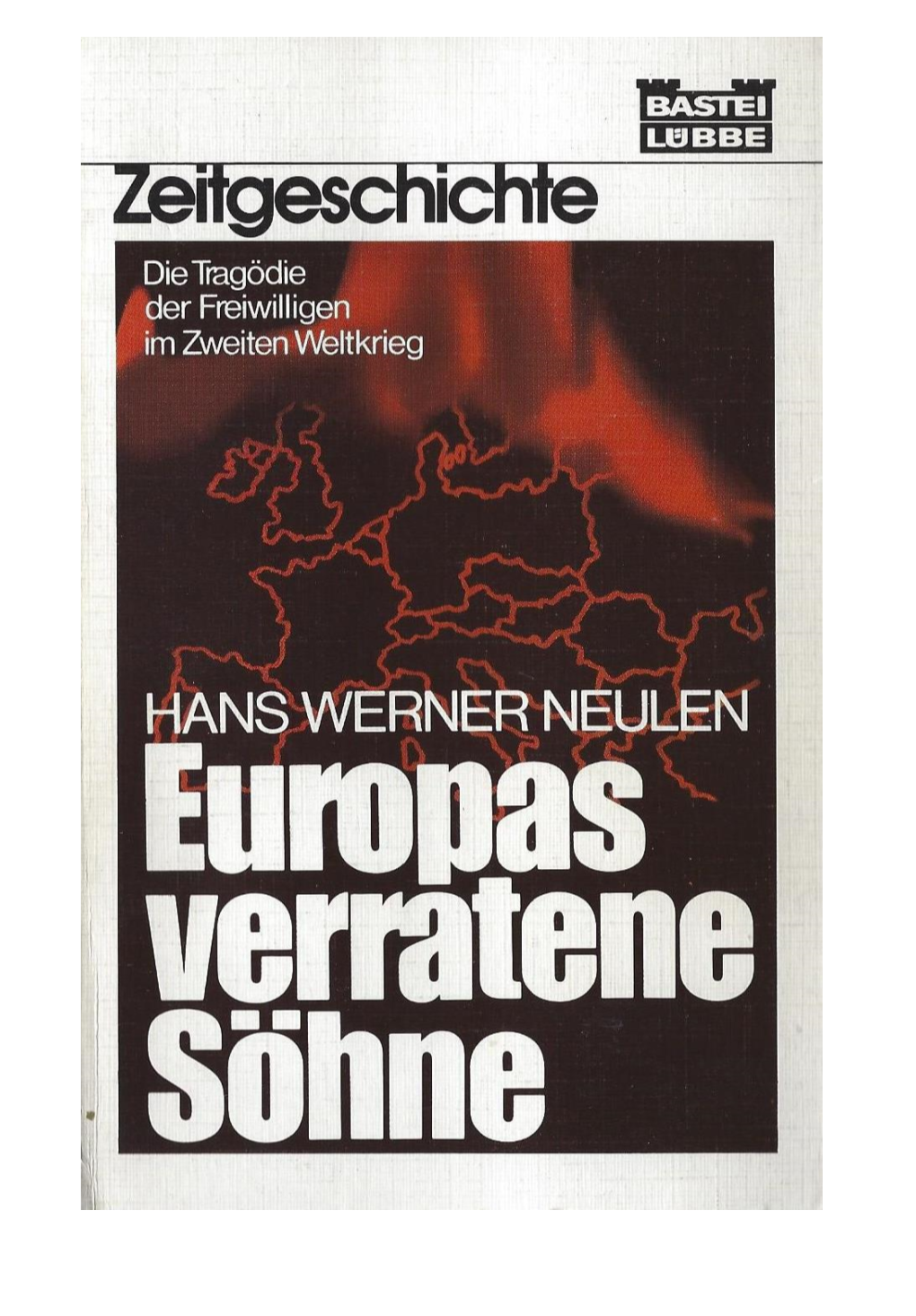
Load more
Recommended publications
-

Interview with Joseph Roos, Los Angeles, July 20, 194J Mr. Roos Is
Interview with Joseph Roos, Los Angeles, July 20, 194J Mr. Roos is *iitiiaia&xi a memb r of a large Jewish law firm which operates a news research service at 727 W 7th St* The firm is connected withe the anti-defamation league whose object is to expose anti-semitic propaganda. In 1940 the research service published two of thier weekly news letters on Japan se activities. These were concerned with alleged milit ry preparation of Japan in coll boration with Germany and are most interesting because they were reprinted, word for word, in Martin Dies yellow Book as the product f Dies own investiagtion. Later HXHKXXiHH MarcantAnio photostated the News Letters in an effort to discredit the Dies Committee. Mr. Roos knew very little about the evacuation problems but he directed me to other people in the city. Later, also, Mxxthe senior member of the firm (a rominent Legionaire and layyer) Leon Lewis called me. I was unable to see ir. L becau e ixxxxof my overcrowded schedule, but ho told me he had definitive proof on h nd tj refute the story that Jewish business men rofited from the evacuati n. If and when we ever get an economist to do some work onthe Japanese problem, Mr. L will be of great aid. He said he w uld turn over hi oo plete file to the Study. NEW LETTER Published by News Research Service, Inc., 727 W. Seventh Street, Los Angeles, Catifornia S(MM< of *in'!. Moří ú M .fri.iu StudfnU and W,it*ri. F ) ^ u r t . -

Spionage Und Landesverrat in Der Schweiz Band 2
Karl Lüönd Spionage und Landesverrat in der Schweiz Band 2 RINGIER © 1977 by Ringier & Co AG, Zürich Alle Rechte vorbehalten Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus zu kopieren oder zu vervielfältigen Gedruckt in der Schweiz bei C. J. Bucher AG, Luzern ISBN 3 85859 062 2 Eingelesen mit ABBYY Fine Reader Feldpost, Brieftauben, Pferdekuranstalten 40 Sx. aus Berlin ausgewiesen! 86 Inhalt 72 Stunden für den Grenzschutz 41 • Krach um Dr. Meyers Erbe 86 So beurteilen die Deutschen unsere «Unternehmen Wartegau» – So platzt • Dieser Punkt kennzeichnet spezielle Beiträge in Armee 41 Görings Sabotageplan 87 Kästchen • Verfolgungsjagd per Autostopp 42 Der Auftrag der Saboteure 88 Zu hoher Eintrittspreis! 43 Zugführer Stöckli greift ein 88 «Operation Sunrise» – Geheimdienst für den Frieden 89 Riskante Reise 92 Hindemislauf zum Frieden 95 Die Verräter grossen Fälle Der Major, der die Schweiz regieren will 46 Verschwörer der Nach- Burri tobt: «Ich wurde verschleppt!» 48 kriegszeit Versager «Guisan, dieser wahnwitzige Verbrecher...» 48 • Wer ist Igor Mümer? 98 Augenzeugenbericht: Die letzten Stunden der Den Worten folgen Taten 49 Fälle, die verborgen bleiben 99 Verräter 10 «Ich nehme keine Schuld auf mich!» 50 Militârattachés als legale Spione 99 Verrat von Sprengobjekten 10 Illegale Kampftruppe von 1‘800 Mann 51 Der Mann, der jedes Wort verkauft 100 • Befehl und Gewissen 10 Schwarze Listen für den Ernstfall 52 Geheimnisverrat aus Arglosigkeit 100 Verführer und Verführter 11 Politische -

Zurzach Zur Zeit Des Nationalsozialismus'
383 Zurzach zur Zeit des Nationalsozialismus' WALTER LEIMGRUBER «Der Frontenfrühling sprang auf unser Land über und schoss bald mächtig ins Kraut. Manch ein später Honoriger war in seinen damals noch jungen Jahren unschlüssig, und in den einen und andern unter ihnen frass sich der Wurm des nationalsozialistischen Gedankengutes [ ... ] »* Am 7. Februar 1935 wurde der Zurzacher Unternehmer Karl Mallaun in Deutschland verhaftet unter der Beschul digung, den deutschen Devisenbestimmungen zuwiderge handelt zu haben. Mallaun wurde in Berlin festgenommen und am 15. Februar von zwei Beamten nach Waldshut gebracht, wobei «die Fahrtkosten 2. Klasse zu seinen Las ten» fielen, wie der Aargauer Polizeichef Oberst Oskar Zumbrunn in seinem Schreiben an die Polizeidirektion fest hielt. In Basel hatte der Zug Aufenthalt, ein Begleiter riet Mallaun, auszusteigen und zu verschwinden. Dieser woll te nicht: «Ich habe nichts ungesetzliches begangen und brauche deshalb die Flucht nicht zu ergreifen .>>2 Nach ei nigen Monaten Untersuchungshaft in Waldshut sah Mallaun die Sache anders. Am 4. August 1935 floh er aus dem Gefängnis und schlug sich in die Schweiz durch. Mallaun betrieb in Zurzach mit seinem Bruder ein Bauge schäft, das 1933 in Zahlungsschwierigkeiten geriet. Die Baufirma wurde vorerst weiterbetrieben, befand sich im Moment der Verhaftung aber in der Phase der Liquidati on. Mallaun war auch in Deutschland aktiv. Zusammen mit dem deutschen Architekten Adolf Mildenberger, der ebenfalls verhaftet wurde,3 besass er dort Liegenschaf ten, «die grössere Werte repräsentieren». Die beiden * PAUL HAUSHERR, Feldgraue Tage , Erinnerungen aus den Jahren 1935- 1945, Baden 1975, S. 9. 1 D as Kapitel bas iert auf den umfangreichen Akten des N achrichten dienstes der Aargauer Polizei in Aarau (in den Anmerkungen ge kennzeichnet mit «PK AG ND 2.WK» = «Polizeikommand o Aar gau, N achrichtendienst Zweiter W eltkrieg» und der entsprechen den Dossiernummer) und den Akten der Schweiz. -

Interviev7 with Joseph Roos, Los Angeles, July 20, 194O Mr. Roos Is
Interviev7 with Joseph Roos, Los Angeles, July 20, 194o Mr. Roos Is sfftiiaisokx* a memb r of a large Jewish law firm which operates a news research service at 727 W 7th St- The firm is connected withe the anti-defamation league whose object is to expose anti-semitic propaganda. In 1940 the research service published two of thfcr weekly news letters on Japan se activities. These were concerned with alleged railit ry preparation of Japan in collaboration with Germany and are most interesting because they were reprinted, word for word, in Martin Dies fellow Book as the product f Dies own investigation. Later KXKKXXfiXK MarcantAnio photost ted the News Letters in an effort to discredit the Dies Committee. Mr. Roos knew very little about the evacuation problems but he directed m© to other people in the city. Later, also, Mxxthe senior member of the firm (a rominent Legionaire and layyer) Leon Lewis called me» I was unable to see Mr. L becau e ixxaxof my overcrowded schedule, but he told jne he had definitive proof on hand to refute the story that Jewish business men rofited from the evacuati n. If and when we ever get an economist to do some work or,the Japanese problem, Ilr. L will be of great aid. He said he w>uld turn over hi co plete file to the Study. NEWS LETTER Published by News Research Service, Inc., 727 W. Seventh Street, Los Angeles, California Space permits only highlighting of netvs. More detailed information is available to serious Students and Wriurs. [Figure« In Text Indicate Ref- HH^^mmmmMo. -

Spionage Und Landesverrat in Der Schweiz Band 1
Spionage und Landesverrat in der Schweiz Karl Lüönd Spionage und Landesverrat in der Schweiz Band 1 RINGIER Mitarbeiterin des Autors: Irene Kellenberg Lektorat: Max Rutishauser Gestaltung: Walter Voser © 1977 by Ringier & Co AG, Zürich Alle Rechte vorbehalten Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus zu kopieren oder zu vervielfältigen Gedruckt in der Schweiz bei C. J. Bucher AG, Luzern ISBN 3 85859 0614 Eingelesen mit ABBYY Fine Reader Schweizer Nachrichtenchefs beliefern • Die Auftragsliste eines Spions 78 Inhalt die Deutschen – die Oberstenaffäre 37 Die Schliche der Agenten 80 • Dieser Punkt kennzeichnet spezielle Bei- Kein «einzig Volk von Brüdern» 38 • Blätter aus dem Untergrund 80 träge in Kästchen Sprachgenie kommt den Obersten «Pakbo» legt drauf 81 auf die Schliche 39 In Rados Netz 82 Wille will alles geheimhalten 40 «Von Pol zu Pol» im Wirrwarr • Ist der Staatsrat ein Spion? 40 der Zeichen 83 Vorwort 7 Der unglaubliche Rudolf Roessler 85 Roessler wird zum Nazi-Gegner 85 Emigration und Neubeginn 86 Roessler wird Agent 87 Verrat und Kleine Zettel – grosse Rat in der Geheimnisse 87 Aus Roessler wird «Lucie» 89 alten Schweiz Information ist keine Einbahn- Bubenbergs Entscheidung 10 Verwirrung, Zersplitterung, Verrat 45 strasse 90 Die Sage vom Teufelsbund 11 • Wie sich die Dinge gleichen... 48 Rätsel um Roesslers Quelle gelöst? 91 Propaganda als Geheimwaffe 12 Der Untergrund regt sich 49 Falsche Fährten 92 Ideologie und Geldgier 12 Fünfte Kolonne im Aufbau 49 • Der schwarze Fleck im Honigglas 92 Hochschule der Politik 13 «Gestatten, Danner, Gestapo- Zwei «Blitzmädel» gegen Hitler 94 Agent!» 50 Fünf Nachrichtenwege nach Luzern 95 • Merkwürdige Landkäufe 50 Bupo verstopft die beste Ein Attentat wie bestellt 52 Schweizer Nachrichtenquelle 96 Weil der Waffenschmuggel und • Das Netz Rado 96 Menschenraub 52 So fliegt das Rado-Netz auf 97 Mensch es Die Polizei packt zu 97 wissen will.. -

Nationale Erneuerungsbewegungen in Der Schweiz 1925-1940
VIERTELJAHRSHEFTE FÜR ZEITGESCHICHTE 14. Jahrgang 1966 1. Heft/Januar PETER GILG UND ERICH GRUNER NATIONALE ERNEUERUNGSBEWEGUNGEN IN DER SCHWEIZ 1925-1940 D er Schweizer neigt von Natur nicht zum politischen Extremismus. Links- und rechtsextreme Bewegungen sind in der Schweiz stets nur vorübergehend und nicht in breiten Schichten wirksam geworden. So hat auch in der Zeit des Faschismus und Nationalsozialismus der Rechtsextremismus in der schweizerischen Politik keine bestimmende Bedeutung gewinnen können. Die große europäische Reaktion der Zwanziger- und Dreißigerjahre ging aber an der Schweiz nicht spurlos vorüber. Sie hat im Gegenteil das geistige und poli tische Leben stark beeinflußt, freilich auf Grund der spezifischen Gegebenheiten des Landes in besonderer Weise. Eine Darstellung dieses Einflusses kann sich deshalb nicht auf die dem italienischen Faschismus oder dem deutschen Nationalsozialismus nahestehenden und mehr oder weniger mit ihm liierten Bewegungen beschränken. Sie muß den Gesamtkomplex einer Bewegung der nationalen Erneuerung einbe ziehen, welche untereinander sehr verschiedene Versuche, die auch in der Schweiz empfundene Krisenlage der herkömmlichen Demokratie zu überwinden, umfaßt. Wie tief das Gefühl einer unmittelbar bevorstehenden Zeitwende auch bei Schweizern gewesen ist, die durchaus nicht krisenhaft angekränkelt waren, zeigt etwa eine Studie des Basler Historikers Emil Dürr1, die in einer abschließenden „Charakteristik der heutigen politischen Gesamtlage"2 das politische Leben „haupt sächlich von wirtschaftlich-materialistischen Mächten und Bewegungen beherrscht" und „die ursprünglichen und traditionellen geistigen Werte und Mächte" empfind lich geschwächt sieht. Beherrschend sei die allgemeine, grundsätzliche Kritik an der europäisch-traditionellen Gesellschafts- und Wirtschaftsform, die Erschütterung des traditionellen Rechtsbewußtseins, der Schwund des Dienst- und Pflichtgefühls, die Entwertung von Individuum und Persönlichkeit u. a. -

Die Disteln Von 1940
Die Disteln von 1940 1973 Georg Kreis sagt von seiner hier veröffentlichten Studie mit einer Bescheidenheit, in der eine vielleicht ungewollte Ironie gegenüber historischen Synthesen und Fresken mitklingt, er habe sich darin «vornehmlich in den Niederungen der Wirk- lichkeit bewegt und die Frage, wie es eigentlich gewesen ist, mit einem einfachen Bericht zu beantworten gesucht». Es ist tatsächlich ein Bericht, aber kein einfa- cher: nie wird die Komplexität historischen Geschehens deutlicher, ja manchmal entmutigender demonstriert als in der genauen Untersuchung der Zusammen- hänge und Verästelungen eines Einzelvorfalls. Hier wird mit dem Mikroskop eine scheinbar eng begrenzte, aber als Probefall beinahe legendär gewordene Episode des «Schicksalssommers» 1940 untersucht und auf Grund aller erreichbaren Dokumente und Aussagen bis in alle Einzelheiten rekonstruiert: der Versuch des deutschen Presseattachés Trump, durch direkte Intervention den Chefredaktor des «Bund» zu Fall zu bringen. In die Untersuchung miteinbezogen sind die damit verknüpften Parallel- und Nebenaktionen, Vor- und Nachspiele, die durch per - sonelle und sachliche Zusammenhänge unmittelbar folgende Implikation der «Schweizerischen Depeschenagentur», der eher verworrene Einschaltungsver- such in einen schon im Gang befindlichen Personal- und Kurswechsel der Basler «National-Zeitung» und die bereits verzettelten, über Hintertreppen und Dritt- personen geführten Geplänkel um die leitenden Positionen der «Neuen Zürcher Zeitung» und der «Basler Nachrichten». Im uns geläufig -

Part Ii. Foreign Countries I
REVIEW OF THE YEAR 5701 125 PART II. FOREIGN COUNTRIES I. BRITISH COMMONWEALTH By THEODOR H. GASTER* Let the sharp ball of fire be hurled at me; Let heaven be alive with lightning flash And scourge of angry winds; O let the earth Ail from her prime foundation tempest-tost! Crash forth, ye mighty breakers of the sea; Stars in your courses, clash and run together! Let the swift eddies of relentless Fate Sweep this poor body into darkest hell; Yet still shall life endure. Aeschylus, Prometheus Bound, 1045-1055. Great Britain British Jewry was mainly occupied during the past year with the twin problems of air raids and evacuation, both of which brought profound changes in its structure and complexion. Wholesale destruction on the one hand and the readjustment of life on the other confronted the community with a host of new problems and anxieties. It is the object of the following pages to offer a rounded picture of these developments. No attempt has been made to produce a day-by-day record. Indeed, in present circum- stances this would have been impossible, in view of the rigid censorship to which all news from Britain is subjected. It is, for example, quite impossible, in most cases, to state the precise date on which a building was bombed, nor is it by any means a simple matter to identify in every instance the "well-known structure" or "prominent synagogue" of an official dispatch. Air Raids LONDON'S Jewish quarter, where the policemen speak Yiddish and where East meets West in striking defiance of the well-worn proverb, is a sprawling jumble of mean 'Editorial Secretary, Institute of Jewish Affairs of the American Jewish Congress. -

Between Nazism and Opportunism
Between Nazism and Opportunism Swiss Volunteers in the Waffen-SS Master Thesis Holocaust and Genocide Studies University of Amsterdam June 2014 Name: Sarah Weber 10418636 Supervisor: Prof. Dr. Johannes Houwink ten Cate Second Reader: Dr. Karel C. Berkhoff 2 Contents Abbreviations ...................................................................................................................................................................... 5 List of Figures ...................................................................................................................................................................... 7 1. Introduction ................................................................................................................................................................ 9 1.1. Swiss Volunteers in the Waffen-SS ..................................................................................................... 9 1.1.1. Current State of Research .................................................................................................................. 9 1.1.2. Research Questions ........................................................................................................................... 15 1.1.3. Source Discussion .............................................................................................................................. 16 1.1.4. Approach and Structure .................................................................................................................. 18 -

Battles Won Against All Odds Abu-Ageila Võ Nguyên Giáp
Military Despatches Vol 39 September 2020 Battles won against all odds No-one told them the were supposed to lose Winning the booby prize In a war zone even the most mundane object can kill Abu-Ageila Decisive tank battle in the Middle East Võ Nguyên Giáp The school teacher that defeated France and the USA For the military enthusiast CONTENTS September 2020 Page 14 Click on any video below to view How much do you know about movie theme songs? Take our quiz and find out. Hipe’s Wouter de The old South African Goede interviews former Defence Force used 28’s gang boss David a mixture of English, Williams. Afrikaans, slang and techno-speak that few Special Forces - Utti Jaeger Regiment outside the military could hope to under- stand. Some of the terms Features 26 40 were humorous, some IED - Insane, effective, deadly Covid unable to sink TS Rook were clever, while others 6 In modern wars and conflicts By Lt Lisa Spencer, Officer were downright crude. Ten battles won against all odds the enemy could be anyone. Commanding, TS Rook And they will use any weapon These are battles, and one war, and tactic to inflict casualties 42 where the outnumbered side and damage. One of the most Survival Part of Hipe’s “On the tore up the script. couch” series, this is an common weapons is the IED. This month we look at teepees 20 and lean-to’s as survival shel- interview with one of 32 ters. author Herman Charles Winning the booby prize Operation Cicero In a war zone even the most Bosman’s most famous In probably one of the most im- 46 simple act can have fatal conse- portant spy stories of World War characters, Oom Schalk quences. -

Foreign Countries (1942-1943)
166 AMERICAN JEWISH YEAR BOOK PART TWO: FOREIGN COUNTRIES I. BRITISH COMMONWEALTH 1. Great Britain BY THEODOR H. GASTER* ON THE morning of September 7, 1941, exactly a year after the modern "Fire of London," the narrow thoroughfares of the City were the scene of a unique and moving spectacle. The historic alleys, once the site of London Jewry, were thronged with some thousands of men and women, many in uniform and not all of them Jews, who had come from the four quarters of the metropolis to attend an open-air memo- rial service conducted by the Chief Rabbi in the ruins of the bomb-wrecked Great Synagogue. Instinct with pathos and imagination, compact both of memories and of hopes, the service typified the life of English Jews during the past year. Surrounded by the havoc of war, its normal structure disturbed and its services disrupted, the community bravely endeavored to regroup its forces and to keep its flag flying amid the dust and heat of the battle. The main task was to transform the existing machinery, or as much of it as remained intact, to meet the needs of a now scattered and decentralized community. With its numbers dispersed over countless small towns and villages, its children billeted in districts remote from Jewish contacts, its communal personnel largely absorbed in the war services, its finances depleted and many of its buildings damaged or destroyed, English Jewry faced a problem of maximal re- organization with minimal resources. Educational, religious, dietary and philanthropic facilities, previously concentrated in London and the larger cities, had now to be extended to outlying areas.