Bericht Gemeinde Ruggell
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
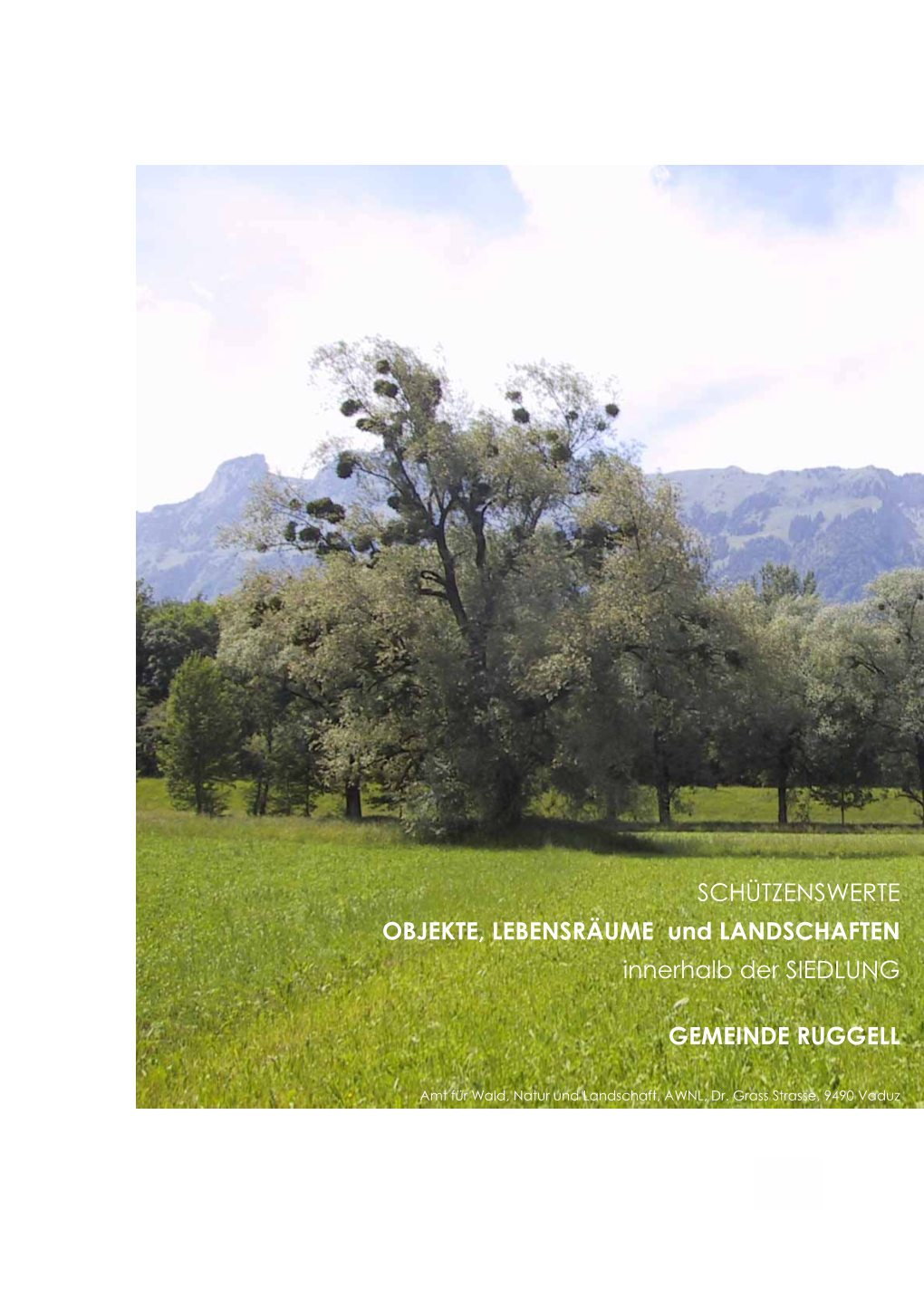
Load more
Recommended publications
-

Mobi 2030 L Ät Ts I Konze Tp
M O B I K O L I N Z T Ä 2 0 E P T S 3 0 T Mobilitätskonzept 2030 2 M O B I K O L I N Z T Ä 2 0 E P T S 3 0 T Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter. I N H A L T 5 8 1 Vorwort 10 2 Zusammenfassung 17 3 Mobilität in Liechtenstein – Ausgangslage 3.1 Geschichte der liechtensteinischen Verkehrsinfrastruktur 18 3.1.1 Eisenbahnlinie Feldkirch-Buchs 3.1.2 Strasseninfrastruktur in Liechtenstein 20 3.1.3 Rheinübergänge und Schweizer Autobahn 3.1.4 Langsamverkehr – Fuss- und Radverkehr 21 3.1.5 Öffentlicher Verkehr 3.1.6 Internationale Erreichbarkeit und Luftverkehr 3.1.7 Fazit nach 150 Jahren Verkehrsinfrastrukturentwicklung 22 3.2 Bisherige Mobilitätskonzepte der Regierung 23 3.2.1 Mobilitätskonzept «Mobiles Liechtenstein 2015» vom September 2008 3.2.2 Mobilitätskonzept «Statusbericht mit Ausblick 2020» vom August 2016 25 3.3 Aktuelle Situation und Ausblick 26 3.3.1 Bevölkerungs- und Beschäftigungsentwicklung 28 3.3.2 Pendlerströme von und nach Liechtenstein 30 3.3.3 Verkehrsmittelwahl 32 3.3.4 Motorisierter Individualverkehr 40 3.3.5 Öffentlicher Verkehr 42 3.3.6 Radverkehr 44 3.3.7 Fussverkehr 45 3.3.8 Güterverkehr 46 3.3.9 Verkehrssicherheit 3.4 Regionale Entwicklungen im Mobilitätsbereich 48 3.4.1 Kanton St. Gallen, Schweiz 3.4.1.1 Gesamtverkehrsstrategie Kanton St. Gallen 3.4.1.2 Schieneninfrastruktur St. Galler Rheintal: Ausbauschritte STEP 2025 und 2035 46 3.4.1.3 Nord- und Südschleife Buchs -

B ADDITIONAL AGREEMENT Between the European
02007A1013(01) — EN — 01.05.2014 — 001.001 — 1 This text is meant purely as a documentation tool and has no legal effect. The Union's institutions do not assume any liability for its contents. The authentic versions of the relevant acts, including their preambles, are those published in the Official Journal of the European Union and available in EUR-Lex. Those official texts are directly accessible through the links embedded in this document ►B ADDITIONAL AGREEMENT between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein extending to the Principality of Liechtenstein the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products (OJ L 270, 13.10.2007, p. 6) Amended by: Official Journal No page date ►M1 Agreement between the European Union, the Swiss Confederation and L 297 49 16.11.2011 the Principality of Liechtenstein amending the Additional Agreement between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein extending to the Principality of Liechtenstein the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products ►M2 Decision No 3/2014 of the Joint Committee on Agriculture of 9 April L 180 62 20.6.2014 2014 02007A1013(01) — EN — 01.05.2014 — 001.001 — 2 ▼B ADDITIONAL AGREEMENT between the European Community, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein extending to the Principality of Liechtenstein the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products THE EUROPEAN COMMUNITY (the Community), THE SWISS CONFED ERATION (Switzerland) and THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN (Liechtenstein), Whereas: (1) Liechtenstein forms a customs union with Switzerland in accordance with the Treaty of 29 March 1923 between the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein incor porating Liechtenstein into the Swiss customs territory (Customs Treaty). -

System Polityczny Księstwa Liechtensteinu
Książka dofi nansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych oraz Instytutu Europeistyki RECENZENT prof. zw. dr hab. Marek Bankowicz PROJEKT OKŁADKI Anna Sadowska © Copyright by Krzysztof Koźbiał & Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydanie I, Kraków 2013 All rights reserved Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy. ISBN 978-83-233-3523-8 www.wuj.pl Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków tel. 12-631-18-81, 12-631-18-82, fax 12-631-18-83 Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98 tel. kom. 506-006-674, e-mail: [email protected] Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ................................................................................................................... 7 Wstęp .................................................................................................................................. 9 Rozdział 1. Zarys historii politycznej Liechtensteinu ................................................... 15 1.1. Ziemie współczesnego Liechtensteinu do końca XVII w. Przemiany polityczne i ustrojowe ........................................................................................... 15 1.2. W rękach -

Fma-Annual-Report-2020.Pdf
ANNUAL REPORT 2020 THEMATIC PAGES TRANSACTION MONITORING 24 THE FMA’S ROLE IN THE DEFENCE MECHANISM AGAINST MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING 32 ENFORCEMENT OF SUPERVISORY LAW 42 E-SERVICE PORTAL: EFFICIENCY GAINS FOR FMA AND INTERMEDIARIES 74 #FMAINSIGHTS 80 INSIGHTS INTO THE FMA CAREER TRAVEL BLOG 86 “I’M ABLE TO COMBINE THEORY AND PRACTICE IN THE BEST POSSIBLE WAY” 91 Cover photo Erratic granite boulder Eschnerberg CONTENTS FMA Annual Report 2020 4 FOCUS 7 FOREWORD PROGRESS REPORT 2020 10 SUPERVISION AND RESOLUTION 50 REGULATION 60 EXTERNAL RELATIONS 68 ENTERPRISE 82 TEAM ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENT 2020 97 ANNUAL REPORT 98 BALANCE SHEET 99 INCOME STATEMENT 100 NOTES ON THE FINANCIAL STATEMENT 104 ATTESTATION OF THE AUDIT OFFICE 3 FOCUS FMA Annual Report 2020 Enhanced supervision The revised Trustee Act entered into force on 1 July 2020. New supervisory instru- ments and additional powers have been transferred to the FMA. Professional obligations enshrined in the law and enhanced supervision are intended to strengthen confidence in the fiduciary sector, prevent abuses, and safeguard reputation. The fiduciary sector plays an important role for the Liechtenstein financial centre in asset preservation and structuring. Fiduciary sector Swiss Arbeitgeber Award for the FMA The FMA has received the Swiss Arbeitgeber Award ( Swiss Employer Award ) 2020. The FMA won second place in the medium-sized company category. The jury: the employees of the FMA. The award is based on an employee survey in which 92 % of FMA employees participated. The excellent result is proof that the FMA is valued as an attractive employer. Podium position Coronavirus pandemic poses dual challenges for the FMA Also for the FMA, the year 2020 was shaped by the Covid-19 pandemic. -

Synopse Der Pflanzengesellschaften Des Fürstentums Liechtenstein
Synopse der Pflanzengesellschaften des Fürstentums Liechtenstein Diplomarbeit am Institut für Botanik Department für integrative Biologie und Bio- diversitätsforschung Universität für Bodenkultur betreut von Univ.Prof.Dipl.Geograph Dr.rer.nat. Karl-Georg Bern- hardt Verfasser Stefan Mühlbauer Wien, Februar 2008 Vorwort Vorwort Die Motivation meinerseits mich diesem Thema zu widmen, waren praktischer und auch persön- licher Natur. Angeregt zur Entscheidung für ein vegetationsökologisches Thema war ich durch eine Biotoptypenkartierung im Sommer vor Beginn der Diplomarbeit im Nationalpark Hohe Tauern im Bereich des oberen Salzachtals. Durch diese Arbeit konnte ich meine Kenntnis über Pflanzen sowie auch Vegetationseinheiten bedeutsam erweitern, was für die theoretische Aufgabe der Datenaus- wertung, welche die Basis dieser Diplomarbeit darstellte, von Vorteil, ja schier unverzichtbar war. Ich finde es spannend, eine Vegetationsanalyse wie diese für ein gesamtes Land und daher einen klar begrenzten und überschaubaren Raum zu verfassen, zudem habe ich auch die Möglichkeit gese- hen, Sichtweisen eines Landschaftsplaners in die Arbeit einfließen zu lassen. Zugegeben war der Zeitpunkt des Beginns der Recherchearbeiten im Dezember mit ein Mitentscheidungsgrund dieses Thema zu wählen, da ich nicht auf Vegetationszeiten warten musste, sondern gleich starten konnte. Das Interesse an der Synopse seitens des Fürstentums Liechtenstein motivierte mich auch immer wieder während der Arbeit am Thema. Diese Zeichnungen stammen aus dem „Codex Liechtenstein“, der von den in Österreich geborenen Gebrü- dern Bauer im Jahr 1801 fertig gestellt wurde und in 14 Bänden 3100 Pflanzendarstellungen zeigt. Der „Codex Liechtenstein“ ist nach dem „Velin de Poiteau et Tulpin“ das zweitbedeutendste Werk von Pflanzenillustrati- onen weltweit und wird im katastrophensicher gebauten Bergfried des Schlosses Vaduz aufbewahrt. -

Bericht Gemeinde Schellenberg
SCHÜTZENSWERTE OBJEKTE, LEBENSRÄUME und LANDSCHAFTEN innerhalb der SIEDLUNG GEMEINDE SCHELLENBERG Amt für Wald, Natur und Landschaft, AWNL, Dr. Grass Strasse, 9490 Vaduz 1 Nicole Bolomey, Büro für Landschaftsarchitektur Dorfstrasse 24, 9495 Triesen, T +423 390 01 84, E [email protected] Bearbeitung N. Bolomey, Chr. Forrer, U. Mäder 2 INHALTSVERZEICHNIS 1 Einleitung ........................................................................................................................... 1 1.1 Ausgangslage und Ziel .....................................................................................................1 1.2 Bearbeitungsgebiet ..........................................................................................................1 1.3 Vorgehen ............................................................................................................................1 1.4 Planerische und gesetzliche Grundlagen ....................................................................2 1.5 Begriffe.................................................................................................................................4 1.6 Grundlegende Gedanken zu Natur und Landschaft In der Siedlung ....................5 1.7 Kriterien und Grenzen der Arbeit..................................................................................12 2 Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft im Siedlungsgebiet von Schellenberg................................................................................................................... 15 -

RESSORTBERICHT AMTSSTELLEN Hochbauamt
BAU RESSORTBERICHT setzte der Landtag an der November-Sitzung von der | 329 Traktandenliste ab. Ressortinhaber: Regierungschef-Stellvertreter Dr. Martin Meyer Baugebiet praktisch vollständig vermessen Aufgrund der konsequenten Arbeit der vergangenen Die Regierung hat im Berichtsjahr die Erarbeitung einer Jahre konnte im Berichtsjahr die Grundbuchvermessung Liegenschafts- und Immobilienstrategie initiiert sowie die des Baugebietes in Liechtenstein praktisch vollständig Durchführung eines Vorprojektes zur Optimierung der Ge- abgeschlossen werden. Dieser Abschluss stellt einen bäudebewirtschaftung beschlossen bzw. gestartet. Des Meilenstein im Bereich des Vermessungswesens dar. Weiteren wurde der jährliche Hochbautenbericht, der Ver- kehrsinfrastrukturbericht sowie der Verkehrsdienstebe- Subventionen für Projekte von landesweitem Interesse richt zuhanden des Landtags verabschiedet. Der Landtag Ab dem Berichtsjahr werden Landessubventionen nur genehmigte im Berichtsjahr einen Ergänzungs- und Nach- noch für Projekte von landesweitem Interesse ausge- tragskredit für den Umbau der Landstrasse Schaan inner- richtet. Dementsprechend wurden Subventionen für den orts, Bereich Steckergasse bis Lindenkreuzung. Ferner Ersatzbau Tagesschule des HPZ in Schaan sowie die unterbreitete die Regierung dem Landtag einen Verpflich- Liechtensteinische Alters- und Krankenhilfe (LAK) für tungskredit für den Ersatzbau des ehemaligen Internat- den Neubau Haus St. Martin Eschen und Haus St. Ma- trakts (Trakt G) beim Schulzentrum Mühleholz I in Vaduz. mertus Triesen -

Blick in Die Geschichte Der Gemeinde Schellenberg Diese Broschüre
Blick in die Geschichte der Gemeinde Schellenberg Diese Broschüre ... ... will in kurzer Form einen Überblick zur Geschichte und Gegenwart der Ge- meinde Schellenberg geben. Weiterfüh- rende Literatur ist in den Anmerkungen und am Schluss angeführt. Abbildungen Titelseite: Biedermannhaus Kapelle St. Georg Pfarrkirche Unbeflecktes Herz Mariä Mittelschellenberg Alle Fotos Gemeinde Schellenberg Diese Seite rechts: Die Herren von Schellenberg in der Zür- cher Wappenrolle von 1340 – Vorbild für das moderne Gemeindewappen. Quelle: http://ladyivanor.knownworldweb.com/zr oadt2v.htm Abbildungen im Text: Die Federzeichnungen stammen von Edmund Schwerzler (1912-2004), Feld- kirch. Übrige Abbildungen wie angege- Impressum ben. Alfred Goop Verwendete Abkürzungen Die Gemeinde Schellenberg Schellenberg 2005 GASb Gemeindearchiv Schellenberg Copyright 2005 Alfred Goop, Ge- Jh./Jhs. Jahrhundert/Jahrhunderts meinde Schellenberg. Alle Rechte vor- behalten. JBL Jahrbuch des Historischen Ver- eins für das Fürstentum Liechten- Herausgeber / Bezugsquelle stein 1(1901) bis 103 (2004). Gemeindeverwaltung LUB I Liechtensteiner Urkundenbuch. Dorf 49 Teil I: Von den Anfängen bis zum 9488 Schellenberg / Liechtenstein Tod von Bischof Hartmann von Tel. +423 / 399 20 30 Werdenberg-Sargans-Vaduz Fax +423 / 399 20 39 1416. 6 Bände. – Vaduz 1948 – E-Mail: [email protected] 1996. Web: www.schellenberg.li 2 Die Gemeinde Schellenberg Nach der letzten Eiszeit – sie ging erst vor rund 10'000 Jahren zu Ende – sie- delten sich an den Hängen und auf den Vielfältige Landschaft Höhen langsam wieder Laubmischwäl- der an. Aber die Humusdecke ist überall Die Gemeinde Schellenberg ist mit 355 nur dünn. Hektaren die flächenmässig kleinste Gemeinde im Fürstentum Liechtenstein. Die Höhenlage des Gemeindegebietes differiert zwischen 430 Metern über Meer im Schellenberger Riet und 698 Metern am höchsten Punkt am Ganten- stein. -

LBV Jahresbericht 2013
JAHRESBERICHT VERBANDSJAHR 2013 Jubilarenfoto vom 66. Liechtensteiner Verbandsmusikfest in Vaduz Liebe Delegierte, Funktionäre, Musikantinnen und Musikanten Werte Ehrenmitglieder und Jubilare Geschätzte Sponsoren, Gönner und Freunde der Blasmusik Das Jahr des Wechsels im Präsidentenamt liegt nun schon hinter uns. Es war für mich ein Jahr mit vielen Ungewiss- heiten und vielen neuen Erfahrungen. Was kommt da auf mich zu, auf was habe ich mich da eingelassen? Dank dem grossen Verständnis meines Vorgängers mir gegenüber verlief alles aber in sauberen Bahnen. Mit grossem Respekt schaue ich zurück auf die grosse Arbeit von Anton Gerner und verneige mich vor ihm. Auch die Vorstandskollegen mussten sich zuerst an die neue Führung gewöhnen. Nach einer anfänglichen Ein- gewöhnungsphase hat sich das Gremium bald einmal gefunden und machte sich mit viel Freude an die anstehenden Aufgaben. Im vergangenen Verbandsjahr gab es wieder viele Aktivitäten und Aufgaben zu verarbeiten oder neue Aufgaben anzugehen. So stand das grosse Jubiläumsfest anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Harmoniemusik Vaduz auf dem Jahreskalender. Dieses wurde mit dem 66. Verbandsmusikfest gekoppelt und im Städtle von Vaduz gefeiert. Mit 532 Musikantinnen und Musikanten und 244 Jungmusikanten zählt unser Verband zu den grossen Kulturträ- gern in unserem Land. Auch dürfen sich die Vereine über insgesamt 510 Musikschüler freuen, welche mehr oder weniger alle an der Liechtensteinischen Musikschule ausgebildet werden. Ebenso haben wieder viele Jugendliche in den Gruppen Junior, Bronze und Silber die Prüfung zum Jungmusiker-Leistungsabzeichen abgelegt und bestanden. Insgesamt vier Jugendliche haben im Berichtsjahr das JMLA-Abzeichen für ihre tollen Leistungen bei den Prüfungen in Gold erhalten. Die Blasmusik in Liechtenstein erfreut sich weiterhin grosser Beliebtheit. -

Auswahl Von Marc Ospelt Vorwort Von Dr
LIECHTENSTEINISCHE LANDESBIBLIOTHEK 40 JAHRE EINE BEGEGNUNG DER BESONDEREN ART LIECHTENSTEIN WIE ES GESCHRIEBEN STEHT EINE AUSLESE Auswahl von Marc Ospelt Vorwort von Dr. Alois Ospelt © 2001 Liechtensteinische Landesbibliothek Vaduz INHALT VORWORT 4 EINLEITUNG 5 SACHGRUPPEN 6 LIECHTENSTEINISCHE AUSWAHLBIBLIOGRAPHIE 9 REGISTER 137 3 VORWORT Seit 1974 erscheint die Liechtensteinische Bibliographie als Jahresschrift. Sie erfasst die Publikationen zur Landeskunde und die Veröffentlichungen liechtensteinischer Autoren und Verleger. In der Regel handelt es sich bei diesen Titeln auch um Bestände der Landesbibliothek, die den gesetzlichen Auftrag wahrnimmt, liechtensteinisches Schrifttum zu sammeln, aufzubewahren und dem Publikum zugänglich zu machen. Die Zahl der Druckschriften wuchs im Lauf der Jahre zusehends schneller, und die Menge an Information schwoll derart an, dass es immer schwerer wurde den Überblick zu bewahren, und deshalb immer öfter der Wunsch nach Auswahlhilfen geäussert wurde, sei es in Form von Leselisten oder Literaturempfehlungen, sei es in Form von telefonischen Lektürehinweisen durch das Bibliothekspersonal. Der Plan, eine repräsentative Auswahl der wichtigsten Titel vorzulegen, und damit sozusagen einen bibliographischen Führer durch die einzelnen thematischen Bereiche anzubieten, musste einige Jahre wegen Bibliotheksumbau und Einführung eines neuen Bibliothekssystems zurück gestellt werden. Nun ist die Auswahlbibliographie pünktlich zum Jubiläum des vierzigjährigen Bestehens der Liechtensteinischen Landesbibliothek zustande -

2005 07 AFJHM Newsletter (Pdf)
The Newsletter of the American Friends Volume 6, Issue 2 of the Jewish Museum Hohenems, Inc. July 2005 I N TOUCH J ULYJ ULY 2005 2005 A LETTER FROM THE PRESIDENT C LAUDE ROLLIN, ESQ. subject he felt so passion- standing job creating in- ately about, namely, sup- teresting programs and Stephan Rollin porting the Jewish Museum exhibits, giving countless Founder in Hohenems. tours and responding to numerous requests for Claude Rollin, Esq. The Jewish Museum in information and assistance. President Hohenems is one of only Thanks to their tireless Mark Brunner Dear Friends, three Jewish museums in all efforts, many thousands of Vice President of Austria. One of its most people from around the It seems most appropriate important functions is to world have been able to see, Uri Taenzer, Esq. that I am writing this letter educate people, young and hear (and hopefully under- Secretary-Treasurer on Father’s Day since my old, Jewish and non-Jewish, stand), the rich history of father was a founder and about the events of the past the Jews who once lived in Trustees enthusiastic supporter of and how those events may Hohenems. Dr. Robert Amler the American Friends until influence our future. In my Ronald Bernell his death last year. Since I judgment, the museum The heart of the museum is can no longer speak to him, staff, ably led by Dr. Hanno its permanent exhibition, Doris Billes I’ll speak to you about a Loewy, has done an out- (Continued on page 2) Nadia Follman Harvey Gutman N EWS FROM THE MUSEUM James Hirschfeld D R . -

CH-UK-FL Additional Agreement Extending Certain Provisions to Liechtenstein
ADDITIONAL AGREEMENT BETWEEN THE SWISS CONFEDERATION, THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN EXTENDING TO THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN CERTAIN PROVISIONS OF THE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE SWISS CONFEDERATION AND THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND The Swiss Confederation (“Switzerland”), the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (“the United Kingdom”) and the Principality of Liechtenstein (“Liechtenstein”), WHEREAS: (1) Liechtenstein is part of the Swiss customs territory in accordance with the Treaty of 29 March 1923 between the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein incorporating Liechtenstein into the Swiss customs territory (“Customs Treaty”); (2) The Customs Treaty does not confer validity for Liechtenstein on all the provisions of the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation, done at Brussels on 22 July 1972 (“Free Trade Agreement”) and of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products, done at Luxembourg on 21 June 1999 (“Agriculture Agreement”); (3) Protocol No 3 of the Free Trade Agreement provides that Liechtenstein products are deemed to be products of Swiss origin. Article 4 of the Agriculture Agreement provides that the rules of origin applicable under Annexes 1, 2 and 3 shall be as set out in Protocol No 3 of the Free Trade Agreement; (4) The provisions of the Free Trade Agreement and of the Agriculture Agreement