Programmheft
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Private Musiksammlung Archiv CD/DVD
Private Musiksammlung Aktualisierung am: 04.09.15 Archiv CD/DVD - Oper Sortierung nach: in CD - mp3 / DVD - MEGP- Formaten 1. Komponisten 2. Werk-Nummer (op.Zahl etc) TA und TR: Daten sind bei „alne“ vorhanden 3. Aufnahmejahr Auskünfte über Mail [email protected] Diese Datei erreichen Sie unter: T und TR: Daten sind bei „EO“ vorhanden http://www.euro-opera.de/T-TA-TR.pdf Auskünfte über Mail in Kürze auch unter: [email protected] http://www.cloud-de.de/~Alne_Musik/ Haas Haas Die heilige Elisabeth - 1 München Maria Venuti - Wolf Bruno Weil Ch-O - BR 4 Euba - - - - - - - Elmar Schloter, Joseph Haas (1879 - - Orgel - 1960) - Münchener 21.03.2004 - Rundfunkorchester op. 84 - cda403 T- VHS-Audi CD o Haas Die heilige Elisabeth - 1990 München Maria Venuti - Wolf Bruno Weil Ch - 26.11.1990 BR 4 Euba - - - - - - - - 1659,01 Joseph Haas (1879 - - 1960) - Münchner 31.03.2010 - Rundfunkorchester op. 84 - cda1003 T- Dok 409 2 CD 2 Haas Scharlatan - 1997 Prag Vladimir Chmelo - Anda-Louise Israel Yinon O - BR 4 Bogza - Miroslav Svejda - Leo 529,01 Pavel Haas (1899 - - MarianVodicka - Ladislav Mlejnek - 1944) - Orchester der Prager 22.06.1999 - Jan Jezek - - - - Staatsoper Oper 1 - T- VHS-Audio Haas Scharlatan - 2009 Gera Andreas Scheibner - Franziska Rauch - Jens Troester O - 06.03.2009 MDR Figaro Peter-Paul Haller - Konrad 1355,01 Pavel Haas (1899 - - Zorn - - - - - Kay Kuntze - Duncan 1944) - Sarlatán Opernchor und 07.03.2009 - Hayler Philharmonisches Oper 1 - cda1601 T- Dok 124 CD 6 Haas Bluthaus - 2011 Schwetzingen Sarah Wegener - Ruth Hartmann -

Siglswald KUIJKEN KOOR EN ORKEST LA PETITE BANDE DESINGEL MAANDAG 14 DECEMBER 98
SIGlSWALD KUIJKEN KOOR EN ORKEST LA PETITE BANDE SC H üim p'rtjOGENQ TE N 1 ia ; DESINGEL MAANDAG 14 DECEMBER 98 BACH EN HOOGDAGEN DESINGEL SEIZOEN 98-99 . BACH EN HOOGDAGEN Sigiswald Kuijken Koor en Orkest La Petite Bande Schütz en tijdgenoten maandag 14 december 98 Philippe Herreweghe Koor en Orkest Collegium Vocale Bach zondag 24 januari 99 Harry Christophers The Sixteen . Fretwork Buxtehude dinsdag 23 februari 99 Philippe Herreweghe Koor en Orkest Collegium Vocale Bach Dinsdag 25 mei 99 Sigiswald Kuijken . Koor en Orkest La Petite Bande Stéphan Genz tenor (evangelist) Kaspar Förster (1616-1673) Sonata à 7 Johann Stadlmayr (c. 1575-1648) Magnificat super Magnificat Orlandi (Innsbruck, 1641) Johann Hermann Schein (1586-1630) Dialogus "Maria, gegrüsset seist du, Holdselige" Heinrich Schütz (1585-1672) Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehöret (Dresden, 1648) Dietrich Becker (1623-1679) Sonata à 5 ( 1 6 6 8 ) Johann Hermann Schein Herr nun lassest Du Deinen Diener (Leipzig, 1626) Heinrich Schütz Magnificat, SWV 468 Heinrich Schütz Siehe, es erschien der Engel des Herren Joseph im Traum (Dresden, 1650) 4 0 ' ism. Prom Audite Nova inleiding door Koen Uvin . 19.15 uur . Foyer p a u ze begin concert 20.00 uur pauze omstreeks 20.45 uur einde concert omstreeks 21.50 uur Heinrich Schütz Historia der Geburt Jesu Christi, SWV 435 teksten programmaboekje La Petite Bande coördinatie programmaboekje deSingel (Dresden, 1664) druk programmaboekje Tegendruk ("vocaliter et instrumentaliter in die Music versetzet") 40 ' EEN KERSTPROGRAMMA ROND SCHÜTZ Dit programma kwam tot stand in enge samenspraak tussen Sigiswald Kuijken en Jean Tubéry, die met zijn ensemble La Fenice sinds jaren zeer actief in het bij zonder het zeventiende-eeuwse repertoire verkent; Jean Tubéry zal dan ook met enkele van zijn collega's aan deze reeks concerten meewerken. -

Radio 3 Listings for 16 – 22 July 2011 Page 1 of 22 SATURDAY 16 JULY 2011 Lise Daoust (Flute)
Radio 3 Listings for 16 – 22 July 2011 Page 1 of 22 SATURDAY 16 JULY 2011 Lise Daoust (flute) SAT 01:00 Through the Night (b012fvdz) 3:59 AM John Shea presents the second of 2 programmes exploring Dinu Wolf, Hugo (1860-1903) Lipatti as both pianist and composer Italian serenade for string quartet Bartók Quartet 1:01 AM Lipatti, Dinu [1917-1950] 4:06 AM Sonatina for violin and piano (op. 1) (1933) Poot, Marcel (1901-1988) Cristina Anghelescu (violin) Octavian Radoi (piano) A Cheerful Overture for orchestra Belgium Radio and Television Philharmonic Orchestra, 1:16 AM Alexander Rahbari (conductor) Constantinescu, Paul (1909-1963) Free Variations on Byzantium theme for cello and orchestra 4:11 AM Catalin Ilea (cello), Romanian National Radio Orchestra, Carol Scarlatti, Alessandro (1660-1725) Litvin (conductor) Toccata in F major Rinaldo Alessandrini (harpsichord) 1:27 AM Enescu, George [1881-1955] 4:17 AM Sonata for violin and piano no. 2 (Op.6) in F minor Haydn, Joseph (1732-1809) George Enescu (violin) Dinu Lipatti (piano) Concerto for trumpet and orchestra in E flat major Geoffrey Payne (trumpet), Melbourne Symphony Orchestra, 1:49 AM Michael Halasz (conductor) Bach, Johann Sebastian (1685-1750) transcribed by Bartók, Béla (1881-1945) 4:33 AM Sonata VI (BWV.530) in G (BB A-5, c.1929) Bach, Johann Michael (1648-1694) Jan Michiels (piano) Liebster Jesu, hor mein Flehen Maria Zedelius (soprano), David Cordier (alto), Paul Elliott and 2:01 AM Hein Meens (tenors), Michael Schopper (bass), Musica Antiqua Boccherini, Luigi (1743-1805) Koln, Reinhard Goebel (director) Rondeau (Op.28 No.4) David Varema (cello), Heiki Mätlik (guitar) 4:40 AM Verdi, Giuseppe (1813-1901), arr. -

570431-33Bk Semele US 13/5/08 15:51 Page 12
570431-33bk Semele US 13/5/08 15:51 Page 12 Barockorchester Frankfurt The Barockorchester Frankfurt was established in 1986 by Joachim Martini and fellow musicians, in conjunction, in particular, with the work of the Junge Kantorei, with whom it has joined in performances throughout Germany and abroad, notably in Paris, London, Oxford and Amsterdam. At the heart of the repertoire are the oratorios of Handel, although the orchestra also extends its activities to the classical and early romantic periods, in its special attention to the principles of early music performance practice. Violin I Cello Bassoon Timpani Judith Freise Bas van Hengel Jennifer Harris Eckhard Leue HANDEL Christoph Hesse Daniela Wartenberg Hans-Joachim Berg Horn I Lute Seija Teeuwen Viola da gamba Roland Callmar Andrea Baur Freek Borstlap Violin II Horn II Cembalo Franc Polman Double Bass Krisztiàn Kovats Ludger Rémy Semele Malina Mantcheva Jacques van der Meer Salma Sadek Trumpet I Cembalo / Organ Bettina Ecken Oboe I Roland Callmar Rien Voskuilen (Secular Oratorio) Simone Stultiens Viola Trumpet II Sabine Dziewior Oboe II Krisztiàn Kovats Dymitr Olszewski Mario Topper Scholl • Schmidt Junge Kantorei Popken • Schwarz The Junge Kantorei was established in 1965 by Joachim Carlos Martini for the Evangelical Church of Hess and Nassau. The choir has since then won a reputation for its many performances of music from the Baroque to the Markert • Schoch contemporary and has enjoyed a happy collaboration with the Frankfurt Baroque Orchestra. The choir schedule has brought regular participation in festivals of major regional importance, notably the Whit celebrations at Kloster Mertens Eberbach im Rheingau and in the church of St Peter in Heidelberg. -
Deutsche Nationalbibliografie 2015 T 02
Deutsche Nationalbibliografie Reihe T Musiktonträgerverzeichnis Monatliches Verzeichnis Jahrgang: 2015 T 02 Stand: 18. Februar 2015 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2015 ISSN 1613-8945 urn:nbn:de:101-ReiheT02_2015-4 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. Die Titelanzeigen der Musiktonträger in Reihe T sind, wie sche Katalogisierung von Ausgaben musikalischer Wer- auf der Sachgruppenübersicht angegeben, entsprechend ke (RAK-Musik)“ unter Einbeziehung der „International der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC) gegliedert, wo- Standard Bibliographic Description for Printed Music – bei tiefere Ebenen mit bis zu sechs Stellen berücksichtigt ISBD (PM)“ zugrunde. -
Radio 3 Listings for 21 – 27 January 2012 Page
Radio 3 Listings for 21 – 27 January 2012 Page 1 of 10 SATURDAY 21 JANUARY 2012 Wolf, Hugo (1860-1903) Early music issues whilst featuring some of his many Italian Serenade for string quartet recordings, including music by JS Bach, Louis Couperin, and SAT 01:00 Through the Night (b0197660) Ljubljana String Quartet Sweelinck. This is the last interview that Gustav Leonhardt gave Trio Wanderer perform music by Haydn and Mendelssohn. to the BBC. Presented by Susan Sharpe 5:17 AM Tailleferre, Germaine (1892-1983) 1:01 AM Sonata for harp SAT 14:00 Radio 3 Lunchtime Concert (b0195q8y) Haydn, (Franz) Joseph [1732-1809] Godelieve Schrama (harp) Hanno Muller-Brachmann, Hendrik Heilman Trio for keyboard and strings (H.15.27) in C major Trio Wanderer 5:28 AM Live from Wigmore Hall, London. Bass-baritone Hanno Müller- Vivaldi, Antonio (1678-1741) Brachmann and pianst Hendrik Heilman perform music by 1:17 AM Kyrie eleison in G minor for double choir and orchestra Schubert, Brahms and Schumann - all settings of poetry by Mendelssohn, Felix [1809-1847] (RV.587) Heine. Trio for piano and strings no. 1 (Op.49) in D minor Choir of Latvian Radio, Riga Chamber Players, Sigvards Klava Trio Wanderer (conductor) Heinrich Heine inspired several of the greatest song-composers to write some of their most personal music. This recital includes 1:44 AM 5:38 AM settings of Heine that Schubert made and which were included Haydn, (Franz) Joseph [1732-1809] Chopin, Frédéric (1810-1849) in the collection of songs published after his death as his Trio for keyboard and strings (H.15.14) in A flat major Scherzo no.4 in E major 'swansong' - Schwanengesang. -

„Auf, Auf! Mein Herz Mit Freuden“ Gesine Adler Sopran Gotthold Schwarz Bass Hartmut Becker Violoncello Michaela Hasselt Orgel
Sonntag, 17. Mai 2015 „Auf, auf! mein Herz mit Freuden“ Gesine Adler Sopran Gotthold Schwarz Bass Hartmut Becker Violoncello Michaela Hasselt Orgel Das Programm Heinrich Schütz (1585-1672) „O lieber Herre Gott, wecke uns auf“ aus „Kleine Geistliche Konzerte“, Leipzig 1636, Opus 8, SWV 287 für zwei Singstimmen und Basso continuo Lieber Herre Gott, wecke uns auf, dass wir bereit sein, wenn Dein Sohn kömmt, ihn mit Freuden zu empfahen und Dir mit reinem Herzen zu dienen, durch denselbigen, Dei- nen lieben Sohn Jesum Christum, unsern Herren. Amen. (Vorreformatorisches Adventsgebet, wahrscheinlich 1533 von Martin Luther ins Deutsche übertragen) „Eins bitte ich vom Herren“ aus „Kleine Geistliche Konzerte“ SWV 294 für zwei Singstimmen und Basso continuo Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern: dass ich im Hause des Herrn bleiben möge mein Leben lang, zu schau- en die schönen Gottesdienste des Herren und seinen Tem- pel zu besuchen. (Psalm 27, 4) Johann Sebastian Bach (1685-1750) Lieder aus „Schemellis Gesangbuch“ für Singstimme und Basso continuo: „Die güldne Sonne voll Freud und Wonne“ BWV 451 „Selig! Wer an Jesum denkt“ BWV 498 „Auf, auf! mein Herz mit Freuden“ BWV 441 Präludium und Fuge Es-Dur BWV 852 aus: „Das Wohltemperierte Klavier“ Heinrich Schütz „Der Herr schauet vom Himmel“ aus „Kleine Geistliche Konzerte“ SWV 292 für Sopran, Bass und Basso continuo Der Herr schauet vom Himmel auf der Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig, da ist kei- ner, der Gutes tu, auch nicht einer. (Psalm 14, 2+3) Johann Sebastian Bach aus „Schemellis Gesangbuch“ für Singstimme und Basso continuo : „Eins ist not! ach Herr, dies eine“ BWV 453 „Vergiß mein nicht, mein allerliebster Gott“ BWV 505 „Was bist du doch, o Seele, so betrübet“ BWV 506 Heinrich Schütz „Erhöre mich, wenn ich rufe“ aus „Kleine Geistliche Konzerrte“ SWV 289 für zwei Singstimmen und Basso continuo Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott, meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst. -
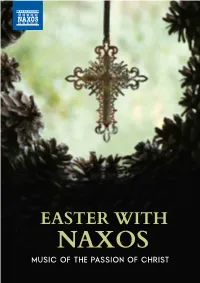
EASTER with NAXOS MUSIC of the PASSION of CHRIST Easter with Naxos
EASTER WITH NAXOS MUSIC OF THE PASSION OF CHRIST Easter with Naxos The events of Christ’s Passion have been marked in artistic triumphs over the centuries, not least in music which has a treasure trove of works devoted to the sequence of the action. Just as the Easter story moves from darkness to light, so the works describing it represent the full spectrum of genres and resources. In this catalogue – which also includes titles from Naxos’ affiliated labels – you’ll find masterpieces representative of all musical styles: from Bach’s Passion settings to the Requiems of Mozart, Dvořák and Verdi, plus the more contemporary utterances of works. You’ll also see recordings of instrumental music, such as Messiaen’s L’Ascension, Gubaidulina’s Sieben Worte, and Haydn’s Seven Last Words in its piano version. CONTENTS Naxos Titles Listing by Composer...................................................................................................3 Collections ................................................................................................................15 Audiovisual Products ................................................................................................16 Affiliated Labels Belvedere .................................................................................................................17 Capriccio ..................................................................................................................18 Dynamic ...................................................................................................................23 -

Mai Mai Mai Juni
MAI MAI MAI Sonntag, 17. Mai 2009, 19:30 Uhr Schlosskirche Johannisberg Samstag, 2. Mai 2009, 19:30 Uhr Samstag, 16. Mai 2009, 19:30 Uhr Joseph Haydn: Die Schöpfung Evangelische Christuskirche Schlangenbad Rheingauer Dom in Geisenheim Elisabeth Scholl, Sopran; Daniel Sans, Tenor; Schlangenbader Abendmusik 2009 Joseph Haydn: Die Schöpfung Andreas Pruys, Bass; Ensemble Glob'Arte Hans Uwe Hielscher, Orgel Elisabeth Scholl, Sopran; Daniel Sans, Tenor; Andreas Pruys, Bass; Ensemble Glob'Arte Neue Rheingauer Kantorei Neue Rheingauer Kantorei Leitung: Tassilo Schlenther Leitung: Tassilo Schlenther Vorverkauf bei: Samstag, 9. Mai 2009, 17:30 Uhr Vorverkauf bei: Buchhandlung Untiedt in Geisenheim & Eltville, Ev. Kirche St. Peter auf dem Berg, Bleidenstadt Buchhandlung Untiedt in Geisenheim & Eltville, Buchhandlung Idstein in Oestrich. Karten zu zu Bläserkonzert „Volles Blech und zarte Töne“ Buchhandlung Idstein in Oestrich. Karten zu zu 17.- im VVK, Abendkasse 20.-, Karten für Schüler Bläserkonzert „Volles Blech und zarte Töne“ mit 17.- im VVK, Abendkasse 20.-, Karten für Schüler und Studenten 12 .- (nur an der Abendkasse) gottesdienstlichem Rahmen zum fünfjährigen und Studenten 12 .- (nur an der Abendkasse) Jubiläum. Unser Posaunenchor Bleidenstadt und Born- Sonntag, 17. Mai 2009, 18:00 Uhr Watzhahn (unter der Leitung von Pfarrerin Ilka Ev. Kirche Wehen Friedrich) lädt Sie ein zum Mitfeiern einer kleinen JUNI Musikalischer Abendgottesdienst musikalischen Reise durch die ersten fünf Jahre: Felix Mendelssohn Bartholdy: Choralkantate "Wer Vom Bachchoral zur jazzigen Verkündigung und nur den lieben Gott lässt walten" imposanten Doppelchören. Besonders freuen wir Samstag, 6. Juni 2009, 19:30 Uhr Abschluss des offenen Chorprojekts 2009 der uns wieder auf das Zusammenspiel und die Evangelische Christuskirche Schlangenbad Ev. -
PROGRAMM Oktober 2018 – März 2019 KARTEN Soweit Nicht Anders Angegeben, Ist Der Eintritt Zu Allen Veranstaltungen Frei
PROGRAMM Oktober 2018 – März 2019 KARTEN Soweit nicht anders angegeben, ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen frei. Bei entsprechend gekennzeichneten Veranstaltungen reservieren Sie bitte online Ihre Plätze über www.veranstaltungen.hfm-mainz.de. Fragen zu den Veranstaltungen bitte per Mail an [email protected] oder per Telefon 06131/39-28009. WILLKOMMEN AN DER HOCHSCHULE WEITERE INFORMATIONEN FÜR MUSIK MAINZ! Wir schicken Ihnen gerne den monatlichen Newsletter inklusive aller Termine des Monats und weiterer Informationen per E-Mail. Mit jedem Semester entwickelt sich die Hochschule für Musik Anmeldung unter: www.newsletter.hfm-mainz.de spürbar weiter: Phantastische KünstlerInnen und Wissenschaftle- bzw. [email protected] rInnen haben den Ruf nach Mainz angenommen und prägen mit Weitere Informationen finden Sie unter www.hfm-mainz.de. ihren Konzepten unseren Hochschulalltag. Unser Studienangebot vergrößert sich, wir entwickeln neue Konzert- und Vermittlungs- BITTE BEACHTEN SIE formate und freuen uns über die positive Resonanz. Die enga- Alle Veranstaltungen stehen im Zusammenhang mit der künstlerischen Aus- gierte, kreative Atmosphäre ist überall im Haus spürbar. Diesen bildung an der Hochschule für Musik. Deshalb können sich trotz größter Weg wollen wir weiter gehen. Sorgfalt bei der Vorbereitung der Programmübersicht Terminänderungen, Auch das neue Semesterprogramm spiegelt unseren Anspruch -absagen oder auch zusätzliche Veranstaltungen ergeben. Alle Änderungen wider: Gehaltvolle, tiefgründige Werke stehen ebenso auf dem gegenüber diesem Programm werden in unserem Newsletter, in der Tages- Programm wie musikalische Unterhaltung und Leichtigkeit. Das presse und unserem Online-Veranstaltungskalender angezeigt. Festkonzert „Hoffnung…Träume…Visionen“ anlässlich des zehn- (Redaktionsschluss: 31.08.2018) jährigen Jubiläums unseres Hauses wird sicher einer der Höhe- punkte des Semesters. -
Vita Die Sopranistin Elisabeth Scholl Begann Ihre Musikalische Laufbahn Als Erstes Mädchen Im Chor Der Kiedricher Chorbuben. Do
Vita Die Sopranistin Elisabeth Scholl begann ihre musikalische Laufbahn als erstes Mädchen im Chor der Kiedricher Chorbuben . Dort sang sie bereits erstere kleinere Soli (u.a. Vivaldi: Gloria; Bach: Weihnachtsoratorium 1-3). Im Alter von 16 Jahren sang sie den Ersten Knaben in Mozarts Zauberflöte am Hessischen Staatstheater in Wiesbaden und studierte nach dem Abitur zunächst Musikwissenschaft, Anglistik und Kunstgeschichte an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Ihre bei Prof. Eduard Wollitz begonnene Gesangsausbildung ergänzte sie danach durch ein Studium der Alten Musik und historischen Aufführungspraxis an der Schola Cantorum Basiliensis . Sie wurde außerdem für zwei Jahre Mitglied im Basler Opernstudio. An der Schola Cantorum Basiliensis weckte ihr Lehrer René Jacobs ihr Interesse an der Beschäftigung mit unveröffentlichten Musikhandschriften, die sie seither mit großer Begeisterung in Bibliotheken aufspürt, abschreibt und aufführt. Musikwissenschaftliche Forschung und musikalische Praxis miteinander zu verbinden ist ihre große Leidenschaft. Die Aufnahme „Inferno“ mit Kantaten von Alessandro Scarlatti (mit Modo Antiquo und Federico Maria Sardelli) ist ein Ergebnis dieser Arbeit. Nach dem Studium arbeitete Elisabeth Scholl solistisch mit vielen internationalen Ensembles der Alte- Musik-Szene zusammen: Cantus Cölln, Musica Antiqua Köln, Dresdner Kammerchor, Balthasar Neumann-Ensemble, Ensemble Vocal Européen, Tafelmusik Baroque Orchestra, Freiburger Barockorchester, Concerto Köln, Modo Antiquo, … Sie war bei vielen großen europäischen Festivals als Solistin eingeladen (Schleswig-Holstein Musik-Festival, Rheingau Musik Festival, Lufthansa Festival London, Festwochen Luzern, Festival van Vlaanderen, Händel-Festspiele in Halle, Göttingen und Karlsruhe, BBC Proms u.a.) und arbeitet mit Dirigenten wie René Jacobs, Jos van Immerseel, Frieder Bernius, Enoch zu Guttenberg, Bruno Weil, Nicholas McGegan, Sir Neville Marriner uvm. -

Telemann-Diskographie 2010–2020 Mit Zwei Anhängen Für Den Zeitraum 1987–2009
Internationale Telemann-Gesellschaft e. V. Telemann-Diskographie 2010–2020 Mit zwei Anhängen für den Zeitraum 1987–2009 Von Dr. Matthias Hengelbrock, Oldenburg Inhalt Prolegomena . 2 CD-Markt 2010 . 3 CD-Markt 2011 . 7 CD- und DVD-Markt 2012 . 13 CD- und DVD-Markt 2013 . 17 CD-Markt 2014 . 24 CD-Markt 2015 . 28 Tonträgermarkt 2016 . 34 Tonträgermarkt 2017 . 41 Tonträgermarkt 2018 . 53 Tonträgermarkt 2019 . 61 Tonträgermarkt 2020 . 68 Anhang I: Altbestand 1987–2009 der Sammlung Hengelbrock . 73 Anhang II: Tonträgerhinweise der Mitteilungsblätter 1–23 . 121 Version 3.1 vom 28. Dezember 2020 · © 2021 Internationale Telemann-Gesellschaft e. V., Magdeburg Matthias Hengelbrock · Telemann-Diskographie 2010–2020 · Seite 2 von 122 Prolegomena Im Folgenden werden die in den Mitteilungsblättern 24–34 (2010–2020) der Internationalen Te- lemann-Gesellschaft e. V. veröffentlichten Diskographien nacheinander und ggf. korrigiert wie- dergegeben. Die Aufnahmen sind innerhalb der Jahrgänge nach Gattungen absteigend und in- nerhalb einer Gattung nach Tonarten aufsteigend sortiert: • Orchestermusik (TWV 55–50) • Kammermusik mit und ohne Generalbass (TWV 45–40) • Werke für Klavierinstrumente und Laute (TWV 39–30) • Weltliche Vokalmusik (TVWV 25–11) • Geistliche Vokalmusik (TVWV 10–1) Aus praktischen Gründen mussten einige Gattungsbezeichnungen grob verallgemeinert wer- den. So ist z. B. in der Abteilung TWV 41 zumeist nur von Sonaten die Rede, obwohl hier auch Partiten und andere Gattungen des generalbassbegleiteten Instrumentalsolos zu finden sind. Mit der GTIN (Global Trade Item Number, vormals EAN = European Article Number) lassen sich die Produkte sowohl im Fachhandel vor Ort als auch im Internet schnell und eindeutig ausfindig machen. Sofern die GTIN aus nur zwölf Ziffern besteht, muss man bei einigen Such- maschinen noch eine 0 davorsetzen.