Berufsstart Im Öffentlichen Dienst 9
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
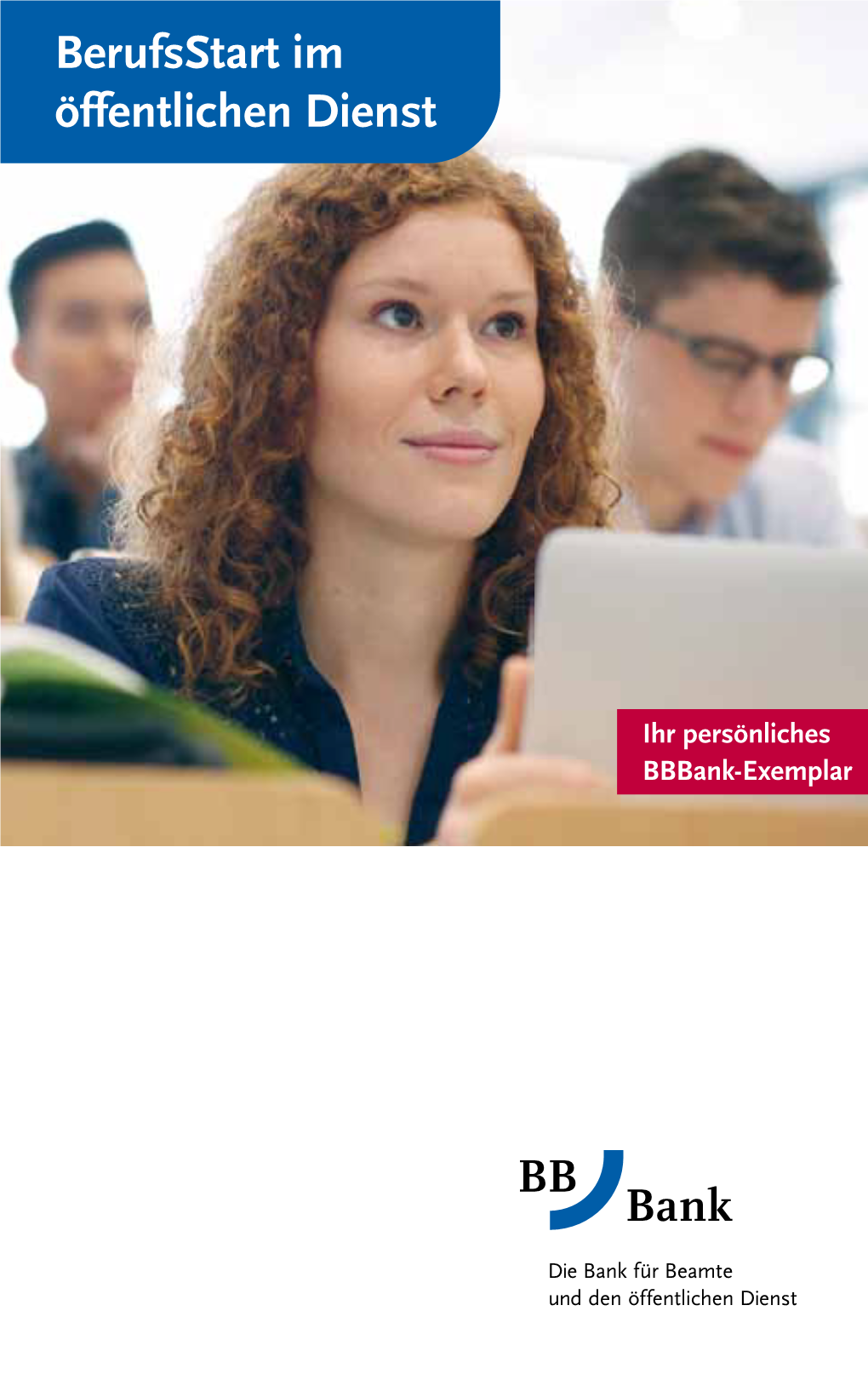
Load more
Recommended publications
-

Fitch Revises Outlooks on German Cooperative Banks and DZ BANK to Stable; Affirms at 'AA-'
01 JUL 2021 Fitch Revises Outlooks on German Cooperative Banks and DZ BANK to Stable; Affirms at 'AA-' Fitch Ratings - Frankfurt am Main - 01 Jul 2021: Fitch Ratings has revised Genossenschaftliche FinanzGruppe (GFG) and the members of its mutual support scheme, including GFG's central institution DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank (DZ BANK) and 814 local cooperative banks, to Stable Outlook from Negative Outlook. Their Long-Term Issuer Default Ratings (IDRs) have been affirmed at 'AA-'. The revisions of the Outlooks reflect our view that the risk of significant deterioration of the operating environment, leading to a durable weakening of GFG's asset quality and profitability, has subsided since our last rating action in August 2020. GFG is not a legal entity but a cooperative banking network whose cohesion is ensured by a mutual support scheme managed by the National Association of German Cooperative Banks (BVR). GFG's IDRs apply to each member bank, in accordance with Annex 4 of Fitch's criteria for rating banking structures backed by mutual support schemes. The ratings are underpinned by the high effectiveness of the scheme given its long and successful record of ensuring GFG's cohesion, monitoring members' risks and enforcing corrective measures when needed. The scheme has effectively protected its members' viability and averted losses for their creditors since its inception. Fitch has also downgraded Deutsche Apotheker- und Aerztebank eG's (apoBank) Long-Term Deposit Rating because we no longer expect the bank's buffer of senior non-preferred and more junior debt to remain sustainably above 10% of risk weighted assets (RWAs) as the bank is not required to maintain resolution debt buffers. -
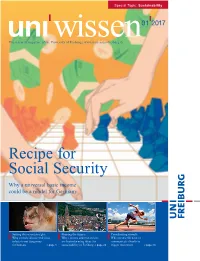
Recipe for Social Security Why a Universal Basic Income Could Be a Model for Germany
Special Topic: Sustainability 01 2017 The research magazine of the University of Freiburg | www.wissen.uni-freiburg.de Recipe for Social Security Why a universal basic income could be a model for Germany Setting the record straight: Shaping the future: Coordinating stimuli: Why a newly discovered virus Why citizens and researchers Why nerve cells have to in bats is not dangerous are brainstorming ideas for communicate closely to for humans > page 8 sustainability in Freiburg > page 20 trigger movement > page 40 01 2017 Bundesweit für Sie da: Mit Direktbank und wachsendem Filialnetz. Contents Research A Model for Human Dignity 4 Karl Justus Bernhard Neumärker’s research suggests that a universal basic income would have a chance in Germany Who’s Afraid of Vampire Flu? 8 1 A newly discovered virus in bats Für mich: das kostenfreie Bezügekonto is not transmittable to humans All at the Same Time 12 1 Voraussetzung: Bezügekonto mit Online-Überweisungen; Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. University of Freiburg psychologists are searching Banken gibt es viele. Aber die BBBank ist die einzige bundesweit tätige genossenschaftliche for strategies to facilitate multitasking Privat kundenbank, die Beamten und Arbeit nehmern des öffentlichen Dienstes einzigartige Angebote macht. Zum Beispiel das Bezügekonto mit kostenfreier Kontoführung.1 Special Topic: Sustainability Informieren Sie sich jetzt über die vielen weiteren Vorteile Ihres neuen Kontos unter An Interdisciplinary Thread 16 Tel. 0 800/40 60 40 160 (kostenfrei) oder www.bezuegekonto.de -
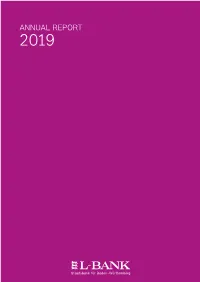
Technology Parks
ANNUAL REPORT 2019 L-Bank in Figures OVERVIEW 2015–2019 in EUR millions 2015 2016 2017 2018 2019 Total assets 73,294.92 75,075.39 70,669.98 69,608.87 77,622.56 Equity 2,765.31 2,814.64 2,865.23 2,963.98 3,013.96 Net interest income1 365.41 368.93 323.41 331.37 302.04 Net income 50.63 49.33 50.59 50.18 49.98 2015 2016 2017 2018 2019 ‘Hard’ Tier I capital ratio (CET1 ratio) 16.38% 18.00% 18.67% 18.59% 20.06% Total capital ratio 19.00% 20.29% 20.73% 20.59% 22.20% Return on equity 10.28% 12.19% 5.44% 6.29% 4.39% Cost-income ratio 42.82% 41.65% 52.39% 44.53% 53.45% Leverage ratio 3.91% 4.37% 4.81% 5.12% 4.86% 2019 Moody’s Standard & Poor’s Rating Aaa AAA 1 Based on business operations. Annual Report 2019 L-Bank 03 A Letter to our Business Partners Dear Business Partners, A good result, important strategic decisions for the future… although 2019 was a chal- lenging year for L-Bank, there were many positive outcomes. We were delighted by the European Parliament’s positive decision, taken on 16 April 2019, to take Germany’s legally independent development banks out of the European Single Supervisory M echanism (SSM). This means that development banks now operate in a more appropriate regulatory envir- onment. Among the important factors influencing the political decision-making process, our objection to banking supervision by the ECB undoubtedly played a part. -

Econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Holst, Elke; Schimeta, Julia Article The German financial sector: Male dominance in top decision-making bodies remains pervasive DIW Economic Bulletin Provided in Cooperation with: German Institute for Economic Research (DIW Berlin) Suggested Citation: Holst, Elke; Schimeta, Julia (2013) : The German financial sector: Male dominance in top decision-making bodies remains pervasive, DIW Economic Bulletin, ISSN 2192-7219, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin, Vol. 3, Iss. 3, pp. 16-24 This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/74670 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von -
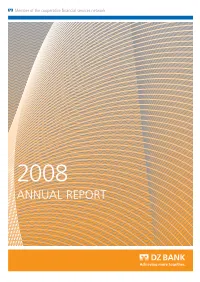
View Annual Report
2008 ANNUAL REPORT DZ BANK GROUP FINANCIAL SERVICES PROVIDER IN THE COOPERATIVE FINANCIAL SERVICES NETWORK 1,200 COOPER DZ BANK BANK BUSINESS SEGMENT RETAIL BUSINESS SEGMENT BUSINESS LINES BUSINESS LINES » Corporate Banking » Asset Management » Investment Banking » Retail & Private Banking » Process Management BRANDS AND MARKET POSITIONS IN GERMANY BRANDS AND MARKET POSITIONS IN GERMANY NO. 51 NO. 3 (RETAIL FUNDS) NO. 2 (EQUIPMENT LEASING)2 NO. 3 (SUBSIDIARIES OF NO. 2 (SUBSIDIARIES OF GERMAN BANKS IN IRELAND)1 GERMAN BANKS IN SWITZERLAND)1 NO. 3 (VOLUME OF NO. 1 (CREDIT PROCESSING) SPECIALIST CONSUMER FINANCE) NO. 1 (PROVIDER OF FOREIGN EXCHANGE AND INTERNATIONAL PAYMENT SERVICES) PRODUCT BRANDS PRODUCT BRANDS NO. 1 (GERMAN MARKET FOR CERTIFICATES) NO. 3 (VOLUME OF SPECIALIST CONSUMER FINANCE) « RATIVE BANKS GROUP DZ BANK Group REAL ESTATE FINANCE BUSINESS SEGMENT INSURANCE BUSINESS SEGMENT BUSINESS LINE BUSINESS LINE » Real Estate Finance » Insurance BRANDS AND MARKET POSITIONS IN GERMANY BRANDS AND MARKET POSITIONS IN GERMANY NO. 1 (HOME SAVINGS)2 NO. 2 (LIFE INSURANCE)2 1 Total assets 2 New business KEY FIGURES DZ BANK GROUP € million 2008 2007 FINANCIAL PERFORMANCE Operating profit/loss1 -929 1,277 Impairment losses on loans and advances -545 -209 Profit/loss before tax -1,472 1,068 Net profit/loss -1,055 897 Cost/income ratio (percent) > 100.0 66.9 FINANCIAL POSITION Assets Loans and advances to banks 70,036 67,531 Loans and advances to customers 117,021 106,307 Financial assets held for trading 114,443 130,025 Investments 66,322 -

Various German Banks Downgraded on Persistent Profitability Challenges and Slow Digitalization Progress
Various German Banks Downgraded On Persistent Profitability Challenges And Slow Digitalization Progress June 24, 2021 - We anticipate that German banks' asset quality and capitalization will likely remain robust, PRIMARY CREDIT ANALYST supported by the German economy's resilience amid the COVID-19 pandemic. Harm Semder Frankfurt - Nevertheless, we believe the pandemic has exacerbated challenges facing the German banking + 49 693 399 9158 sector, and that German banks are now less competitive relative to global peers' due to slow harm.semder progress improving revenue diversification, cost structures, and digitalization. @spglobal.com - As a result, we have downgraded a number of Germany-based, non-government-related banks SECONDARY CONTACTS where our ratings did not already reflect these challenges. Benjamin Heinrich, CFA, FRM Frankfurt FRANKFURT (S&P Global Ratings) June 24, 2021--S&P Global Ratings today said that it has + 49 693 399 9167 lowered by one notch the long-term issuer credit ratings on the following Germany-based banks: benjamin.heinrich @spglobal.com - The Cooperative Banking Sector Germany and its related core members; Giles Edwards - DekaBank Deutsche Girozentrale; London + 44 20 7176 7014 - Core members of S-Finanzgruppe Hessen-Thueringen including Landesbank giles.edwards Hessen-Thueringen Girozentrale (Helaba) and local savings banks; @spglobal.com Markus W Schmaus - Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb); and Frankfurt - Volkswagen Bank GmbH. + 49 693 399 9155 markus.schmaus @spglobal.com In addition, we affirmed our ratings on Commerzbank AG and UniCredit Bank AG with negative outlooks. We also revised the outlook on Hamburg Commercial Bank AG to developing from Heiko Verhaag, CFA, FRM Frankfurt negative, and affirmed the ratings. -

2017 Annual Report and CSR Report
Union Asset Management Holding AG 2017 annual report Group management report 2017 annual report and CSR report 1 Union Asset Management Holding AG 2017 annual report Contents Foreword 5 Consolidated financial statements (IFRS) of Union Asset Management 48 Holding AG for the financial year from 1 January to 31 December 2017 Report of the Supervisory Board 6 Consolidated income statement 48 Statement of comprehensive income 48 Group management report of Union Asset Management Holding AG 10 for the financial year from 1 January to 31 December 2017 Consolidated statement of financial position 49 A Basic information on the group 11 Statement of changes in equity 50 B Economic report 14 Statement of cash flows 51 General economic and industry conditions 14 Notes to the consolidated financial statements 53 Specific business performance 18 Business environment 24 Basis of preparation 53 Research and development 27 [1] Principles of group accounting 53 Dependent company report 30 [2] Accounting policies 53 Position of the company 31 [3] Consolidated group 57 [4] Principles of consolidation 57 C Events after the reporting date 40 [5] Estimates 58 [6] Financial instruments 58 D Corporate governance declaration 40 [7] Fair value measurement of financial instruments 59 [8] Currency translation 60 E Forecast, report on risks and opportunities 41 [9] Cash reserve 60 [10] Receivables 60 Report on opportunities 41 [11] Allowances for losses on loans and receivables 60 Report on risks 41 [12] Investment securities 60 Forecast 45 [13] Shares in companies -

Cooperative Banking Sector Germany
Cooperative Banking Sector Germany Primary Credit Analyst: Heiko Verhaag, CFA, FRM, Frankfurt + 49 693 399 9215; [email protected] Secondary Contacts: Harm Semder, Frankfurt + 49 693 399 9158; [email protected] Claudio Hantzsche, Frankfurt + 49 693 399 9188; [email protected] Table Of Contents Major Rating Factors Outlook Rationale Related Criteria Related Research WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT FEBRUARY 26, 2021 1 Cooperative Banking Sector Germany Major Rating Factors Strengths: Issuer Credit Rating • Mutual support among core group members and a comprehensive protection None scheme. • No. 2 market position in German retail banking. • Strong capitalization from high earnings retention and ownership structure that puts stability over payouts. • Franchise-driven stable deposits and sizable surplus liquidity from local cooperative banks. Weaknesses: • Relatively low risk-adjusted profitability by international standards, with margins under increased pressure due to the lower-for-longer interest rate environment. • German cooperative banks' high cost base, partly attributable to the decentralized network. • Increasing competition and margin pressure, particularly in core products, stemming from big tech companies and digital banks. WWW.STANDARDANDPOORS.COM/RATINGSDIRECT FEBRUARY 26, 2021 2 Cooperative Banking Sector Germany Outlook S&P Global Ratings' negative outlook on the Cooperative Banking Sector Germany, including all core group members, reflects growing economic and industry risks for the German banking market, which the COVID-19 pandemic has accentuated. This puts continued pressure on the sector's risk exposures and risk-adjusted profitability, meaning that we could lower our ratings within the next two years. Downside scenario More specifically, if we revise our anchor for German banks to 'bbb+' from 'a-', we could lower our 'AA-' issuer credit rating (ICR) on the sector's core members, and our related issue ratings on the banks' senior preferred debt, senior subordinated debt, and regulatory capital instruments. -

Wahlliste Für Die Vom Montag, 11.11.2019 – Freitag, 15.11.2019 Stattfindende Vertreter-/Ersatzvertreterwahl (Amtszeit 2020 - 2024) Der Bbbank Eg
Wahlliste für die vom Montag, 11.11.2019 – Freitag, 15.11.2019 stattfindende Vertreter-/Ersatzvertreterwahl (Amtszeit 2020 - 2024) der BBBank eG. Regionaldirektion Karlsruhe Vertreter1 Alexander Hatz, Vertreter Hans-Jürgen Leonhardt, Ersatzvertreter Hans Kudis, 76185 Karlsruhe 76646 Bruchsal 76761 Rülzheim Vertreter Andrea Baschang, Vertreter Jürgen Maisch, Ersatzvertreter Engelbert 76137 Karlsruhe 76275 Ettlingen Landhäußer, 76287 Rheinstetten Vertreter Andreas Höninger, Vertreter Gabriela Merker, Ersatzvertreter Jochen Lehmann, 76189 Karlsruhe 76287 Rheinstetten 76297 Stutensee Vertreter Irmtraud Bach, Vertreter Michael Nakovics, Ersatzvertreter Norbert Meye, 76149 Karlsruhe 76287 Rheinstetten 76467 Bietigheim Vertreter Mechtild Bauer, Vertreter Markus Neher, Ersatzvertreter Robert Milo, 76131 Karlsruhe 76189 Karlsruhe 76149 Karlsruhe Vertreter Michael Bausch, Vertreter Lieselotte Nuber-Kirner, Ersatzvertreter Frank Miltner, 76189 Karlsruhe 76185 Karlsruhe 68766 Hockenheim Vertreter Ralf Biegemeier, Vertreter Günter Rastetter, Ersatzvertreter Winfried Ochs, 76131 Karlsruhe 76316 Malsch 76359 Marxzell Vertreter Ralf Denda, Vertreter Verena Rudolph, Ersatzvertreter Mathias Proner, 76131 Karlsruhe 76287 Rheinstetten 76139 Karlsruhe Vertreter Silke Diringer, Vertreter Eric Schwingen, Ersatzvertreter Frank Radach, 76135 Karlsruhe 76199 Karlsruhe 76344 Eggenstein-Leopoldshafen Vertreter Isabell-Katharin Fischer, Vertreter Elke Sieber, Ersatzvertreter Maria Radach, 76135 Karlsruhe 76187 Karlsruhe 76344 Eggenstein-Leopoldshafen Vertreter Hans-Rudolf -

Neue Europäische Hochschulallianzen
BBBank Inform | Juli 2020 RICHTUNGSWEISEND Zum zehnten Mal: Deutscher Personalräte-Preis Wie das MAGAZIN für Beamtinnen und Beamte berichtet, wird in diesem Jahr bereits zum zehnten Mal der Deutsche Personalräte-Preis verliehen. Nun stehen die Nominierten für das Jahr 2020 fest … Lesen Sie mehr zu diesem Thema WELTOFFEN Neue europäische Hochschulallianzen gefördert – 20 deutsche Hochschulen sind dabei Wie der Präsident der Hochschul- rektorenkonferenz (HRK) mitgeteilt hat, sind 24 weitere von der EU geförderte europäische Hochschul- allianzen hinzugekommen. Prof. Dr. Peter-André Alt gratulierte allen an den ausgewählten euro- päischen Netzwerken beteiligten Hochschulen … Lesen Sie mehr zu diesem Thema ↓ BBBank Inform | Juli 2020 Das junge Girokonto für Berufsstarter.¹ 50,–Euro Startbonus für den öffentlichen Dienst2 www.bbbank.de/termin ¹ Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied ab 18 Jahren. Bis zur Vollendung des 27. Lebens- jahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein Girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro, girocard (Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 Euro p. a.; Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. ² Voraussetzungen: Eröffnung BBBank-Junges Konto zwischen dem 01.07. und dem 31.12.2020, Neumitglied aus dem öffentlichen Dienst ab 16 Jahren bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, Berufsstarter (Beamtenanwärter/Auszubildender), keine Mitgliedschaft in den letzten 6 Monaten. Nicht mit weiteren Prämien kombinierbar. Die Verbuchung des Startbonus kann bis zu 8 Wochen dauern. Extrem flexibel. Auch auf lange Sicht. Ein guter Tipp für alle Berufseinsteiger: das junge Girokonto1 für Berufsstarter im öffentlichen Dienst mit 50,– Euro Startbonus2 und vielen weiteren Vorteilen. Hier geht’s zu den Vorteilen 1 Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied ab 18 Jahren. -
Annual Financial Statements and Management Report of Dz Bank Ag Key Figures
2014 ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS AND MANAGEMENT REPORT OF DZ BANK AG KEY FIGURES DZ BANK AG Dec. 31, Dec. 31, € million 2014 2013 2014 2013 FINANCIAL PERFORMANCE ECONOMIC CAPITAL ADEQUACY AND Operating profit before allowances LIQUIDITY ADEQUACY for losses on loans and advances 573 800 (DZ BANK GROUP) Allowances for losses on loans and Economic capital adequacy (percent) 166.2 158.9 advances -55 -292 Stress scenario with the lowest Operating profit 518 508 minimum liquidity surplus (€ billion) 11.4 13.0 Net income for the year 213 166 Cost / income ratio (percent) 62.2 53.1 REGULATORY CAPITAL ADEQUACY (DZ BANK AG) Dec. 31, Dec. 31, Total capital ratio (percent) 24.9 31.5 2014 2013 Tier 1 capital ratio (percent) 17.8 20.5 NET ASSETS Core Tier 1 capital ratio (percent) 17.8 Assets AVERAGE NUMBER OF EMPLOYEES Loans and advances to banks 80,716 82,695 DURING THE YEAR 4,250 4,111 Loans and advances to customers 22,443 22,634 Bonds and other fixed-income LONG-TERM RATING securities 39,821 39,825 Standard & Poor’s AA- AA- Shares and other variable-yield Moody’s Investors Service A1 A1 securities 66 315 Fitch Ratings A+ A+ Trading assets 45,540 56,652 Other assets 15,598 15,777 Equity and liabilities Deposits from banks 85,388 87,757 Deposits from customers 22,855 29,505 Debt certificates issued including bonds 39,016 34,626 Trading liabilities 37,028 47,245 Other liabilities 11,903 12,304 Equity 7,994 6,461 Total assets / total equity and liabilities 204,184 217,898 Volume of business1 226,813 238,779 1 Total equity and liabilities including contingent liabilities and other obligations. -
List of Supervised Entities (As of 1 January 2018)
List of supervised entities Cut-off date for significance decisions: 1 January 2018 Number of significant supervised entities: 118 This list displays the significant (part A) and less significant credit institutions (part B) which are supervised entities. The list is compiled on the basis of significance decisions adopted and notified by the ECB that refer to events that became effective up to the cut-off date. A. List of significant supervised entities Belgium 1 Investeringsmaatschappij Argenta nv Size (total assets EUR 30 - 50 bn) Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv Belgium Argenta Spaarbank NV Belgium 2 AXA Bank Belgium SA Size (total assets EUR 30-50 bn) (**) AXA Bank Europe SCF France 3 Banque Degroof Petercam SA Significant cross-border assets Banque Degroof Petercam France S.A. France Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. Luxembourg Bank Degroof Petercam Spain, S.A. Spain 4 Belfius Banque S.A. Size (total assets EUR 150-300 bn) 5 Dexia SA Size (total assets EUR 150-300 bn) Dexia Crédit Local France Dexia Kommunalbank Deutschland AG Germany Dexia Crediop S.p.A. Italy 6 KBC Group N.V. Size (total assets EUR 150-300 bn) KBC Bank N.V. Belgium CBC Banque SA Belgium KBC Bank Ireland plc Ireland Československá obchodná banka, a.s. Slovakia ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. Slovakia 7 The Bank of New York Mellon S.A. Size (total assets EUR 30-50 bn) Germany 8 Aareal Bank AG Size (total assets EUR 30-50 bn) 9 Barclays Bank PLC Frankfurt Branch Size (total assets EUR 30-50 bn) 10 Bayerische Landesbank Size (total assets EUR 150-300 bn) Deutsche Kreditbank Aktiengesellschaft Germany 11 COMMERZBANK Aktiengesellschaft Size (total assets EUR 300-500 bn) European Bank for Financial Services GmbH (ebase) Germany comdirect bank AG Germany Commerzbank Finance & Covered Bond S.A.