Der Kosovo-Krieg Und Seine Internationale Dimension
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

1) ATQ Summer 2004
CONTENTS… Association News Chairman’s Comments......................................................................... 2 President’s Message ............................................................................... 3 AIRLIFT TANKER QUARTERLY Volume 12 • Number 3 • Summer 2004 Secretary’s Notes ................................................................................... 3 Airlift/Tanker Quarterly is published four times a year by the Airlift/Tanker Association, Col. Barry F. Creighton, USAF (Ret.), Secretary, Association Round-Up .......................................................................... 4 1708 Cavelletti Court, Virginia Beach, VA 23454. (757) 838-3037. Postage paid at Belleville, Illinois. Subscription rate: $30.00 per year. Change of address requires four weeks notice. Cover Story The Airlift/Tanker Association is a non-profit professional organization dedicated to providing a forum for people interested in improving the AMC: 12 Years of Excellence ......................................................... 6-17 capability of U.S. air mobility forces. Membership in the Airlift/Tanker Association is $30 annually A New Era in American Air Power Began on 1 June 1992 or $85 for three years. Full-time student membership is $10 per year. Life membership is $400. Corporate membership includes five individual memberships and is $1200 per year. Membership dues include a subscription to Departments Airlift/Tanker Quarterly, and are subject to change. Airlift/Tanker Quarterly is published for the use of the officers, -

Civil-Military Cooperation
NL-ARMS Netherlands Annual Review of Military Studies 2002 M.T.I. Bollen R.V. Janssens H.F.M. Kirkels J.L.M. Soeters [eds.] Civil-Military Cooperation A Marriage of Reason The image on the cover of this edition of NL-ARMS is a fragment from The Marriage Contract (about 1743), the first of a series of satirical paintings about the upper echelons of society, called ‘Marriage A-la Mode’, by William Hogarth (1697-1764). The lack of mutual attraction, or even interest, by the prospective bride and groom, back to back almost, is apparent. NL-ARMS is published under the auspices of the Dean of the Royal Netherlands Military Academy. For more information about NL-ARMS and/or additional copies contact the editors, or the Academy Research Centre of the Royal NL Military Academy (KMA), at the address below: Royal Netherlands Military Academy (KMA) - Academy Research Centre P.O. Box 90.002 4800 PA Breda phone: +31 76.5273319 fax: +31 76.5273322 NL-ARMS 1997 The Bosnian Experience - J.L.M. Soeters, J.H. Rovers [eds.] 1998 The Commander’s Responsibility in Difficult Circumstances - A.L.W. Vogelaar, K.F. Muusse, J.H. Rovers [eds.] 1999 Information Operations - J.M.J. Bosch, H.A.M. Luiijf, A.R. Mollema [eds.] 2000 Information in Context - H.P.M. Jägers, H.F.M. Kirkels, M.V. Metselaar, G.C.A. Steenbakkers [eds.] 2001 issued together with Volume 2000 2002 Civil-Military Cooperation: A Marriage of Reason - M.T.I. Bollen, R.V. Janssens, H.F.M. Kirkels, J.L.M. -

Yugoslav Destruction After the Cold War
STASIS AMONG POWERS: YUGOSLAV DESTRUCTION AFTER THE COLD WAR A dissertation presented by Mladen Stevan Mrdalj to The Department of Political Science In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the field of Political Science Northeastern University Boston, Massachusetts December 2015 STASIS AMONG POWERS: YUGOSLAV DESTRUCTION AFTER THE COLD WAR by Mladen Stevan Mrdalj ABSTRACT OF DISSERTATION Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Political Science in the College of Social Sciences and Humanities of Northeastern University December 2015 2 Abstract This research investigates the causes of Yugoslavia’s violent destruction in the 1990’s. It builds its argument on the interaction of international and domestic factors. In doing so, it details the origins of Yugoslav ideology as a fluid concept rooted in the early 19th century Croatian national movement. Tracing the evolving nationalist competition among Serbs and Croats, it demonstrates inherent contradictions of the Yugoslav project. These contradictions resulted in ethnic outbidding among Croatian nationalists and communists against the perceived Serbian hegemony. This dynamic drove the gradual erosion of Yugoslav state capacity during Cold War. The end of Cold War coincided with the height of internal Yugoslav conflict. Managing the collapse of Soviet Union and communism imposed both strategic and normative imperatives on the Western allies. These imperatives largely determined external policy toward Yugoslavia. They incentivized and inhibited domestic actors in pursuit of their goals. The result was the collapse of the country with varying degrees of violence. The findings support further research on international causes of civil wars. -

European Force Structures Papers Presented at a Seminar Held in Paris on 27 & 28 May 1999
OCCASIONAL PAPERS 8 EUROPEAN FORCE STRUCTURES PAPERS PRESENTED AT A SEMINAR HELD IN PARIS ON 27 & 28 MAY 1999 Timothy Garden, Kees Homan, Stuart Johnson, Jofi Joseph, Adam Daniel Rotfeld, Bryan Wells Edited by Gordon Wilson INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES - WESTERN EUROPEAN UNION INSTITUT D’ETUDES DE SECURITE - UNION DE L’EUROPE OCCIDENTALE 43 AVENUE DU PRESIDENT WILSON, 75775 PARIS CEDEX 16 August 1999 OCCASIONAL PAPERS 8 European force structures Papers presented at a seminar held in Paris on 27 & 28 May 1999 Edited by Gordon Wilson THE INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES WESTERN EUROPEAN UNION 43 AVE DU PRESIDENT WILSON, 75775 PARIS CEDEX 16 August 1999 Occasional Papers are essays that, while not necessarily authoritative or exhaustive, the Institute considers should be made available, as a contribution to the debate on topical European security issues. They will normally be based on work carried out by researchers granted awards by the Institute; they represent the views of the authors, and do not necessarily reflect those of the Institute or of the WEU in general. Publications of Occasional Papers will be announced in the Institute’s Newsletter, and they will be available on request, in the language used by the author. EUROPEAN FORCE STRUCTURES Papers presented at a seminar held in Paris on 27 & 28 May 1999 Timothy Garden, Robert Grant, Kees Homan, Stuart Johnson & Jofi Joseph, Franz-Josef Meiers, Adam Daniel Rotfeld, Bryan Wells and Gordon Wilson Edited by Gordon Wilson Contents Preface iii The need for an increased European defence -
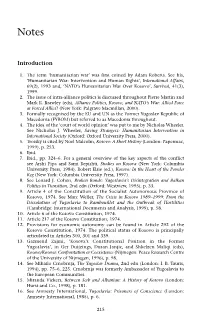
Introduction
Notes Introduction 1. The term ‘humanitarian war’ was first coined by Adam Roberts. See his, ‘Humanitarian War: Intervention and Human Rights’, International Affairs, 69(2), 1993 and, ‘NATO’s Humanitarian War Over Kosovo’, Survival, 41(3), 1999. 2. The issue of intra-alliance politics is discussed throughout Pierre Martin and Mark R. Brawley (eds), Alliance Politics, Kosovo, and NATO’s War: Allied Force or Forced Allies? (New York: Palgrave Macmillan, 2000). 3. Formally recognised by the EU and UN as the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM) but referred to as Macedonia throughout. 4. The idea of the ‘court of world opinion’ was put to me by Nicholas Wheeler. See Nicholas J. Wheeler, Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society (Oxford: Oxford University Press, 2000). 5. Trotsky is cited by Noel Malcolm, Kosovo: A Short History (London: Papermac, 1999), p. 253. 6. Ibid. 7. Ibid., pp. 324–6. For a general overview of the key aspects of the conflict see Arshi Pipa and Sami Repishti, Studies on Kosova (New York: Columbia University Press, 1984), Robert Elsie (ed.), Kosovo: In the Heart of the Powder Keg (New York: Columbia University Press, 1997). 8. See Lenard J. Cohen, Broken Bonds: Yugoslavia’s Disintegration and Balkan Politics in Transition, 2nd edn (Oxford: Westview, 1995), p. 33. 9. Article 4 of the Constitution of the Socialist Autonomous Province of Kosovo, 1974. See Marc Weller, The Crisis in Kosovo 1989–1999: From the Dissolution of Yugoslavia to Rambouillet and the Outbreak of Hostilities (Cambridge: International Documents and Analysis, 1999), p. 58. 10. Article 6 of the Kosovo Constitution, 1974. -

BY ORDER of the SECRETARY of the AIR FORCE AIR FORCE INSTRUCTION 36-2803 18 DECEMBER 2013 Personnel the AIR FORCE MILITARY AWAR
BY ORDER OF THE AIR FORCE INSTRUCTION 36-2803 SECRETARY OF THE AIR FORCE 18 DECEMBER 2013 Personnel THE AIR FORCE MILITARY AWARDS AND DECORATIONS PROGRAM COMPLIANCE WITH THIS PUBLICATION IS MANDATORY ACCESSIBILITY: Publication and forms are available for downloading or ordering on e-Publishing website at: http://www.e-publishing.af.mil. RELEASABILITY: There are no releasibility restrictions on this publication. OPR: AFPC/DPSIDR Certified by: AF/A1S (Col Patrick J. Doherty) Supersedes: AFI36-2803, 15 June 2001 Pages: 235 This instruction implements the requirements of Department of Defense (DoD) Instruction (DoDI) 1348.33, Military Awards Program, and Air Force Policy Directive (AFPD) 36-28, Awards and Decorations Program. It provides Department of the Air Force policy, criteria, and administrative instructions concerning individual military decorations, service and campaign medals, and unit decorations. It prescribes the policies and procedures concerning United States Air Force awards to foreign military personnel and foreign decorations to United States Air Force personnel. This instruction applies to all Active Duty Air Force, Air Force Reserve (AFR), and Air National Guard (ANG) personnel and units. In collaboration with the Chief of Air Force Reserve (HQ USAF/RE) and the Director of the Air National Guard (NGB/CF), the Deputy Chief of Staff for Manpower, Personnel, and Services (HQ USAF/A1) develops policy for the Military Awards and Decorations Program. The use of Reserve Component noted in certain chapters of this Air Force Instruction (AFI) refers to the ANG and AFR personnel. Refer recommended changes and questions about this publication to the Office of Primary Responsibility (OPR) using the AF Form 847, Recommendation for Change of Publication; route AF Form 847s from the field through the Major Command (MAJCOM) publications/forms managers. -

For Ever Croatia
The Number 143 COURIERNewsletter of the OSCE Office in Zagreb March/April 2009 For Ever Croatia - OSCE Parliamentary Assembly - HoO in Vienna - NATO entry celebration - Meeting in the MoJ and NGOs report on war crimes procedures - HoO meets Zagreb County Court President - Interview with Kristijan Turkalj, Head of Department for European Union and Human Rights, Ministry of Justice - South Eastern Europe Regional Heads of Missions Meeting - Farewell reception for Ambassador Fuentes Words by the Head of Office: For ever Croatia ne always has an impression States, from the U.S. and Canada to Russia, age, to our landlords, to the owners of res- that the moment to go, to say Uzbekistan and Japan. Most of them Croa- taurants and cafes that we frequent, to the “see you later”, is something tian citizens, with cultural backgrounds de- waiters, to the merchants, to the box office that only happens to others, rived from almost all the existing national clerks of concert halls, of theatres and cin- Othat one is going to remain here forever. But, minorities in the country, all united in the emas, to the anonymous citizen we pass by naturally, it cannot be like that, and on 10 common effort to propel the country on its in the street. May 2009, four years after arriving in Croa- path towards democratic progress that fa- tia, after a great many activities inside and cilitates its Euro-Atlantic integration. A thank you to Cardinal Bozanić, to the outside the country, aiming to support the Archbishops and Bishops, to the clergy, to the country on its path to democratization, I am Gratitude above all to the Government and novices and sacristans with whom I felt like returning to the Spanish diplomatic service the people of Croatia. -

Disjointed War: Military Operations in Kosovo, 1999
Disjointed War Military Operations in Kosovo, 1999 Bruce R. Nardulli, Walter L. Perry, Bruce Pirnie John Gordon IV, John G. McGinn Prepared for the United States Army Approved for public release; distribution unlimited R Arroyo Center The research described in this report was sponsored by the United States Army under contract number DASW01-01-C-0003. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Disjointed war : military operations in Kosovo, 1999 / Bruce R. Nardulli ... [et al.]. p. cm. “MR-1406.” Includes bibliographical references. ISBN 0-8330-3096-5 1. Kosovo (Serbia)—History—Civil War, 1998—Campaigns. 2. North Atlantic Treaty Organization—Armed Forces—Yugoslavia. I. Nardulli, Bruce R. DR2087.5 .D57 2002 949.703—dc21 2002024817 Cover photos courtesy of U.S. Air Force Link (B2) at www.af.mil, and NATO Media Library (Round table Meeting) at www.nato.int. RAND is a nonprofit institution that helps improve policy and decisionmaking through research and analysis. RAND® is a registered trademark. RAND’s publications do not necessarily reflect the opinions or policies of its research sponsors. Cover design by Stephen Bloodsworth © Copyright 2002 RAND All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means (including photocopying, recording, or information storage and retrieval) without permission in writing from RAND. Published 2002 by RAND 1700 Main Street, P.O. Box 2138, Santa Monica, CA 90407-2138 1200 South Hayes Street, Arlington, VA 22202-5050 201 North Craig Street, Suite 102, Pittsburgh, PA 15213 RAND URL: http://www.rand.org/ To order RAND documents or to obtain additional information, contact Distribution Services: Telephone: (310) 451-7002; Fax: (310) 451-6915; Email: [email protected] PREFACE Following the 1999 Kosovo conflict, the Army asked RAND Arroyo Center to prepare an authoritative and detailed account of military operations with a focus on ground operations, especially Task Force Hawk. -

War in the Balkans, 1991-2002
WAR IN THE BALKANS, 1991-2002 R. Craig Nation August 2003 ***** The views expressed in this report are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of the Department of the Army, the Department of Defense, or the U.S. Government. This report is cleared for public release; distribution is unlimited. ***** Comments pertaining to this report are invited and should be forwarded to: Director, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 122 Forbes Ave., Carlisle, PA 17013-5244. Copies of this report may be obtained from the Publications Office by calling (717) 245-4133, FAX (717) 245-3820, or be e-mail at [email protected] ***** Most 1993, 1994, and all later Strategic Studies Institute (SSI) monographs are available on the SSI Homepage for electronic dissemination. SSI’s Homepage address is: http://www.carlisle.army.mil/ssi/ ***** The Strategic Studies Institute publishes a monthly e-mail newsletter to update the national security community on the research of our analysts, recent and forthcoming publications, and upcoming conferences sponsored by the Institute. Each newsletter also provides a strategic commentary by one of our research analysts. If you are interested in receiving this newsletter, please let us know by e-mail at [email protected] or by calling (717) 245-3133. ISBN 1-58487-134-2 ii CONTENTS Foreword . v Preface . vii Map of the Balkan Region. viii 1. The Balkan Region in World Politics . 1 2. The Balkans in the Short 20th Century . 43 3. The State of War: Slovenia and Croatia, 1991-92. -

A History of Yugoslavia Marie-Janine Calic
Purdue University Purdue e-Pubs Purdue University Press Book Previews Purdue University Press 2-2019 A History of Yugoslavia Marie-Janine Calic Follow this and additional works at: https://docs.lib.purdue.edu/purduepress_previews Part of the European History Commons Recommended Citation Calic, Marie-Janine, "A History of Yugoslavia" (2019). Purdue University Press Book Previews. 24. https://docs.lib.purdue.edu/purduepress_previews/24 This document has been made available through Purdue e-Pubs, a service of the Purdue University Libraries. Please contact [email protected] for additional information. A History of Yugoslavia Central European Studies Charles W. Ingrao, founding editor Paul Hanebrink, editor Maureen Healy, editor Howard Louthan, editor Dominique Reill, editor Daniel L. Unowsky, editor A History of Yugoslavia Marie-Janine Calic Translated by Dona Geyer Purdue University Press ♦ West Lafayette, Indiana Copyright 2019 by Purdue University. Printed in the United States of America. Cataloging-in-Publication data is on file at the Library of Congress. Paperback ISBN: 978-1-55753-838-3 ePub: ISBN 978-1-61249-564-4 ePDF ISBN: 978-1-61249-563-7 An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libraries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high-quality books Open Access for the public good. The Open Access ISBN for this book is 978-1-55753-849-9. Originally published in German as Geschichte Jugoslawiens im 20. Jahrhundert by Marie-Janine Calic. © Verlag C.H.Beck oHG, München 2014. The translation of this work was funded by Geisteswissenschaften International–Translation Funding for Humanities and Social Sciences from Germany, a joint initiative of the Fritz Thyssen Foundation, the German Federal Foreign Office, the collecting society VG WORT and the Börsenverein des Deutschen Buchhandels (German Publishers & Booksellers Association). -

Natoreview Contents
NATONATOreview contents Published under the authority of the Secretary General, this magazine is intended to contribute to a constructive discussion of Atlantic issues. Articles, therefore, do not necessarily represent FOCUS ON NATO official opinion or policy of member 4 governments or NATO. Alliance news in brief. EDITOR: Christopher Bennett ASSISTANT EDITOR: Vicki Nielsen PRODUCTION ASSISTANT: Felicity Breeze LAYOUT: NATO Graphics Studio © Nick Sidle — Allied Mouse and Heartstone Publisher:Director of Information and Press NATO, 1110 Brussels, Belgium THE PEACEKEEPING CHALLENGE Printed in Belgium by Editions Européennes 6 © NATO Peacekeeping past and present [email protected] [email protected] Espen Barth Eide examines the Articles may be reproduced, after permission has evolution of peacekeeping since the ON THE COVER been obtained from the editor, provided mention Cold War. is made of NATO Review and signed articles are NATO peacekeeper welcomes reproduced with the author’s name. returning Kosovo Albanian NATO Review is published periodically in English, refugee home. as well as in Czech, Danish (NATO Nyt), Dutch (NAVO Kroniek), French (Revue de l’OTAN), German (NATO Brief), Greek (Deltio NATO), Hungarian (NATO Tükor), Italian (Rivista della NATO), Norwegian (NATO Nytt), Polish (Przeglad NATO), Portuguese (Noticias da OTAN), Spanish (Revista de la OTAN) and Turkish (NATO Dergisi). One issue a year is published in Icelandic (NATO DEBATE Fréttir) and issues are also published in Russian and Ukrainian on an occasional basis. -

Political Myths in the Former Yugoslavia and Successor States
POLITICAL MYTHS IN THE FORMER YUGOSLAVIA AND SUCCESSOR STATES. A SHARED NARRATIVE INSTITUTE FOR HISTORICAL JUSTICE AND RECONCILIATION SERIES Published under editorial responsibility of The Institute for Historical Justice and Reconciliation The Hague VOLUME 1 POLITICAL MYTHS IN THE FORMER YUGOSLAVIA AND SUCCESSOR STATES A SHARED NARRATIVE Edited by Vjekoslav Perica and Darko Gavrilović Translation: Dana Todorović A joint production of the Centre for History, Democracy and Reconciliation, Novi Sad and The Institute for Historical Justice and Reconciliation, The Hague DORDRECHT 2011 Cover Design / Illustration: DISCLAIMER: The views expressed in this book are those of the authors alone. They do not necessarily reflect views of the Institute for Historical Justice and Reconciliation. This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data ISSN 2211-3061 hardbound ISBN 9789089790668 paperback ISBN 9789089790675 © 2011 Institute for Historical Justice and Reconciliation and Republic of Letters Publishing BV, Dordrecht, The Netherlands / St. Louis, MO. All rights reserved. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher. Republic of Letters Publishing has made all reasonable efforts to trace all rights holders to any copyrighted material used in this work. In cases where these efforts have not been successful the publisher welcomes communications from copyright holders, so that the appropriate acknowledgements can be made in future editions, and to settle other permission matters. Authorization to photocopy items for personal use is granted by Republic of Letters Publishing BV provided that the appropriate fees are paid directly to The Copyright Clearance Center, 222 Rosewood Drive, Suite 910, Danvers, MA 01923, USA.