Dresdner Suchtbericht 2021
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Comparative Study of Electoral Systems, 1996-2001
ICPSR 2683 Comparative Study of Electoral Systems, 1996-2001 Virginia Sapiro W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems 4th ICPSR Version February 2004 Inter-university Consortium for Political and Social Research P.O. Box 1248 Ann Arbor, Michigan 48106 www.icpsr.umich.edu Terms of Use Bibliographic Citation: Publications based on ICPSR data collections should acknowledge those sources by means of bibliographic citations. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in footnotes or in the reference section of publications. The bibliographic citation for this data collection is: Comparative Study of Electoral Systems Secretariat. COMPARATIVE STUDY OF ELECTORAL SYSTEMS, 1996-2001 [Computer file]. 4th ICPSR version. Ann Arbor, MI: University of Michigan, Center for Political Studies [producer], 2002. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2004. Request for Information on To provide funding agencies with essential information about use of Use of ICPSR Resources: archival resources and to facilitate the exchange of information about ICPSR participants' research activities, users of ICPSR data are requested to send to ICPSR bibliographic citations for each completed manuscript or thesis abstract. Visit the ICPSR Web site for more information on submitting citations. Data Disclaimer: The original collector of the data, ICPSR, and the relevant funding agency bear no responsibility for uses of this collection or for interpretations or inferences based upon such uses. Responsible Use In preparing data for public release, ICPSR performs a number of Statement: procedures to ensure that the identity of research subjects cannot be disclosed. Any intentional identification or disclosure of a person or establishment violates the assurances of confidentiality given to the providers of the information. -

And Long-Term Electoral Returns to Beneficial
Supporting Information: How Lasting is Voter Gratitude? An Analysis of the Short- and Long-term Electoral Returns to Beneficial Policy Michael M. Bechtel { ETH Zurich Jens Hainmueller { Massachusetts Institute of Technology This version: May 2011 Abstract This documents provides additional information referenced in the main paper. Michael M. Bechtel is Postdoctoral Researcher, ETH Zurich, Center for Comparative and International Studies, Haldeneggsteig 4, IFW C45.2, CH-8092 Zurich. E-mail: [email protected]. Jens Hainmueller is Assistant Professor of Political Science, Massachusetts Institute of Technology, 77 Mas- sachusetts Avenue, Cambridge, MA 02139. E-mail: [email protected]. I. Potential Alternative Explanation for High Electoral Returns in Affected Regions Some have pointed out that the SPD's victory in 2002 may have simply resulted from Gerhard Schr¨oder(SPD) being much more popular than his political opponent Edmund Stoiber and not from the incumbent's massive and swift policy response to the Elbe flooding. For this argument to be valid we should see a differential reaction to the announcement of Stoiber's candidacy in affected and control regions. We use state-level information on the popularity of chancellor Schr¨oderfrom the Forsa survey data to explore the validity of this argument. Figure 2 plots monthly Schr¨oder'sapproval ratings in affected and unaffected states in 2002. Figure 1: Popularity Ratings of Gerhard Schr¨oderand Flood Onset 60 55 50 45 Schroeder Popularity in % 40 35 2002m1 2002m3 2002m5 2002m7 2002m9 2002m2 2002m4 2002m6 2002m8 Treated states (>10% of districts affected) Controls Election Flood Note: Percent of voters that intend to vote for Gerhard Schr¨oderwith .90 confidence envelopes. -

Cause Or Consequence? the Alternative for Germany and Attitudes Toward Migration Policy
Cause or Consequence? The Alternative for Germany and Attitudes toward Migration Policy Hannah M. Alarian Political Science, University of Florida Abstract: Does a far-right electoral victory change mainstream support for migration policy? Although we know how migration can shape support for the far-right, we know little about the inverse. This article addresses this ques- tion, exploring whether an Alternative for Germany (AfD) candidate’s election changes non-far-right voter attitudes toward migration policies. In combining the German Longitudinal Election Study Short-Term Campaign panel with fed- eral electoral returns, I find the AfD’s 2017 success significantly altered migra- tion attitudes. Specifically, policy support for immigration and asylum declined precipitously where an AfD candidate won the plurality of first votes. Yet these voters were also more likely to support multicultural policies for current immi- grants. Successful AfD candidates therefore appear to enable both an endorse- ment of xenophobic rhetoric and a rejection of cultural assimilation. Keywords: elections, far-right populism, Germany, migration, public opinion Few policies are as connected to the rise of the far right as migration. Even in Germany where nationalistic politics are highly stigmatized, the far-right, Alternative for Germany (AfD) has proven successful in linking itself with nativist migration policies. This change in focus for the AfD from Euroscepti- cism to nationalism came at the height of the 2015 refugee crisis, a message that resonated with traditional mainstream and, perhaps surprisingly, immigrant voters.1 For many of these voters, the 2017 election provided a direct referen- dum on Chancellor Angela Merkel’s stance on refugee resettlement,2 espe- cially within eastern districts where demonstrations against immigrants and asylum seekers continued to erupt.3 Thus, by stoking mass anxiety over migra- tion and leaving its Eurosceptic roots behind, the AfD sought a new strategy to secure its place on the national stage in the 2017 Bundestag election. -

German Teacher Candidates' Perceptions of Their Roles in the Lives of Syrian Refugee Students in Dresden
GERMAN TEACHER CANDIDATES' PERCEPTIONS OF THEIR ROLES IN THE LIVES OF SYRIAN REFUGEE STUDENTS IN DRESDEN Sarah Elina Heineken A Thesis Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS August 2019 Committee: Bruce Collet, Advisor Christy Galletta-Horner Christina Guenther © 2019 Sarah Heineken All Rights Reserved iii ABSTRACT Bruce Collet, Advisor Beginning in 2011, the Syrian Conflict caused the widespread displacement of over five million people and caused a steep rise in the number of asylum seekers entering the European Union. Chancellor Angela Merkel adopted a controversial open-door policy in the summer 2015 that lifted previous quotas on the number of refugees that could enter Germany (Liebe, Meyerhoff, Kroesen, Chorus, and Glenk, 2018). This policy decision has led to an increase in the presence of Syrian refugee students in Germany public schools, particularly in regions that are less accepting of refugees and foreigners. This study examines the research question: how do German teacher candidates understand their role in the lives of the secondary school-aged Syrian refugees now present in German classrooms? Bourdieu’s (1973) social and cultural capital theory and Bronfenbrenner’s (1977) ecological systems theory provide a framework for my study and allow me to examine the ways in which German teacher candidates assess this phenomenon and identify critical forms of support that Syrian refugee students need. I collected data from eleven individual interviews with teacher candidates from a university in Dresden and coded the data to assess overarching themes that helped to answer the research question. -
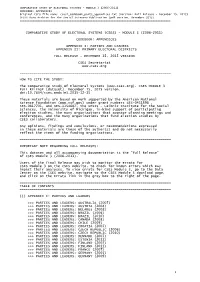
Comparative Study of Electoral Systems Module 3
COMPARATIVE STUDY OF ELECTORAL SYSTEMS - MODULE 3 (2006-2011) CODEBOOK: APPENDICES Original CSES file name: cses2_codebook_part3_appendices.txt (Version: Full Release - December 15, 2015) GESIS Data Archive for the Social Sciences Publication (pdf-version, December 2015) ============================================================================================= COMPARATIVE STUDY OF ELECTORAL SYSTEMS (CSES) - MODULE 3 (2006-2011) CODEBOOK: APPENDICES APPENDIX I: PARTIES AND LEADERS APPENDIX II: PRIMARY ELECTORAL DISTRICTS FULL RELEASE - DECEMBER 15, 2015 VERSION CSES Secretariat www.cses.org =========================================================================== HOW TO CITE THE STUDY: The Comparative Study of Electoral Systems (www.cses.org). CSES MODULE 3 FULL RELEASE [dataset]. December 15, 2015 version. doi:10.7804/cses.module3.2015-12-15 These materials are based on work supported by the American National Science Foundation (www.nsf.gov) under grant numbers SES-0451598 , SES-0817701, and SES-1154687, the GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences, the University of Michigan, in-kind support of participating election studies, the many organizations that sponsor planning meetings and conferences, and the many organizations that fund election studies by CSES collaborators. Any opinions, findings and conclusions, or recommendations expressed in these materials are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the funding organizations. =========================================================================== IMPORTANT NOTE REGARDING FULL RELEASES: This dataset and all accompanying documentation is the "Full Release" of CSES Module 3 (2006-2011). Users of the Final Release may wish to monitor the errata for CSES Module 3 on the CSES website, to check for known errors which may impact their analyses. To view errata for CSES Module 3, go to the Data Center on the CSES website, navigate to the CSES Module 3 download page, and click on the Errata link in the gray box to the right of the page. -
Sie Haben 2 Stimmen X X
Stimmzettel für die Wahl zum 19. Deutschen Bundestag im Wahlkreis 159 Dresden I am 24. September 2017 Sie haben 2 Stimmen X X hier 1 Stimme hier 1 Stimme für die Wahl für die Wahl einer/eines einer Landesliste (Partei) Wahlkreisabgeordneten - maßgebende Stimme für die Verteilung der Sitze insgesamt auf die einzelnen Parteien - Erststimme Zweitstimme Lämmel, Andreas Christlich Demokratische Union 1 Deutschlands 1 Bundestagsabgeordneter Christlich CDU Dr. Thomas de Maizière, Arnold Vaatz, Demokratische Katharina Landgraf, Yvonne Magwas, Dresden CDU Union Deutschlands Carsten Körber 2 Kipping, Katja DIE LINKE 2 Bundestagsabgeordnete/Literaturwissenschaftlerin DIE Katja Kipping, Dr. André Hahn, DIE LINKE Caren Nicole Lay, Michael Gerhard Leutert, Dresden LINKE DIE LINKE Sabine Zimmermann Avenarius, Christian Sozialdemokratische Partei 3 Deutschlands 3 Oberstaatsanwalt SPD Daniela Kolbe, Thomas Edmund Jurk, Sozialdemokratische Susann Rüthrich, Detlef Müller, Dresden SPD Partei Deutschlands Dr. Simone Raatz 4 Maier, Jens Alternative für Deutschland 4 Richter am Landgericht AfD Dr. Frauke Petry, Jens Maier, Alternative Siegbert Droese, Detlev Spangenberg, Dresden AfD für Deutschland Tino Chrupalla 5 Löser, Thomas BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 5 Lehrer GRÜNE Monika Lazar, Stephan Kühn, BÜNDNIS 90/ Meike Roden, Wolfgang Wetzel, Dresden GRÜNE DIE GRÜNEN Ines Kummer Grahl, Dietmar Nationaldemokratische Partei 6 Deutschlands 6 Tischler NPD Jens Baur, Arne Wolfgang Schimmer, Nationaldemokratische Ines Schreiber, Jürgen Gansel, Dresden NPD Partei Deutschlands Dr. Johannes Müller 7 Malorny, Robert Freie Demokratische Partei 7 leitender Angestellter Torsten Herbst, FDP Dr. Jürgen Andreas Michael Martens, Freie Demokratische Frank Müller-Rosentritt, Philipp Hartewig, Dresden FDP Partei Christine Schlagehan 8 Smuda, Jörg Stefan Piratenpartei Deutschland 8 Dipl.-Ingenieur Robert Lutz, Toni Rotter, PIRATEN Ute Elisabeth Gabelmann, Piratenpartei Dr. -

Understanding Right-Wing Political Mobilization in Germany
Networks of the ‘Repugnant Other’: Understanding Right-wing Political Mobilization in Germany Bhakti Deodhar Indian Institute of Technology Bombay, India Abstract: Political scientists and sociologists have long been hesitant in applying frameworks from social movements studies to right-wing collective action. Generally developed for left-wing, progressive, egalitarian movements, concepts like rational mobilization, network analysis and micro-mobilizations are considered an awkward fit for analysis of right-wing political and social groups. This paper argues for the importance of such cross-over analysis on two levels. Methodologically, the paper demonstrates crucial importance of ethnographic fieldwork in study of political groups in order to understand the complexity of internal dynamics of right- wing political parties. Insights are drawn from author’s original fieldwork among rank-and-file members of ‘Alternative für Deutschland’ (AfD), a right-wing party in Germany. Substantively, the paper produces a nuanced empirical account of internal dynamics of right- wing mobilization. The paper argues, using insights from the field, that far from being homogenous, irrational and predictive, the actions of right-wing political activists appear to be multi-layered, complex and indeed rational, however onerous to liberal minds. Key Words: right-wing politics, political ethnography, network analysis, right-wing mobilization, German politics Introduction: Traditionally, in political science and sociology, right-wing movements have been primarily conceptualised through the so-called ‘breakdown theories’ (Rydgren 2007; della porta 2008; Caini 2012), while left-wing collective action has been addressed from the perspective of rational mobilisation theories. At the macro-level, right-wing mobilizations were often seen as negative reactions to social crises related to unemployment, immigration and economic uncertainties that resulted out of broad, long term processes of globalisation and modernisation (Lipset 1959; Betz 1994; Heitmeyer 2002; Ignazi 2003). -

DIW Weekly Report 7+8 2018
DIW Weekly Report 7+8 2018 AT A GLANCE German right-wing party AfD finds more support in rural areas with aging populations By Christian Franz, Marcel Fratzscher, and Alexander S. Kritikos • Correlations analyzed between German right-wing party AfD’s performance in the 2017 election and seven socioeconomic indicators at the electoral district level • Differences in unemployment rates, education levels, and shares of foreigners stand in minor relation to variation in AfD votes • In western Germany, low household income and share of manufacturing workers correlate with strong AfD performance • In eastern Germany, positive correlation between high density of craft businesses, aging popula- tions and strong AfD performance • Policies must focus in particular on rural areas with an unfavorable demographic trend In eastern German electoral districts where the AfD performed strongly, the share of elderly is higher than the German average AfD performance in the 2017 general election Share of those over 60 years old in the overall population Proportional vote. In percent, per electoral district In percent. Per electoral district. Data from 2015 under 7.5 percent under 21.3 percent 7.5 to 12.6 percent 21.3 to 24.4 percent 12.6 to 15 percent 24.4 to 27.6 percent 15 to 25 percent 27.6 to 30.8 percent 25 to 30 percent 30.8 to 33.9 percent over 30 percent over 33.9 percent Source: Authors‘ own calculations. © DIW Berlin 2018 FROM THE AUTHORS “Our study shows that in eastern Germany, the right-wing populist party AfD performed better in rural areas with aging populations. -

Medieninformation 74/2021 Vom 06.07.2021
Ihre Ansprechpartnerin Diana Roth Medieninformation Durchwahl Telefon +49 3578 33-1910 74/2021 Telefax +49 3578 33-1999 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen [email protected] Kamenz, 6. Juli 2021 BIP-Wachstum 2019 nominal von 5,4 Prozent in der Stadt Leipzig bis 0,8 Prozent im Landkreis Meißen Fast 129 Milliarden Euro Bruttoinlandsprodukt (BIP) wurden 2019 in Sachsen - im Jahr vor der Coronapandemie - erwirtschaftet, 3,2 Prozent mehr als 2018 (in jeweiligen Preisen). Rund 43 Prozent des BIP kam aus den drei Kreisfreien Städten. Innerhalb des Freistaates lagen die Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr zwischen 5,4 Prozent in der Stadt Leipzig und 0,8 Prozent im Landkreis Meißen. Überdurchschnittlich war der Anstieg des BIP mit einem Plus um fünf Prozent auch im Landkreis Nordsachsen. Wesentlich verhaltener stieg das BIP mit 1,7 bzw. 1,9 Prozent dagegen im Erzgebirgskreis bzw. im Landkreis Mittel- sachen. Eine maßgebliche Ursache für ein hohes Wachstum einer Region waren über- durchschnittliche Zuwächse der Bruttowertschöpfung (BWS) im Produzierenden Gewerbe. Im Gegensatz dazu gab es hier sowohl im Landkreis Meißen, als auch in weiteren Landkreisen sowie der Stadt Dresden im Vergleich zu 2018 Rück- gänge. Innerhalb des Dienstleistungssektors kamen 2019 aus dem Bereich Öf- fentliche und sonstige Dienstleister, Erziehung und Gesundheit in allen sächsi- schen Kreisen deutliche Wachstumsimpulse. Im Bereich Grundstücks- und Wohnungswesen, Finanz- und Unternehmensdienstleister lagen die regionalen Veränderungsraten (Sachsen +2,1 Prozent) relativ nah beieinander, nur der Landkreis Bautzen verzeichnete einen Rückgang von 2,6 Prozent. Im Bereich Handel, Verkehr usw. bewegt sich der Vergleich der BWS mit 2018 zwischen Statistisches Landesamt Plus 7,6 Prozent in der Stadt Dresden und Minus 1,9 Prozent im Landkreis Gör- des Freistaates Sachsen litz. -

Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006
ICPSR 3808 Comparative Study of Electoral Systems, 2001-2006 Virginia Sapiro W. Philips Shively Comparative Study of Electoral Systems First ICPSR Version February 2004 Inter-university Consortium for Political and Social Research P.O. Box 1248 Ann Arbor, Michigan 48106 www.icpsr.umich.edu Terms of Use Bibliographic Citation: Publications based on ICPSR data collections should acknowledge those sources by means of bibliographic citations. To ensure that such source attributions are captured for social science bibliographic utilities, citations must appear in footnotes or in the reference section of publications. The bibliographic citation for this data collection is: Comparative Study of Electoral Systems Secretariat. COMPARATIVE STUDY OF ELECTORAL SYSTEMS, 2001-2006 [Computer file]. ICPSR version. Ann Arbor, MI: University of Michigan, Center for Political Studies [producer], 2003. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2004. Request for Information on To provide funding agencies with essential information about use of Use of ICPSR Resources: archival resources and to facilitate the exchange of information about ICPSR participants' research activities, users of ICPSR data are requested to send to ICPSR bibliographic citations for each completed manuscript or thesis abstract. Visit the ICPSR Web site for more information on submitting citations. Data Disclaimer: The original collector of the data, ICPSR, and the relevant funding agency bear no responsibility for uses of this collection or for interpretations or inferences based upon such uses. Responsible Use In preparing data for public release, ICPSR performs a number of Statement: procedures to ensure that the identity of research subjects cannot be disclosed. Any intentional identification or disclosure of a person or establishment violates the assurances of confidentiality given to the providers of the information. -

German Right-Wing Party Afd Finds More Support in Rural Areas with Aging Populations
A Service of Leibniz-Informationszentrum econstor Wirtschaft Leibniz Information Centre Make Your Publications Visible. zbw for Economics Franz, Christian; Fratzscher, Marcel; Kritikos, Alexander S. Article German right-wing party AfD finds more support in rural areas with aging populations DIW Weekly Report Provided in Cooperation with: German Institute for Economic Research (DIW Berlin) Suggested Citation: Franz, Christian; Fratzscher, Marcel; Kritikos, Alexander S. (2018) : German right-wing party AfD finds more support in rural areas with aging populations, DIW Weekly Report, ISSN 2568-7697, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin, Vol. 8, Iss. 7/8, pp. 69-79 This Version is available at: http://hdl.handle.net/10419/175453 Standard-Nutzungsbedingungen: Terms of use: Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen Documents in EconStor may be saved and copied for your Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden. personal and scholarly purposes. Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle You are not to copy documents for public or commercial Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich purposes, to exhibit the documents publicly, to make them machen, vertreiben oder anderweitig nutzen. publicly available on the internet, or to distribute or otherwise use the documents in public. Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen (insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten, If the documents have been made available under an Open gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort Content Licence (especially Creative Commons Licences), you genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte. may exercise further usage rights as specified in the indicated licence. www.econstor.eu DIW Weekly Report 7+8 2018 AT A GLANCE German right-wing party AfD finds more support in rural areas with aging populations By Christian Franz, Marcel Fratzscher, and Alexander S. -
Motherland of the Reformation. Group Offers
Motherland of the reforMation. Group offers. When Martin Luther was born on 10 November 1483, Saxony was at the height of its power. Since 1464, Elector Ernst and his brother Albert had together been ruling the most powerful country in the centre of the Holy German Empire. But just two years after Luther’s birth, Ernst and Albert made the biggest mistake in Saxony’s history: they split up the land. The ruling Wettin dynasty was divided into two lines, the Ernestine and Albertine. Now there were two countries with the name Saxony, the Electorate and the Duchy, and it was the sons of Ernst and Albert who played the most important, albeit different, roles in the life of Martin Luther and for the course of the Reformation. While the ducal Albertines made Dresden their new residence, Torgau became the centre of power under the electoral Ernes- tines. After the Albertines had taken the electoral dignity off the Ernestines, their strongly augmented Saxony, which by then also comprised Torgau and Wittenberg, the “Mother of Reformation”, had the leading role among the Protestant regions of Germany for a very long time and made for the consolidation and advancement of the Reformation. At the end of the 16th century, Saxony had already been given the honorary title “Motherland of the Reformation”, a legacy to which also the current federal state declares itself. Together with ReiseMission, Saxony has develo- ped bookable group offers for you, for easy and comfortable travelling to the sites of the Reformation. These offers can be combined and customised to your indivi- dual needs.