Begleitheft Mit Terminübersicht
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

EBERHARD HAVEKOST 1967-2019 Born Dresden, Germany
EBERHARD HAVEKOST 1967-2019 Born Dresden, Germany . EDUCATION 1984-85 Apprenticeship as a stonemason 1991-96 MFA, Hochschule für Bildende Künste (HfBK), Dresden, Germany 2010 Professor at the Kunstakademie, Dusseldorf, Germany SOLO EXHIBITIONS 2017 “Havekost Meets Austria” Austrian Cultural Forum, Berlin, Germany “Logik” Galerie Rudolfinum, Prague, Czech Republic 2016 “Inhalt” KINDL, Berlin, Germany [cat.] “Expulsion from Paradise Freeze” Anton Kern Gallery, New York, NY 2015 “Natur” Galerie Gebr. Lehmann, Dresden, Germany 2013 “Retrospektive 1+2” Galerie Gebr. Lehmann, Dresden/Berlin, Germany “Cosmos Now” White Cube, Mason’s Yard, London, UK “Title” Museum Küppersmühle, Duisburg, Germany “La Fin et le lever du jour” Galerie Hussenot, Paris, France 2012 “COPY + OWNERSHIP” Anton Kern Gallery, New York, NY “Endless” Brandenburgischer Kunstverein, Postdam, Germany “Eberhard Havekost-Sightseeing Trip” Bhau Daji Lad Museum, Mumbai, India “Eberhard Havekost” Die Sammlung MAP, Museum der Moderne, Salsburg, Austria Kochi-Muziris Biennale 2012, Kerala Lalitha Kala Akademi Durbar Hall Art Gallery, Ernakulam/Kochi, Kerala “Prints from 2001 to 2012” Kunstverein, Augsburg, Augsburg 2011 “Structure and Absence” White Cube Bermondsey, London, UK “Take Care” Roberts & Tilton, Culver City, CA “Farbenspiel” Galerie Gebr. Lehmann, Berlin, Germany 2010 “Guest” White Cube, Hoxton Square, London, UK “Ausstellung” Staatliche Kunstsammlungen, Dresden, Germany “Affirmation” Ausstellungsraum Celine u. Heiner Bastian, Berlin, Germany “If Not in This Period of Time -

Residenzschloss
Zum Buchungsformular Residenzschloss Die Highlights der Museen im Residenzschloss Neues Grünes Gewölbe, Rüstkammer Dauer Das Dresdner Residenzschloss zählt zu den prächtigsten und 120 Minuten bedeutendsten Schlossbauten der Renaissance in Deutschland. Seit Gruppenstärke 1485 war Dresden ständige Residenz sächsischer Fürsten, max. 25 Teilnehmer Kurfürsten und Könige. Heute beherbergt es hochrangige Museen, Gebühr die zu den bedeutendsten Kunstmuseen weltweit zählen. Die 120 € pro Gruppe zzgl. Eintritt Führung stellt die Highlights dieser Ausstellungen, unter anderem aus dem Neuen Grünen Gewölbe, der Rüstkammer und dem Renaissanceflügel, vor. Zur Buchung Juwelentour – Grünes Gewölbe Total! Neues Grünes Gewölbe, Historisches Grünes Gewölbe Dauer Nach einer kurzweiligen Führung im Neuen Grünen Gewölbe 60 Minuten (Führung) begeben Sie sich in die berühmte und wohl schönste Schatzkammer Gruppenstärke Europas – das Historische Grüne Gewölbe. Hier entdecken Sie max. 25 Teilnehmer während einer individuellen Audioguide-Tour, die originalgetreu Gebühr gestalteten barocken Prunkräume des Residenzschlosses und 60 € pro Gruppe zzgl. Eintritt genießen ein einzigartiges Ensemble aus Gold und Edelsteinen. Zur Buchung Die Königlichen Gemächer Augusts des Starken Paraderäume Dauer Die Führung zeigt die Paraderäume Augusts des Starken im 60 Minuten Residenzschloss. In den vier Sälen, bestehend aus Erstem Gruppenstärke Vorzimmer, Zweitem Vorzimmer, Audienzgemach und max. 25 Teilnehmer Paradeschlafzimmer, präsentierte der Kurfürst seine polnisch- Gebühr sächsische, könig-kurfürstliche Herrschaft der Außenwelt. Der 60 € pro Gruppe zzgl. Eintritt Besuch des kleinen Ballsaals mit seinen reichhaltigen Verzierungen aus Blattgold, Marmor und Stuck rundet die Führung ab. Zur Buchung Zum Buchungsformular Zwinger Der Zwinger - Barocke Pracht Gemäldegalerie Alte Meister, Porzellansammlung, Mathematisch Physikalischer Salon Dauer Der weltbekannte Dresdner Zwinger gehört zu den großartigsten 120 Minuten Bauwerken des Barocks in Deutschland. -
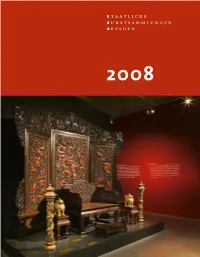
2008 T R O Ep R 2008 N A
of the 18th century, Rüstkammer of the 18thcentury, 1st half Tatar, or Ottoman Saddle, comes comes of the orient The fascination Cammer“ “Türckische the 2009–OpeningofDecember to to the Residenzschloss STaaTliChe Kunstsammlungen Dresden · annual repOrT 2008 2008 ANNUAL REPORT 2008 Albertinum Zwinger with Semperbau Wasserpalais, Schloss Pillnitz Page 4 International Special ExhibiTions Foreword PARTNERshiPs Page 27 Page 17 Special exhibitions in Dresden China iN Dresden Message of greeting from the and Saxony in 2008 iN ChiNA Federal Minister for Foreign Affairs Page 34 Page 18 Special exhibitions abroad in 2008 Page 9 The Staatliche Kunstsammlungen Cultural exchange past and future – Dresden in international dialogue a year of encounters between Dresden WiTh kind support and Beijing Page 24 Trip to Russia Launch event with Helmut Schmidt Page 37 and Kurt Biedenkopf Page 25 In your mid-20s? Off to the museum! Visit to Warsaw Page 10 Page 38 Seven exhibitions and a Societies of friends wide-ranging programme of events Page 38 Page 13 Sponsors and donors in 2008 A chance to work abroad Page 40 Page 14 Partners from the business world China in Dresden Page 15 Dresden in China Residenzschloss Jägerhof Lipsiusbau on the Brühlsche Terrasse From ThE collections Visitors Museum bUildiNgs Page 43 Page 63 Page 75 Selected purchases and donations A host must be prepared – improving Two topping-out ceremonies and our Visitor Service will remain a surprising find mark the progress Page 47 an important task in the future of building work at the museums -

Ja Hresber Ic Ht 2 0 11
Madonna_Sixtinisch_Jahresbericht_Anzeige_210x170mm.indd 1 26. Mai – 26. August 2012 26. – Mai 26. Staatliche KunstsammlungenDresden Alte Meister, Gemäldegalerie Raffaels KultbildfeiertGeburtstag. Die SixtinischeMadonna— 500. WIRD WELT DER FRAU SCHÖNSTE DIE 09.03.12 11:34 Staatliche KunStSammlungen Dresden · Jah reSbericht 2011 2011 Kunsthalle im Lipsiusbau Semper Building at the Zwinger Schloss Pillnitz, Bergpalais Page 5 Page 18 sPEcIAL EXHIBITIONs Foreword Back on public display at last: The “Canaletto View” Page 29 Page 19 Exhibitions in Dresden, Saxony and I N FOcUs The Dream of a King. throughout Germany Dresden’s Green Vault Page 42 Page 7 Exhibitions abroad The Art of the Enlightenment Page 10 A cHANGI NG The Power of Giving INsTITUTION FROM TH E Page 12 cOLLEcTIONs On the departure of The Third Saxon State Exhibition: Prof. Dr. Martin Roth via regia – 800 Years of Mobility Page 45 and Movement Page 21 Selected purchases and donations Motivated by cultural convictions Page 14 Page 50 Heavenly Splendour: Page 23 Selected publications Raphael, Dürer and Grünewald Ten years at the Staatliche Page 53 paint the Madonna Kunstsammlungen Dresden Selected restoration projects Page 16 On the departure of Neue Sachlichkeit in Dresden. Dr. Moritz Woelk 1920s paintings from Dix to Querner Page 26 From Benedetto Antelami to Tony Cragg – Moritz Woelk in Dresden’s Albertinum Japanisches Palais Albertinum GRASSI Museum Leipzig SCIENTIFIc AN D VIsITORs NEWs I N BRI EF REsEARcH PROJ EcTs Page 77 Page 89 Page 59 The Future of Museums – youth Scientific -

Jahresvorschau 2019
DAS PROGRAMM 20I9 DAS PROGRAMM 20I9 Inhalt VORWORT MARION ACKERMANN 04 SAMMLUNG HOFFMANN 10 ARCHIVKONGRESS 2019 14 DIE SAMMLUNGEN 18 SONDERAUSSTELLUNGEN 2019 32 AUSBLICK 2020 50 AB INS MUSEUM 52 WISSENSCHAFT UND DISKURS 66 FREUNDE UND STIFTER 68 BESUCHERINFORMATIONEN 72 „Die Kunst erinnert uns daran, 5 | 4 dass die Welt echt ist.“ Wolfgang Tillmans, 29. September 2018 VORWORT Liebe Leserinnen und Leser, was für ein Bild: Ein Kind liegt bäuchlings auf einer Glas- vorzustellen. Auch wenn die Ausstellung weit in das Jahr platte und blickt konzentriert und versunken in einen ge- 2019 hineinreicht, ist sie konzeptionell doch 1968, im Jahr heimnisvollen Raum vielfältiger Spiegelungen, der wie ein von Prager Frühling und Okkupation verankert. Auf Seiten Brunnenschacht in große Tiefe zu führen scheint. Gleich unserer tschechischen Kollegen ging und geht es immer einem Stützpfeiler steht ein Turm aus Büchern im Zent- um die Frage der Identität. Deshalb ist das Buch Kun- rum. Halb aufgezogene Schubladen offenbaren ihr Inneres: deras, das in der Originalausgabe 1978 erschien, wieder Sammlungen von Gegenständen, kleine Schätze, wohl so aktuell: Es geht hier, in den Worten Erika Hoffmanns, sortiert. Doch etwa 90 Prozent dessen, was der Betrach- um „die Idee eines Lachens, das die Realität nicht ernst ter zu sehen vermeint, entspringt einer Illusion, die durch nimmt, negiert, vergessen und für tot erklären lässt, wird Imagination ergänzt wird. Durch die Kombination zahlrei- schließlich teuflisch genannt, weil mit den Erinnerungen cher Spiegel und Glasscheiben entsteht ein komplexes, die Identität verloren geht.“ Unsere gemeinsame Ausstel- magisches Gesamtbild, das ein universales Museum zu lung in Prag trägt den Titel Dimensionen des Dialogs nach 7 | beschreiben scheint. -

SKD-Jahresbericht-2009.Pdf
für Dresden des18.JahrhundertsMalerei Wirklichkeit.« und Sehnsucht »Wunschbilder. BlickindieAusstellung Titel: –1709) (1548 derKunst« im Spiegel Ehen undAllianzen Sachsen undDänemark– »Mit Fortuna übersMeer. Die Sonderausstellung Staatlich E Ku nStsammlu ngEn Dresden · JAh resbEricht 2009 2009 Jahresbericht 2009 Kunsthalle im Lipsiusbau Zwinger Schloss Pillnitz, Bergpalais Seite 4 i nstitution mit freundlicher Vorwort im Wan del u nterstützung Seite 27 Seite 35 Von barock Die Staatlichen Kunstsammlungen Gemeinsam »Für Canaletto« – bis baselitz Dresden als Staatsbetrieb im Ein Dresdner Wahrzeichen braucht Freistaat Sachsen Unterstützung! Seite 7 Seite 28 Seite 36 Wirtschaftsdaten Freundeskreise son der- Seite 30 Seite 39 ausstellungen Kunstsammlungen und Ethno Sponsoren und Förderer 2009 graphische Sammlungen unter zeichnen Kooperationsvertrag Seite 13 aus den sammlu ngen Sonderausstellungen Seite 31 in Dresden, Sachsen Zwei Direktoren verabschieden und Deutschland 2009 sich – Wechsel bei Alten Meistern Seite 43 und KupferstichKabinett Erwerbungen und Schenkungen Seite 24 Sonderausstellungen im Seite 50 Ausland 2009 Publikationen Seite 52 Recherchen und Restitutionen Seite 53 Restaurierungen Japanisches Palais Albertinum Residenzschloss Wissenschaft Seite 62 museumsbauten u n d Forsch u ng Zum Beispiel: Kooperation mit der Technischen Universität Dresden Seite 77 Seite 59 Seite 63 Unsichtbare und Wissenschaftliche Projekte Zum Beispiel: Staatliche Ethno sichtbare Architektur und Kooperationen graphische Sammlungen Sachsen Seite 59 -

Hans Posse Und Die „Entartete Kunst“
Originalveröffentlichung in: Lupfer, Gilbert ; Rudert, Thomas (Hrsgg.): Kennerschaft zwischen Macht und Moral : Annäherungen an Hans Posse (1879-1942), Köln 2015, S. 319-328 Christoph Zuschlag Hans Posse und die „Entartete Kunst “ In dem folgenden Beitrag soll zunächst ein Blick auf die Beschlagnahmeaktion 1937 und die Verluste der Dresdener Gemäldegalerie geworfen werden. Sodann wird die kunstpolitische Situation in Dresden vor und nach 1933 beleuchtet und nach dem Verhalten und der Rolle Hans Posses gefragt. Schließlich interessiert die Frage, wie Posses Engagement für die Kunstströmungen, die ab 1933 als „entartet“ diffamiert wurden, bewertet werden kann.1 Die Beschlagnahmeaktion von 1937 und die damit verbundenen Verluste für die Dresdener Gemäldegalerie Die Beschlagnahmung „entarteter Kunst“ fand in zwei Aktionen statt: Die erste erfolgte im Juli 1937 in ausgewählten Museen und diente der Requirierung von Exponaten für die gleichnamige Ausstellung in München. Im Zuge dessen war es wahrscheinlich der Maler Wolfgang Willrich (er hatte in den 1920er Jahren an der Dresdener Kunstakademie studiert), der im Auftrag des Präsidenten der Reichskammer der bildenden Künste Adolf Ziegler am 9. oder 10. Juli 1937 in der Gemäldegalerie in Dresden erschien, jedoch keine Werke für München an forderte. Die zweite Beschlagnahmung startete im August 1937 und verfolgte das Ziel einer systematischen flächendeckenden Liquidierung der modernen Kunst in den deutschen Museen.2 In diesem Rahmen erschien am 14. August 1937 eine Kommission in Dresden, die die -

Warsaw to Berlin from the Prussian World to Modernity
WARSAW TO BERLIN FROM THE PRUSSIAN WORLD TO MODERNITY MAY 8-25, 2017 TOUR LEADER: THOMAS ABBOTT Warsaw to Berlin Overview From the Prussian world to modernity With extended stays in Warsaw, Krakow, Dresden and Berlin, this tour explores these fascinating cities of Central Europe, all enjoying a new Tour dates: May 8-25, 2017 vitality since the fall of the Berlin Wall. In Poland, the attractions of major centres such as Warsaw and Krakow are complemented by country Tour leader: Thomas Abbott estates and centres of religious pilgrimage. In Germany, historic buildings such as Sanssouci Palace, the Reichstag and Dresden’s Frauenkirche vie Tour Price: $9,795 per person, twin share for attention with striking contemporary architecture. The region also boasts some exceptional art and history museums, while Berlin is a centre Single Supplement: $1,790 for sole use of for contemporary arts and is currently enjoying a major cultural double room renaissance. First documented in the 13th century, the city has been the capital of the Prussian Empire, the German Empire, the Weimar Republic Booking deposit: $500 per person and the Third Reich. Since 1989 the city has relished its role as the capital of a unified and re-energised Germany. Recommended airline: Emirates Explore beautifully restored palaces along the Royal Route in Warsaw and Maximum places: 20 its environs, with visits to Nieborow and Lazienski Park and on Wawel Hill in Krakow. Learn about Poland’s extensive Jewish heritage and head Itinerary: Warsaw (4 nights), Krakow (3 nights), down the Weilieczka Salt Mine. Art and music come to the fore on Dresden (3 nights), Leipzig (2 nights), Berlin (5 Germany with performances in Leipzig and Berlin and visits to the Green nights) Vault, Albertinum and the Gemäldegalerie gallery. -

SKD Annual Report 2015
www.skd.museum STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN DRESDEN · ANNUAL REPORT 2015 2015 Powered by IN THE TRADITION OF THE COLLECTION OF THE HOUSE OF WETTIN A.L. 2015 annual report 6 Foreword 12 Exhibitions 14 Dahl and Friedrich 18 Supermarket of the Dead 20 Parts of a Unity 23 Luther and the Princes 26 The new Münzkabinett 30 War & Peace 34 Rosa Barba 36 Special exhibitions in Dresden and Saxony Contents 41 Special exhibitions in Germany and abroad 42 Science and research 44 Masterpieces from the former Weigang collection 46 “Europe / World” research and exhibition programme 49 Stories in Miniatures 50 Digitalisation and cataloguing 52 Restoring the Damascus Room 54 The Cuccina cycle by Veronese 58 Dresden/Prague around 1600 59 Prince Elector Augustus of Saxony 60 News in brief 62 Research projects 64 Publications 66 A changing institution 68 Developments at the Staatliche Ethnographische Sammlungen Sachsen 72 Staff matters 76 The museum and the public 78 Media and communication 82 Striking stories and histories 84 Focus on inclusion 86 New tours on offer for individual travellers 88 News in brief 96 Visitor numbers 97 Economic indicators 98 Thanks 100 Santiago Sierra at the Kupferstich-Kabinett 101 Friends associations 102 Acquisitions and gifts 106 Supporters and sponsors 110 Institutions 112 Publication details Dresden Art Festival – an evening on Scarred Landscapes, or the Wasteland of War The terrifying experience of violence and war – the opposite of the ideal of tolerance, open-mindedness and an interest in art – has shaped the face of Dresden, and not only in the 20th century. The paintings collected by Staatliche Kunstsammlungen Dresden include world-famous exhibits on this topic, which were also made audible in the form of a promenade concert with corresponding music. -

German / American Exchange Program on Nazi-Era Art Provenance Research
Dresden March 17-22, 2019 GERMAN / AMERICAN EXCHANGE PROGRAM ON NAZI-ERA ART PROVENANCE RESEARCH 1 DEAR 2019 PREP PARTICIPANTS, WELCOME TO DRESDEN – WILLKOMMEN IN DRESDEN! We are proud and excited to welcome you to the Staatliche Kunstsammlungen Dresden for the third year of the German/American Provenance Research Exchange Program for Museum Professionals (PREP). After remarkable weeks in New York and Berlin (2017), then Los Angeles and München (2018), PREP now moves to Dresden, where we look forward to seeing how you, the 2019 Cohort, will add your expertise to our growing network. During your exchange, you will meet new colleagues from both sides of the Atlantic, identify common topics and challenges, and discuss possible solutions. This year’s host, the Staatliche Kunstsammlungen Dresden (SKD), is among the fore- most museum associations of the world. Under its aegis, a total of 15 museums and collections offer an exceptionally broad thematic diversity. At the heart of the SKD’s scholarly and curatorial work on its collections is the “Daphne” project. Begun in 2008, this comprehensive, multi-year provenance research, cataloguing, and inventory project aims to register the more than 1.5 million holdings of the SKD, facilitating a systematic provenance research of all acquisitions since 1933, in what is one of the first projects of its kind for a German museum. Against the background of the turbulent history of the 20th century, various confisca- tion contexts are present within the history of the Dresden collections: in addition to art theft in the Nazi era, these include World War II losses, “Schlossbergungen” (literally “palace salvage”), as well as seizures during the years of the Soviet military occupation and the period of the GDR. -

To the Participants of IPR XXI Information About the Social Programme Venues
To the participants of IPR XXI Information about the social programme Venues - Excursion by bus to Ebersdorfer Koggenmodell and Chemnitz smac (map 1) on Thursday, April 21 st 2016, 09.45 a.m. Organized by Dr. Stefan Krabath (Archaeological Heritage Office of Saxony) Meeting point: Palaisplatz 1, 01097 Dresden (in front of Motel One Palaisplatz Dresden) 0.30 p.m. – 1.30 p.m. Lunch at the restaurant Ratskeller Chemnitz must be ordered in advanced: Please notice further information (e-mail) to choose from the menu! - Guided Tour through the State Capital Dresden in Engl. and Germ. language (map 1) organized by Igeltour, Dr. Michael Böttger (mobil 0177 804 45 48) on Friday, April 22 nd 2016, 09.00 a.m. Meeting point: Theaterplatz 1, 01067 Dresden, Monument of King Johann (in front of the Semper Opera-House ) (Fee: 10,00 Euro) - Individual Excursion: Museums of State Capital Dresden ( map 1 ) Introductory words into the museums given by Dr. Cornelia Rupp (Archaeological Heritage Office of Saxony) on Friday, April 22 nd 2016, 11:00 h Meeting point: Theaterplatz 1, 01067 Dresden, Monument of King Johann - Lunch at the restaurant Altmarktkeller Dresden (map 3) on Friday, April 22 nd 2016, 01.00 p.m. Address: Altmarkt 4, 01067 Dresden (paid by each participant) - Registration and Opening of the Poster presentation (map 2”Klotzsche”) on Friday April 22 nd 2016, 06.00 p.m. (registration) and 07.00 p.m. (opening) will take place at Archaeological Heritage Office of Saxony Zur Wetterwarte 7, 01109 Dresden Building: A.-B.-Meyer-Bau About 30 minutes driving time from Motel One Palaisplatz Dresden . -

Öffnungszeiten Zu Feiertagen 2020 Museum Feiertag Schließzeiten 2020
Schließzeiten 2020 14.01. bis 31.01.2020 Porzellansammlung Öffnung Hausmannsturm 2020 03.02. bis 07.02.2020 Albertinum (Galerie Neue Meister und Skulpturensammlung ab 1800) 03.04. bis 01.11.2020 06.01. bis 17.01.2020 Mathematisch-Physikalischer Salon 27.01. bis 06.02.2020 Residenzschloss alle Museen Öffnung Kunstgewerbemuseum 2020 Semperbau mit Gemäldegalerie Alte Meister und Skulpturensammlung bis 1800: 24.04. bis 01.11.2020 06.01. bis 28.02.2020: Komplettschließung des Semperbaus 29.02.2020: Wiedereröffnung des Semperbaus Öffnungszeiten zu Feiertagen 2020 Museum Feiertag 01.01.2020 Neujahr,Mittwoch 10.04.2020 Karfreitag 12.04.2020 Ostersonntag 13.04.2020 Ostermontag 14.04.2020 geöffnet) zusätzl. (Schloss Dienstag 01.05.2020 Maifeiertag,Freitag 21.05.2020 Donnerstag Himmelfahrt, Christi 31.05.2020 Pfingstsonntag 01.06.2020 Pfingstmontag 02.06.2020 geöffnet) zusätzl. (Schloss Dienstag 03.10.2020 Samstag Einheit, Deutschen derTag 31.10.2020 Samstag Reformationstag, 18.11.2020 Mittwoch Bettag, und Buß- 24.12.2020 HeiligDonnerstagAbend, 25.12.2020 FreitagWeihnachtsfeiertag, 1. 26.12.2020 Samstag Weihnachtsfeiertag, 2. 28.12.2020 geöffnet) zusätzlich VKM und (GAM Montag 29.12.2020 geöffnet) zusätzl. (Schloss Dienstag 31.12.2020 Donnerstag Silvester, 01.01.2021 Neujahr,Freitag Albertinum 12-18 10-14 10-16 12-18 10 bis 18 Uhr (regulär Montag Schließtag) Uhr Uhr Uhr Uhr Lipsiusbau* 12-18 10-14 10-16 12-18 10 bis 18 Uhr (regulär Montag Schließtag) Uhr Uhr Uhr Uhr Residenzschloss alle Museen 12-18 10-14 10-16 12-18 10 bis 18 Uhr (regulär Dienstag