Hans Posse Und Die „Entartete Kunst“
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

EBERHARD HAVEKOST 1967-2019 Born Dresden, Germany
EBERHARD HAVEKOST 1967-2019 Born Dresden, Germany . EDUCATION 1984-85 Apprenticeship as a stonemason 1991-96 MFA, Hochschule für Bildende Künste (HfBK), Dresden, Germany 2010 Professor at the Kunstakademie, Dusseldorf, Germany SOLO EXHIBITIONS 2017 “Havekost Meets Austria” Austrian Cultural Forum, Berlin, Germany “Logik” Galerie Rudolfinum, Prague, Czech Republic 2016 “Inhalt” KINDL, Berlin, Germany [cat.] “Expulsion from Paradise Freeze” Anton Kern Gallery, New York, NY 2015 “Natur” Galerie Gebr. Lehmann, Dresden, Germany 2013 “Retrospektive 1+2” Galerie Gebr. Lehmann, Dresden/Berlin, Germany “Cosmos Now” White Cube, Mason’s Yard, London, UK “Title” Museum Küppersmühle, Duisburg, Germany “La Fin et le lever du jour” Galerie Hussenot, Paris, France 2012 “COPY + OWNERSHIP” Anton Kern Gallery, New York, NY “Endless” Brandenburgischer Kunstverein, Postdam, Germany “Eberhard Havekost-Sightseeing Trip” Bhau Daji Lad Museum, Mumbai, India “Eberhard Havekost” Die Sammlung MAP, Museum der Moderne, Salsburg, Austria Kochi-Muziris Biennale 2012, Kerala Lalitha Kala Akademi Durbar Hall Art Gallery, Ernakulam/Kochi, Kerala “Prints from 2001 to 2012” Kunstverein, Augsburg, Augsburg 2011 “Structure and Absence” White Cube Bermondsey, London, UK “Take Care” Roberts & Tilton, Culver City, CA “Farbenspiel” Galerie Gebr. Lehmann, Berlin, Germany 2010 “Guest” White Cube, Hoxton Square, London, UK “Ausstellung” Staatliche Kunstsammlungen, Dresden, Germany “Affirmation” Ausstellungsraum Celine u. Heiner Bastian, Berlin, Germany “If Not in This Period of Time -

Dresden Paintings in the Permanent Collection Galleries
DRESDEN PAINTINGS IN THE PERMANENT COLLECTION GALLERIES To complement the display of works by two of the best-known artists who worked in Dresden, Caspar David Friedrich (1774-1840) and Gerhard Richter (born 1932), thirteen works from the Galerie Neue Meister are interspersed throughout the paintings galleries of the J. Paul Getty Museum in juxtapositions with works from the Getty’s permanent collection. Rather than following a strict chronology, the pairings touch on key themes in German painting from 1800 to the present and highlight the artists’ diverse approaches to similar subjects. They also illustrate the relationship between German art and that produced elsewhere in Europe, the connection between hsitory and art in Germany, and the role of Dresden in the development of German art. Galerie Neue Meister, Dresden The J. Paul Getty Museum West Pavilion, Plaza Level Carl Blechen (German, 1798-1840) Christen Schjellerup Købke (Danish, Ruins of a Gothic Church, 1826 1810-1848) Oil on canvas The Forum, Pompeii, with Vesuvius in the Distance, 1841 Oil on paper, mounted on canvas West Pavilion, Upper Level Christian Friedrich Gille (German, 1805-1899) Jean-Baptiste-Camille Corot (French, At the Weisseritz River in Plauen, 1833 1796-1875) Oil on paper, mounted on cardboard House near Orléans, France, about 1830 Oil on paper, mounted on millboard Jean Joseph-Xavier Bidault (French, 1758-1846) View of the Bridge and Part of the Town of Cava, Kingdom of Naples, 1785-90 Oil on paper, mounted on canvas Simon Joseph-Alexandre-Clément Denis (Flemish, 1755-1812) Study of Clouds with a Sunset near Rome, 1786-1801 Oil on paper -more- Page 2 Théodore Caruelle d’Aligny (French, 1798-1871) View of a Mountain Valley with Buildings, about 1829-33 Oil on paper, mounted on canvas Lent by a private collector .................................................................................................................................................. -

Paul Gauguin 8 February to 28 June 2015
Media Release Paul Gauguin 8 February to 28 June 2015 With Paul Gauguin (1848-1903), the Fondation Beyeler presents one of the most important and fascinating artists in history. As one of the great European cultural highlights in the year 2015, the exhibition at the Fondation Beyeler brings together over fifty masterpieces by Gauguin from leading international museums and private collections. This is the most dazzling exhibition of masterpieces by this exceptional, groundbreaking French artist that has been held in Switzerland for sixty years; the last major retrospective in neighbouring countries dates back around ten years. Over six years in the making, the show is the most elaborate exhibition project in the Fondation Beyeler’s history. The museum is consequently expecting a record number of visitors. The exhibition features Gauguin’s multifaceted self-portraits as well as the visionary, spiritual paintings from his time in Brittany, but it mainly focuses on the world-famous paintings he created in Tahiti. In them, the artist celebrates his ideal of an unspoilt exotic world, harmoniously combining nature and culture, mysticism and eroticism, dream and reality. In addition to paintings, the exhibition includes a selection of Gauguin’s enigmatic sculptures that evoke the art of the South Seas that had by then already largely vanished. There is no art museum in the world exclusively devoted to Gauguin’s work, so the precious loans come from 13 countries: Switzerland, Germany, France, Spain, Belgium, Great Britain (England and Scotland), -

Mapping the Limits of Repatriable Cultural Heritage: a Case Study of Stolen Flemish Art in French Museums
_________________ COMMENT _________________ MAPPING THE LIMITS OF REPATRIABLE CULTURAL HERITAGE: A CASE STUDY OF STOLEN FLEMISH ART IN FRENCH MUSEUMS † PAIGE S. GOODWIN INTRODUCTION......................................................................................674 I. THE NAPOLEONIC REVOLUTION AND THE CREATION OF FRANCE’S MUSEUMS ................................................676 A. Napoleon and the Confiscation of Art at Home and Abroad.....677 B. The Second Treaty of Paris ....................................................679 II. DEVELOPMENT OF THE LAW OF RESTITUTION ...............................682 A. Looting and War: From Prize Law to Nationalism and Cultural-Property Internationalism .................................682 B. Methods of Restitution Today: Comparative Examples............685 1. The Elgin Marbles and the Problem of Cultural-Property Internationalism........................687 2. The Italy-Met Accord as a Restitution Blueprint ...689 III. RESTITUTION OF FLEMISH ART AND POSSIBLE SOLUTIONS IN PUBLIC AND PRIVATE LAW .........................................................692 A. Why Should France Return Flemish Art Now?.........................692 1. Nationalism .............................................................692 2. Morality and Legality ..............................................693 3. Universalism............................................................694 † J.D. Candidate, 2009, University of Pennsylvania Law School; A.B., 2006, Duke Uni- versity. Many thanks to Professors Hans J. Van Miegroet -

Nazi-Confiscated Art Issues
Nazi-Confiscated Art Issues Dr. Jonathan Petropoulos PROFESSOR, DEPARTMENT OF HISTORY, LOYOLA COLLEGE, MD UNITED STATES Art Looting during the Third Reich: An Overview with Recommendations for Further Research Plenary Session on Nazi-Confiscated Art Issues It is an honor to be here to speak to you today. In many respects it is the highpoint of the over fifteen years I have spent working on this issue of artworks looted by the Nazis. This is a vast topic, too much for any one book, or even any one person to cover. Put simply, the Nazis plundered so many objects over such a large geographical area that it requires a collaborative effort to reconstruct this history. The project of determining what was plundered and what subsequently happened to these objects must be a team effort. And in fact, this is the way the work has proceeded. Many scholars have added pieces to the puzzle, and we are just now starting to assemble a complete picture. In my work I have focused on the Nazi plundering agencies1; Lynn Nicholas and Michael Kurtz have worked on the restitution process2; Hector Feliciano concentrated on specific collections in Western Europe which were 1 Jonathan Petropoulos, Art as Politics in the Third Reich (Chapel Hill: The University of North Carolina Press). Also, The Faustian Bargain: The Art World in Nazi Germany (New York/Oxford: Oxford University Press, forthcoming, 1999). 2 Lynn Nicholas, The Rape of Europa: The Fate of Europe's Treasures in the Third Reich and the Second World War (New York: Alfred Knopf, 1994); and Michael Kurtz, Nazi Contraband: American Policy on the Return of European Cultural Treasures (New York: Garland, 1985). -

The Deceptive Art Deal of Van Beuningen
The deceptive art deal of Van Beuningen Koenigs Collection Wednesday begins the lawsuit by the heirs Koenigs at Museum Boijmans A case that shows the less attractive side of patron Van Beuningen. • Arjen Ribbens October 18, 2016 at 16:55 A great art collection often occurs at the expense of previous collectors. This is showed once again by the documents of the lawsuit that was filed Wednesday in Rotterdam against Museum Boijmans Van Beuningen. Six heirs of businessman Franz Koenigs demand the return of hundreds of Old Master drawings, which are given to the museum on loan in 1935. This loan was part of a previous, much larger loan which was partly donated to the museum? That is the question at the present proceedings. The history of the great loan - 46 paintings and 2,000 drawings - is worth telling. She makes clear to which behaviour an obsessive collector is capable of. The protagonist in this story is Daniel George van Beuningen (1877-1955), director of the Coal Trading Association (SHV) and one of the Rotterdam harbour barons who before the war ruled the city and its workers. It starts in April 1940 In April 1940, when the Nazis set Europe ablaze, Van Beuningen does an art purchase that will be central to the next trial. The Jewish owners of the Amsterdam banking Lisser and Rosenkranz want to flee to the United States. In all haste they try to liquidate their bank. Part of their property is the loaned art collection of Franz Koenigs to Museum Boijmans, which the businessman pawned to the bank after the stock market crash. -

Residenzschloss
Zum Buchungsformular Residenzschloss Die Highlights der Museen im Residenzschloss Neues Grünes Gewölbe, Rüstkammer Dauer Das Dresdner Residenzschloss zählt zu den prächtigsten und 120 Minuten bedeutendsten Schlossbauten der Renaissance in Deutschland. Seit Gruppenstärke 1485 war Dresden ständige Residenz sächsischer Fürsten, max. 25 Teilnehmer Kurfürsten und Könige. Heute beherbergt es hochrangige Museen, Gebühr die zu den bedeutendsten Kunstmuseen weltweit zählen. Die 120 € pro Gruppe zzgl. Eintritt Führung stellt die Highlights dieser Ausstellungen, unter anderem aus dem Neuen Grünen Gewölbe, der Rüstkammer und dem Renaissanceflügel, vor. Zur Buchung Juwelentour – Grünes Gewölbe Total! Neues Grünes Gewölbe, Historisches Grünes Gewölbe Dauer Nach einer kurzweiligen Führung im Neuen Grünen Gewölbe 60 Minuten (Führung) begeben Sie sich in die berühmte und wohl schönste Schatzkammer Gruppenstärke Europas – das Historische Grüne Gewölbe. Hier entdecken Sie max. 25 Teilnehmer während einer individuellen Audioguide-Tour, die originalgetreu Gebühr gestalteten barocken Prunkräume des Residenzschlosses und 60 € pro Gruppe zzgl. Eintritt genießen ein einzigartiges Ensemble aus Gold und Edelsteinen. Zur Buchung Die Königlichen Gemächer Augusts des Starken Paraderäume Dauer Die Führung zeigt die Paraderäume Augusts des Starken im 60 Minuten Residenzschloss. In den vier Sälen, bestehend aus Erstem Gruppenstärke Vorzimmer, Zweitem Vorzimmer, Audienzgemach und max. 25 Teilnehmer Paradeschlafzimmer, präsentierte der Kurfürst seine polnisch- Gebühr sächsische, könig-kurfürstliche Herrschaft der Außenwelt. Der 60 € pro Gruppe zzgl. Eintritt Besuch des kleinen Ballsaals mit seinen reichhaltigen Verzierungen aus Blattgold, Marmor und Stuck rundet die Führung ab. Zur Buchung Zum Buchungsformular Zwinger Der Zwinger - Barocke Pracht Gemäldegalerie Alte Meister, Porzellansammlung, Mathematisch Physikalischer Salon Dauer Der weltbekannte Dresdner Zwinger gehört zu den großartigsten 120 Minuten Bauwerken des Barocks in Deutschland. -

A Moral Persuasion: the Nazi-Looted Art Recoveries of the Max Stern Art Restitution Project, 2002-2013
A MORAL PERSUASION: THE NAZI-LOOTED ART RECOVERIES OF THE MAX STERN ART RESTITUTION PROJECT, 2002-2013 by Sara J. Angel A thesis submitted in conformity with the requirements for the degree of PhD Graduate Department Art University of Toronto © Copyright by Sara J. Angel 2017 PhD Abstract A Moral Persuasion: The Nazi-Looted Art Recoveries of the Max Stern Art Restitution Project, 2002-2013 Sara J. Angel Department of Art University of Toronto Year of convocation: 2017 In 1937, under Gestapo orders, the Nazis forced the Düsseldorf-born Jewish art dealer Max Stern to sell over 200 of his family’s paintings at Lempertz, a Cologne-based auction house. Stern kept this fact a secret for the rest of his life despite escaping from Europe to Montreal, Canada, where he settled and became one of the country’s leading art dealers by the mid-twentieth century. A decade after Stern’s death in 1987, his heirs (McGill University, Concordia University, and The Hebrew University of Jerusalem) discovered the details of what he had lost, and how in the post-war years Stern travelled to Germany in an attempt to reclaim his art. To honour the memory of Max Stern, they founded the Montreal- based Max Stern Art Restitution Project in 2002, dedicated to regaining ownership of his art and to the study of Holocaust-era plunder and recovery. This dissertation presents the histories and circumstances of the first twelve paintings claimed by the organization in the context of the broader history of Nazi-looted art between 1933-2012. Organized into thematic chapters, the dissertation documents how, by following a carefully devised approach of moral persuasion that combines practices like publicity, provenance studies, law enforcement, and legal precedents, the Max Stern Art Restitution Project set international precedents in the return of cultural property. -

NUREMBERG) Judgment of 1 October 1946
INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL (NUREMBERG) Judgment of 1 October 1946 Page numbers in braces refer to IMT, judgment of 1 October 1946, in The Trial of German Major War Criminals. Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany , Part 22 (22nd August ,1946 to 1st October, 1946) 1 {iii} THE INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL IN SESSOIN AT NUREMBERG, GERMANY Before: THE RT. HON. SIR GEOFFREY LAWRENCE (member for the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) President THE HON. SIR WILLIAM NORMAN BIRKETT (alternate member for the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) MR. FRANCIS BIDDLE (member for the United States of America) JUDGE JOHN J. PARKER (alternate member for the United States of America) M. LE PROFESSEUR DONNEDIEU DE VABRES (member for the French Republic) M. LE CONSEILER FLACO (alternate member for the French Republic) MAJOR-GENERAL I. T. NIKITCHENKO (member for the Union of Soviet Socialist Republics) LT.-COLONEL A. F. VOLCHKOV (alternate member for the Union of Soviet Socialist Republics) {iv} THE UNITED STATES OF AMERICA, THE FRENCH REPUBLIC, THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, AND THE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS Against: Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter Funk, Hjalmar Schacht, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Martin -

Jahresbericht 2012 Turnierwesen Und Prunkwaffen Aus Der Rüstkammer
www.skd.museum bericht 2012 S 2012 Jah re · en sd Neu in Dresden SEIT 19. FEBRUAR 2013 Der neue Riesensaal ammlungen Dre im Residenzschloss S t Turnierwesen und Prunkwaffen S aus der Rüstkammer Staatliche Kun SEIT 14. APRIL 2013 Mathematisch-Physikalischer Salon im Zwinger Meilensteine des Wissens Meisterwerke der Kunst Anzeige_Jahresbericht_210x170.indd 1 10.04.13 15:28 4 Neu in Dresden seit 19. FeBrUAr 2013 Der neue Riesensaal im Residenzschloss Jahresbericht 2012 Turnierwesen und Prunkwaffen aus der Rüstkammer AB 14. April 2013 Mathematisch-Physikalischer Salon im Zwinger Meilensteine des Wissens Meisterwerke der Kunst Gefördert durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages Hauptförderer Sponsored by Medienpartner www.skd.museum Kunsthalle im Lipsiusbau Residenzschloss Jägerhof Seite 5 Seite 17 son der Vorwort Das Kupferstich-Kabinett ausstellungen und die Zeitgenossen: Gert und Uwe Tobias zu Gast Seite 27 im Fokus in Dresden Ausstellungen in Dresden, Sachsen und bundesweit Seite 7 Ein Fest für die schönste i nstitution Seite 44 Frau der Welt: 500 Jahre im Wan del Ausstellungen im Ausland Sixtinische Madonna Seite 19 Seite 10 Zum Amtsantritt von aus den Kunst will Kritik: Dr. Hartwig Fischer sammlu ngen Im Netzwerk der Moderne Aufgaben – gegenwärtige, Seite 13 kommende Seite 47 Von Herrnhut in die Welt: Seite 23 Erwerbungen und Schenkungen das Völkerkundemuseum Das Albertinum: Ein Treffpunkt in neuem Gewand Seite 53 der Künste Publikationen Seite 14 Seite 24 Schatzkunst -
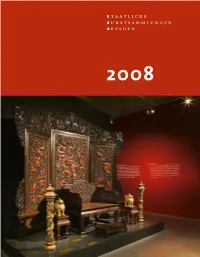
2008 T R O Ep R 2008 N A
of the 18th century, Rüstkammer of the 18thcentury, 1st half Tatar, or Ottoman Saddle, comes comes of the orient The fascination Cammer“ “Türckische the 2009–OpeningofDecember to to the Residenzschloss STaaTliChe Kunstsammlungen Dresden · annual repOrT 2008 2008 ANNUAL REPORT 2008 Albertinum Zwinger with Semperbau Wasserpalais, Schloss Pillnitz Page 4 International Special ExhibiTions Foreword PARTNERshiPs Page 27 Page 17 Special exhibitions in Dresden China iN Dresden Message of greeting from the and Saxony in 2008 iN ChiNA Federal Minister for Foreign Affairs Page 34 Page 18 Special exhibitions abroad in 2008 Page 9 The Staatliche Kunstsammlungen Cultural exchange past and future – Dresden in international dialogue a year of encounters between Dresden WiTh kind support and Beijing Page 24 Trip to Russia Launch event with Helmut Schmidt Page 37 and Kurt Biedenkopf Page 25 In your mid-20s? Off to the museum! Visit to Warsaw Page 10 Page 38 Seven exhibitions and a Societies of friends wide-ranging programme of events Page 38 Page 13 Sponsors and donors in 2008 A chance to work abroad Page 40 Page 14 Partners from the business world China in Dresden Page 15 Dresden in China Residenzschloss Jägerhof Lipsiusbau on the Brühlsche Terrasse From ThE collections Visitors Museum bUildiNgs Page 43 Page 63 Page 75 Selected purchases and donations A host must be prepared – improving Two topping-out ceremonies and our Visitor Service will remain a surprising find mark the progress Page 47 an important task in the future of building work at the museums -

Ja Hresber Ic Ht 2 0 11
Madonna_Sixtinisch_Jahresbericht_Anzeige_210x170mm.indd 1 26. Mai – 26. August 2012 26. – Mai 26. Staatliche KunstsammlungenDresden Alte Meister, Gemäldegalerie Raffaels KultbildfeiertGeburtstag. Die SixtinischeMadonna— 500. WIRD WELT DER FRAU SCHÖNSTE DIE 09.03.12 11:34 Staatliche KunStSammlungen Dresden · Jah reSbericht 2011 2011 Kunsthalle im Lipsiusbau Semper Building at the Zwinger Schloss Pillnitz, Bergpalais Page 5 Page 18 sPEcIAL EXHIBITIONs Foreword Back on public display at last: The “Canaletto View” Page 29 Page 19 Exhibitions in Dresden, Saxony and I N FOcUs The Dream of a King. throughout Germany Dresden’s Green Vault Page 42 Page 7 Exhibitions abroad The Art of the Enlightenment Page 10 A cHANGI NG The Power of Giving INsTITUTION FROM TH E Page 12 cOLLEcTIONs On the departure of The Third Saxon State Exhibition: Prof. Dr. Martin Roth via regia – 800 Years of Mobility Page 45 and Movement Page 21 Selected purchases and donations Motivated by cultural convictions Page 14 Page 50 Heavenly Splendour: Page 23 Selected publications Raphael, Dürer and Grünewald Ten years at the Staatliche Page 53 paint the Madonna Kunstsammlungen Dresden Selected restoration projects Page 16 On the departure of Neue Sachlichkeit in Dresden. Dr. Moritz Woelk 1920s paintings from Dix to Querner Page 26 From Benedetto Antelami to Tony Cragg – Moritz Woelk in Dresden’s Albertinum Japanisches Palais Albertinum GRASSI Museum Leipzig SCIENTIFIc AN D VIsITORs NEWs I N BRI EF REsEARcH PROJ EcTs Page 77 Page 89 Page 59 The Future of Museums – youth Scientific