FFH-Verträglichkeitsprüfung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ein Besonderes Schmuckstück in Tauer
Beilage: Amtsblatt für das Amt Peitz/Amtske Ωopjeno za amt Picnjo mit seinen Gemeinden Drachhausen, Drehnow, Heinersbrück, Jänschwalde, Tauer, Teichland, Turnow-Preilack und der Stadt Peitz 4. Jahrgang · Nr. 14 · Amt Peitz, 16.10.2013 Ein besonderes Schmuckstück in Tauer Direkt an der Hauptstraße gelegen, nahezu in der Dorfmitte, ist das Feuerwehrgebäude mit seinem besonderen Baustil mit weißen Putzflächen sowie roten Ziegeleinfassun- gen und Eckpfeilern nicht zu übersehen. Das ursprüngliche Gerätehaus mit Uhren- turm wurde 1896 errichtet. An der Westsei- te wurde 1913 eine Turnhalle angebaut, die heute zur Fahrzeughalle gehört. Umfangreiche Um- und Ausbaumaßnah- men bis 2004 sicherten den Gebäudebe- stand und die moderne Nutzung dieses einzigartigen Feuerwehrgebäudes. Gleichzeitig ist die Feuerwehr auch Treff der Einwohner, z. B. zum Pfingstbaumstel- len oder zum Weihnachtsmarkt. 100 Jahre Gerätehaus der Feuerwehr Die Feuerwehr Tauer lädt ein zum Tag der offenen Tür am Donnerstag, dem 31. Oktober ab 13:30 Uhr abends Lampionumzug FF Gebäude Tauer Ein großes Dankeschön an alle Wahlhelfer Freie Wahlen bilden die Grundlage einer Demokratie. Für die Wahlbehörde ist es deshalb das Ziel, eine möglichst hohe Wahlbe- teiligung zu erreichen. Von unseren 9.599 Wahlberechtigten im Amtsbereich haben 6.869 Wähler von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Damit wurde eine Wahlbeteiligung von insgesamt 71,6 Prozent erreicht. Im Amt Peitz wurden 17 Wahllokale und ein Briefwahlvorstand mit Helfern besetzt. Insgesamt waren dabei 134 Wahlhelfer im Einsatz. Dank der Hilfe vieler Ehrenamtlicher konnten wir in nahezu allen Ortsteilen Wahllokale für die Bürger bereitstellen. Manche Wahlberechtigte wollten irrtümlich im Bürgerbüro wählen gehen und mussten natürlich in ihre Ortsteile zurück geschickt werden. -

Entdeckerbuch
Organisation Muskauer Faltenbogen der Vereinten Nationen UNESCO Global für Bildung, Wissenschaft Geopark und Kultur Organizacja Narodów Łuk Mużakowa Zjednoczonych dla Światowy Geopark Wychowania, Nauki i Kultury UNESCO Entdeckerbuch ... auf den Spuren der Rohstoffe im UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa INHALT Seite Bevor ihr losgeht… 5 BRAUNKOHLE 6 Entdeckertour 1 - Die Alte Grube Hermann 8 Entdeckertour 2 - Rund um den Felixsee 11 Entdeckertour 3 - Die Alte Grube Babina bei Łęknica 14 Wissen! pH-Wert 14 Am Wegesrand! Zeigerpflanzen 17 GEOTOPE Quellen - Ursprung des Lebens 18 QUARZSAND 20 Entdeckertour 4 - Altbergbautour 22 Wissen! Waldbrandgefahrenstufen 24 ALAUN 25 Entdeckertour 5 - Auf den Spuren Fürst Pücklers 26 WASSER 31 Entdeckertour 6 - Im Naturschutzgebiet „Am Mühlenbach – Nad Młyńską Strugą“ 32 Impressum SAND UND KIES 36 Redaktion: Entdeckertour 7 - „Märchenwald“ 38 UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen, Geschäftsstelle GEOTOPE Moore - Geheimnisvolle Lebensräume 41 Muskauer Straße 14 03159 Döbern [email protected] TON 42 www.muskauer-faltenbogen.de Entdeckertour 8 - Drachenberge bei Krauschwitz 44 Gestaltung und Layout: Am Wegesrand! Drachen in der Lausitz 46 UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen/ Łuk Mużakowa, Geschäftsstelle Wissen! Fingerprobe 47 Fotos: Axel Heimken, Mainz; Peter Radke, LMBV; Stitung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau“ FINDLINGE 49 UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen/ Łuk Mużakowa, Geschäftsstelle GEOTOPE Dünen - Vom Wind verweht 51 Entdeckertour 9 - Vom Schweren Berg nach Nochten 52 Druck: Druckerei Chroma, Żary I. Ausgabe, September 2017 2 3 Liebe Entdecker! Herzlich willkommen im UNESCO Global Geopark Muskauer Faltenbogen / Łuk Mużakowa! Der Muskauer Faltenbogen gilt als eine der schönsten eiszeitlichen Hinterlassenschaften Mitteleu- Hi, ich bin Susi! ropas. Die markante Stauchendmoräne in Hufeisenform entstand vor. -

Jahresforschungsbericht BTU Cottbus 2002/2003
Jahresforschungsbericht 2002/2003 Brandenburgische Technische Universität Cottbus Drittmittelforschungsprojekte Publikationen Abgeschlossene Promotionen und Habilitationen 1 Impressum: Herausgeber: Der Präsident der BTU Cottbus Prof. Dr. rer. nat. habil. Dr. h.c. Ernst Sigmund Der Vizepräsident für Forschung Prof. Dr.-Ing. Gerhard Lappus BTU Cottbus Postfach 10 13 44 03013 Cottbus Tel.: 0355 69-2151 / -2809 Fax: 0355 69-3732 / -2156 Redaktion: Dr. Monika Rau Stand: 31.12.2003 Druck: Reprographie der BTU Cottbus 2 Inhaltsverzeichnis: Inhalt 3 Vorwort 5 Übersichten zur Entwicklung und zum Stand der Drittmitteleinwerbung 7 Tabelle 1: Entwicklung der Drittmitteleinwerbung der BTU Cottbus 9 Tabelle 2: Drittmitteleinnahmen BTU Cottbus nach Fördermittelgeldern 10 Tabelle 3: Drittmittelprojekte 2002/2003 nach Fakultäten 11 Teil 1: Drittmittelforschungsprojekte 12 Fakultät für Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik 14 Forschungsschwerpunkte der Fakultät 16 Drittmittelforschungsprojekte 19 Institut für Mathematik 19 Institut für Informatik 20 Institut für Physik und Chemie 24 Philosophie und Technikgeschichte 31 Fakultät für Architektur, Bauingenieurwesen und Stadtplanung 33 Forschungsschwerpunkte der Fakultät 35 Drittmittelforschungsprojekte 37 Institut für Gesellschaftliche Grundlagen des Planens und Bauens 37 Institut für Darstellung und Gestaltung 38 Institut für Städtebau und Landschaftsplanung 38 Institut für Entwerfen 39 Institut für Grundlagen des Bauingenieurwesens 40 Institut für Bautechnik 44 Institut für Konstruktiven Ingenieurbau -

Muster SPN-Kurier.Qxd 02.09.2020 08:19 Seite 1 Aammttssbbllaatttt
Amtsblatt online-11.2020_Muster SPN-Kurier.qxd 02.09.2020 08:19 Seite 1 AAmmttssbbllaatttt für den Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa Amtske łopjeno za Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa Jahrgang 13 · Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca), den 11. September 2020 · Nummer 11 AMTLICHER TEIL Inhaltsverzeichnis ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN AMTLICHER TEIL Auf der Grundlage der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19] S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN (GVBl. I/19, [Nr. 38]) und des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN (GKGBbg) vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr. 32] S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl. I/19, [Nr. 38]) hat die Verbandsversammlung des Trink- und Abwasserverban - Verbandssatzung des Trink - und des - Hammerstrom/Malxe - Peitz in ihrer Sitzung am 16.06.2020 folgende Neufassung der Abwasserverbandes Verbandssatzung des Trink - und Abwasserverbandes - Hammerstrom/Malxe – Peitz (TAV) Seite 1 - Hammerstrom/Malxe – Peitz (TAV) beschlossen. Es handelt sich um eine Neufassung aufgrund des § 31 Abs. 1 Satz 3 GKGBbg. § 1 Name und Sitz des Zweckverbandes (2) Der Zweckverband kann sich zur Erfüllung (1) Der Zweckverband führt den Namen "Trink- seiner Aufgaben Dritter bedienen und Unter - und Abwasserverband - Hammerstrom/Malxe nehmen gründen oder sich an Unternehmen - Peitz" (TAV). beteiligen. Der Zweckverband kann Aufgaben (2) Der Zweckverband hat seinen Sitz in der nach § 5 Absatz 1 dieser Verbandssatzung Stadt Peitz/Picnjo im Land Brandenburg, Kraft - gemäß § 12 Absatz 1 GKGBbg i. V.m. § 91 Ab - werkstraße 28 a. -

Landkreis Spree-Neiße Stand: 31.12.2020
Denkmalliste des Landes Brandenburg Landkreis Spree-Neiße Stand: 31.12.2020 Spree-Neiße Die Denkmalliste ist gegliedert in: A) Bodendenkmale B) Durch Verordnung festgelegte Grabungsschutzgebiete C) Durch Satzung geschützte Denkmalbereiche D) Denkmale übriger Gattungen (Bau- und Kunstdenkmale) A) Bodendenkmale Gemarkung Flur Kurzansprache Boden- denkmal- nummer Atterwasch 2 Friedhof deutsches Mittelalter, Dorfkern deutsches Mittelalter, Kirche Neuzeit, 120352 Kirche deutsches Mittelalter, Friedhof Neuzeit, Dorfkern Neuzeit Atterwasch 2 Gräberfeld Eisenzeit, Gräberfeld Bronzezeit 120353 Babow 1 Gräberfeld slawisches Mittelalter, Siedlung Urgeschichte 120002 Babow 1 Siedlung Bronzezeit 120340 Babow 1 Siedlung slawisches Mittelalter, Gräberfeld Bronzezeit 120341 Babow 1 Siedlung slawisches Mittelalter 120343 Babow 1 Siedlung slawisches Mittelalter, Siedlung Eisenzeit 120344 Babow 1 Siedlung Bronzezeit 120345 Babow 1 Siedlung Eisenzeit, Siedlung slawisches Mittelalter 120346 Babow 1 Siedlung Eisenzeit, Siedlung römische Kaiserzeit, Siedlung slawisches Mittelalter 120347 Babow 1 Dorfkern deutsches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit 120348 2 Babow 1 Einzelfund Eisenzeit 120479 Babow 1 Siedlung Bronzezeit, Siedlung Eisenzeit, Siedlung slawisches Mittelalter 120484 Babow, 1 Burgwall Eisenzeit, Siedlung slawisches Mittelalter 120001 Werben 2 Bagenz 2 Dorfkern deutsches Mittelalter, Dorfkern Neuzeit, Turmhügel deutsches Mittelalter 120565 3 Bärenbrück 2 Siedlung Bronzezeit, Siedlung Neolithikum, Siedlung Eisenzeit, Rast- und 120108 Werkplatz Mesolithikum -

Managementplanung Natura 2000 Im Land Brandenburg
Natur Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg - Kurzfassung - Managementplan für das Gebiet „Spree“ Impressum Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg Managementplan für das Gebiet „Spree“ Landesinterne Melde Nr. 651, EU-Nr. DE 3651-303 Titelbild: Malxe bei Peitz im FFH-Gebiet „Spree“ (Kühnapfel) Förderung: Gefördert durch die ILE-Richtlinie aus Mitteln der Europäischen Union und des Landes Brandenburg Herausgeber: Ministerium für Ländliche Entwicklung, Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg Umwelt und Landwirtschaft des Landes Brandenburg (MLUL) Henning-von-Tresckow-Straße 2-13, Haus S Heinrich-Mann-Allee 18/19 14467 Potsdam 14473 Potsdam Tel.: 0331/ 866 7237 Tel.: 0331 – 971 64 700 E-Mail: [email protected] E-Mail: [email protected] Internet: www.umwelt.brandenburg.de Internet: www.naturschutzfonds.de Bearbeitung: Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR Wermsdorfer Straße 17 04758 Oschatz Tel.: 03435/931 644 E-Mail: [email protected] Internet: www.langegbr.de Projektleitung: Dipl.-Biol. K.-B. Kühnapfel unter Mitarbeit von: Dr. forest. K.-H. Biederbick Dipl.-Biogeogr. A. Dlugosz Dipl.-Geogr. T. Hübl Dipl.-Biol. Dorian Schöter Fachliche Betreuung und Redaktion: Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg Verfahrensbeauftragter Ullrich Schröder, Tel.: 0355 – 476 366 4, E-Mail: [email protected] Arne Korthals, Tel.: 0331 - 971 64 854, E-Mail: [email protected] Cottbus, im September 2015 Managementplanung Natura 2000 für das FFH-Gebiet „Spree“ Inhaltsverzeichnis 1. Gebietscharakteristik -
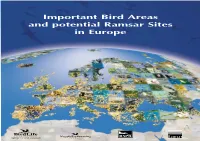
Important Bird Areas and Potential Ramsar Sites in Europe
cover def. 25-09-2001 14:23 Pagina 1 BirdLife in Europe In Europe, the BirdLife International Partnership works in more than 40 countries. Important Bird Areas ALBANIA and potential Ramsar Sites ANDORRA AUSTRIA BELARUS in Europe BELGIUM BULGARIA CROATIA CZECH REPUBLIC DENMARK ESTONIA FAROE ISLANDS FINLAND FRANCE GERMANY GIBRALTAR GREECE HUNGARY ICELAND IRELAND ISRAEL ITALY LATVIA LIECHTENSTEIN LITHUANIA LUXEMBOURG MACEDONIA MALTA NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL ROMANIA RUSSIA SLOVAKIA SLOVENIA SPAIN SWEDEN SWITZERLAND TURKEY UKRAINE UK The European IBA Programme is coordinated by the European Division of BirdLife International. For further information please contact: BirdLife International, Droevendaalsesteeg 3a, PO Box 127, 6700 AC Wageningen, The Netherlands Telephone: +31 317 47 88 31, Fax: +31 317 47 88 44, Email: [email protected], Internet: www.birdlife.org.uk This report has been produced with the support of: Printed on environmentally friendly paper What is BirdLife International? BirdLife International is a Partnership of non-governmental conservation organisations with a special focus on birds. The BirdLife Partnership works together on shared priorities, policies and programmes of conservation action, exchanging skills, achievements and information, and so growing in ability, authority and influence. Each Partner represents a unique geographic area or territory (most often a country). In addition to Partners, BirdLife has Representatives and a flexible system of Working Groups (including some bird Specialist Groups shared with Wetlands International and/or the Species Survival Commission (SSC) of the World Conservation Union (IUCN)), each with specific roles and responsibilities. I What is the purpose of BirdLife International? – Mission Statement The BirdLife International Partnership strives to conserve birds, their habitats and global biodiversity, working with people towards sustainability in the use of natural resources. -

Kommunale Abwasserbeseitigung Im Land Brandenburg – Lagebericht 2007 Landkreis Spree-Neiße/Cottbus Seite 86 Kläranlagen Des Landkreises Spree-Neiße/Cottbus
Kommunale Abwasserbeseitigung im Land Brandenburg – Lagebericht 2007 Landkreis Spree-Neiße/Cottbus Seite 86 Kläranlagen des Landkreises Spree-Neiße/Cottbus Flussgebietseinheit, Lagekoordinaten Anforderungen Jahr der Bearbeitungsgebiet (ETRS-89) Art der eingehalten letzten Ausbaugröße nach WRRL Name der Kläranlage Rechtswert Hochwert Behandlung (Tabelle 1) Modernisierung (EW) Einleitgewässer Kläranlagen > 100.000 EW Cottbus 3455235 5736034 mbNPJa 1998 300.000 Spree Elbe, Mittlere Spree Kläranlagen > 10.000 - 100.000 EW Spremberg-Nord 3456490 5714326 mbNP Ja2005 50.000 Spree Elbe, Obere Spree Forst 3475838 5734523 mbNP Ja1998 30.000 Lausitzer Neiße Oder, Lausitzer Neiße Peitz 3459623 5744501 mbNP Ja1994 12.000 Hammergraben Elbe, Mittlere Spree Burg 3442166 5741784 mbNP Ja2005 12.000 Südumfluter Elbe, Mittlere Spree Kläranlagen 2.000 - 10.000 EW Drebkau 3445194 5724100 mbNJa 1995 6.000 Steinitzer Wasser Elbe, Mittlere Spree Groß Schacksdorf 3474260 5725497 mbNein 1981 3.500 Graben 18 Oder, Lausitzer Neiße Kläranlagen 100 - < 2.000 EW Döbern 3472250 5719172 mbNJa 1992 1.999 Malxe Oder, Lausitzer Neiße Kolkwitz-Klinikum 3446112 5732323 mbJa 1982 1.500 Zuflussgraben zum Priorgraben Elbe, Mittlere Spree Friedrichshain 3470384 5716442 mbJa 1960 1.500 Rudolfschacht Oder, Lausitzer Neiße Hornow 3466015 5721084 mbNJa 1995 1.000 Hornower Grenzgraben Elbe, Mittlere Spree Bohsdorf 3468086 5719341 mbNJa 1991 550 Wolschingraben Elbe, Mittlere Spree Sergen 3465409 5727467 mbJa 2000 400 Tranitzfließ Elbe, Mittlere Spree Haidemühl 3446037 5711602 mbJa 1995 -
Wanderungen Zwischen Spree Und Neiße
Regionale Produkte fürs Picknick siehe QR-Codes zu den Touren Impressum: Herausgeber: Landkreis Spree-Neiße, Fachbereich Bau und Planung Mit freundlicher Unterstützung der Tourist-Infor ma tio nen Burg (Spreewald), Peitz, Guben, Forst (Lau sitz), Sprem berg, Cott bus, der Geschäftsstelle des UNESCO Global Geopark Muskauer Falten bo gen und der Wan derwegewarte Heinz Schus ter, Horst Jäkel, Torsten Rich ter-Zippack, Günter Mertsch Gesamtherstellung: VERLAG Reinhard Semmler GmbH (17-51) Str. der Jugend 54 · 03050 Cottbus www.verlag-semmler.de Fotos: R. Weisflog, T. Rostek, K. Langer, A. Schild, T. Richter-Zippack, G. Geipel, TV Niederlausitz e.V., Archive der Tourist info r ma - tionen und des Landkreises Spree-Neiße Kartografie: 2018 © VERLAG Reinhard Semmler GmbH Gestaltung: Nadine Wischke Druck: Druckerei Schiemenz GmbH 4. Auflage (2018) · Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Vervielfältigungen jeglicher Art sind untersagt. Inhalt Touristinformationen 2 Vorwort 3 Hinweise & Tipps 4 Markierung und Beschilderung der Wanderwege 4 Guter Rat vom Wanderwegewart 5 Wandergruppen, Wanderleiter 6 Wanderkartenempfehlungen 7 Europäischer Wanderweg E10 8 Abschnitt Burg (Spreewald) – Werben 8 Abschnitt Werben – Cottbus Altstadtkern 10 Abschnitt Cottbus – Neuhausen/Spree 12 Abschnitt Neuhausen/Spree – Kromlau 14 Bereich Burg (Spreewald) 16 Wandern & Walken in Burg (Spreewald) 16 Nowy Rundweg 18 Fontane Weg 20 Bereich Guben 22 Deulowitzer See und Kaltenborner Berge 22 Rund um den Göhlensee 24 Pinnower See 26 Naturschutzgebiet -

REK) Cottbus/Chó Ebuz – Guben – Forst (Lausitz
Evaluation und Fortschreibung des Regionalen Entwicklungskonzeptes (REK) Cottbus/Chóebuz – Guben – Forst (Lausitz)/Barš (Łužyca) Im Auftrag des Landkreises Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa Sprje- REK Cottbus/Chóśebuz – Guben – Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) 2021 IMPRESSUM Auftraggeber Landkreis Spree-Neiße/Wokrejs Sprjewja-Nysa Heinrich-Heine-Straße 1 03149 Forst (Lausitz) vertreten durch: Harald Altekrüger (Landrat) Olaf Lalk (Erster Beigeordneter / Dezernent) Thomas Brase (Leiter SG Kreis-/Bauleitplanung/Tourismus) E-Mail: [email protected] / [email protected] Tel. (03562) 986-10101 / (03562) 986-16103 Auftragnehmer LOKATION:S, Partnerschaft für Standortentwicklung Liepe+Wiemken Dipl.-Ingenieure Sanderstraße 29/30 12047 Berlin E-Mail: [email protected] Tel. (030) 49 90 51 80 Bearbeitung: Susann Liepe, Dipl.-Ing. Thomas Wude, Dipl.-Ing. I M.Sc. Sven Guntermann, Dipl.-Ing. Max Heß, Dipl.-Ing. Dr. Katharina Knaus, M.A. Kim Brademann, cand. M.A. Ronja Kelch, Cand. B.Sc. Anne-Marie Wulff, cand. M.Sc. Die Evaluation und Fortschreibung des REK wurde unterstützt mit Mitteln der Gemeinsamen Landespla- nungsabteilung (GL) Berlin-Brandenburg. Stand April 2021 2 REK Cottbus/Chóśebuz – Guben – Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) 2021 Hinweis: Im Bericht werden deutsche und sorbische/wendische Bezeichnungen für Orte verwendet, so wie diese in der Übersicht „Sorbische/wendische Ortschaftsnamen in Brandenburg“ (Stand 2020) aufgeführt sind. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird im Bericht keine explizit Gender-gerechte Sprache verwen- det, -

1 the Bismarck Tower in Burg 2 Schlossberghof Herb Farm in Burg 3 Dissen/Dêsno 4 Heimatstube Burg (Spreewald) 8 Altmarkt with T
1 The Bismarck Tower in Burg 2 Schlossberghof herb farm in Burg 3 Dissen/Dêsno 4 Heimatstube Burg (Spreewald) 5 Spreewald Therme – the brine bath 6 Calauer Witzerundweg nature trail 7 Calauer Schweiz viewing tower The 27m-high lookout tower on the fabled Schloss- Visitors to the Schlossberghof farm can enjoy nature “Dissen would just be a normal village if it weren’t The Heimatstube Burg is a small but impressive museum surrounded by nature Calau is the birthplace of the “Kalauer” or “pun”, If you climb the 216 steps of the 43-metre high stone berg, a pre- and protohistoric rampart, was built in with all their senses. Here, Spreewald herbs and crops for the many stork nests, the beautiful half- housed in a thatched log cabin typical of the Spreewald. Here the focus is firmly on relaxation: A cosy as in the 19th century the shoemakers who worked viewing tower in the Calauer Schweiz, you will be 1915–17. It offers a wide view of the Spreewald land- are cultivated in the herb garden and sold in the farm timbered church and the marvellous local-history It provides an interesting insight into Burg, its history atmosphere, modern ambience, warmth and here used to churn out jokes and delight in the am- rewarded with a panoramic view of the nature reserve and the scape, and as Burg’s landmark is a popular excursion shop. The information centre includes an interactive exhibition museum ...”, wrote a journalist once. Dissen in fact and its legends, including church history, traditional tranquillity ensure a relaxing stay at the heart of the UNESCO Spree- biguity of words. -

Dem Unterhaltungsplan
Gewässerverband Unterhaltungsplan 2021/ 2022 (ungerades Jahr) 1 von 49 Spree-Neiße Summen über Alle 1.213.546,3 1.126.338,4 WBV alte innerhalb d. unser Gewässer spezielle EZG TA Gewässer Hauptname von Stat bis Stat Länge ver-rohrt offen Zeitraum Aufgaben aus sonstiges/ Eventuelles Nr. (Los.Nr) Gemeinde Typ Zyklus (dies) jährig Bedarfsfall Gewässerschauen keine Regelunter- Neißemünde A 1 1 26.3 Grano-Buderoser Mühlenfließ 0,0 1.950,0 1.950,0 15 1.935,0 naturnahe Vorflut variabel Abflusskontr. Abfluss-Kontr. haltung!!! Mäander Grano-Buderoser Juli + SK/ GR akte Bypass alternativ zu Guben A 1neu 1 ohne Mühlenfließ (Bypass) 0,0 797,0 797,0 0 797,0 Hauptvorfluter Sept/Okt BKE + SKAb Hauptstrom alte Vorflut 2te SK A 1 3 26.3 Grano-Buderoser Mühlenfließ Guben, Stadt 1.950,0 4.931,0 2.981,0 15 2.966,0 Hauptvorfluter Juni/Juli BKE + SK Sept/Okt Spülg-RL Grano-Buderoser Mühlenfließ Juli + 2te SK A 1 4 26.3 oh Ablass Krayner Teiche Schenkendöbern 4.931,0 11.225,0 6.294,0 13 6.281,0 Hauptvorfluter Sept/Okt BKE + SK Sept/Okt E-Pos.-Spülg-RL keine Regelunter- Schenkendöbern A 1 5 26.3 Grano-Buderoser Mühlenfließ 11.225,0 22.265,0 11.040,0 30 11.010,0 naturnahe Vorflut variabel Abflusskontr. Abfluss-Kontr. haltung!!! Abschlag vom Gr. C Breesen A 1.0a 1 28.31a zum Mühlenfließ Guben, Bresinchen 0,0 56,0 56,0 7 49,0 C-Gewässer variabel Abfluss-Kontr. evtl. Rückbau A 1.12 1 26.1.1 GärtnereigrabenWildbirnengraben Graben Bresinchen vom Guben, Bresinchen 0,0 582,0 582,0 8 574,0 C-Gewässer Sept/ Okt uJh Bkerf; Skerf Wiesenschlauch Groß A 1.2 1 28.2.79 Breesen