Feststellungsbescheid
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
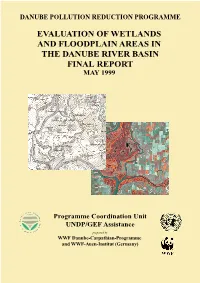
Evaluation of Wetlands and Floodplain Areas in the Danube River Basin Final Report May 1999
DANUBE POLLUTION REDUCTION PROGRAMME EVALUATION OF WETLANDS AND FLOODPLAIN AREAS IN THE DANUBE RIVER BASIN FINAL REPORT MAY 1999 Programme Coordination Unit UNDP/GEF Assistance prepared by WWF Danube-Carpathian-Programme and WWF-Auen-Institut (Germany) DANUBE POLLUTION REDUCTION PROGRAMME EVALUATION OF WETLANDS AND FLOODPLAIN AREAS IN THE DANUBE RIVER BASIN FINAL REPORT MAY 1999 Programme Coordination Unit UNDP/GEF Assistance prepared by WWF Danube-Carpathian-Programme and WWF-Auen-Institut (Germany) Preface The "Evaluation of Wetlands and Flkoodplain Areas in the Danube River Basin" study was prepared in the frame of the Danube Pollution Reduction Programme (PRP). The Study has been undertaken to define priority wetland and floodplain rehabilitation sites as a component of the Pollution reduction Programme. The present report addresses the identification of former floodplains and wetlands in the Danube River Basin, as well as the description of the current status and evaluation of the ecological importance of the potential for rehabilitation. Based on this evaluation, 17 wetland/floodplain sites have been identified for rehabilitation considering their ecological importance, their nutrient removal capacity and their role in flood protection. Most of the identified wetlands will require transboundary cooperation and represent an important first step in retoring the ecological balance in the Danube River Basin. The results are presented in the form of thematic maps that can be found in Annex I of the study. The study was prepared by the WWF-Danube-Carpathian-Programme and the WWF-Auen-Institut (Institute for Floodplains Ecology, WWF-Germany), under the guidance of the UNDP/GEF team of experts of the Danube Programme Coordination Unit (DPCU) in Vienna, Austria. -

VERBUND AG, Vienna, Republic of Austria (The "Issuer" Or "VERBUND"), Will Issue on 20 November 2014 (The "Issue Date") € 500,000,000 1.50 Per Cent
Dated 18 November 2014 (incorporated as a joint-stock corporation (Aktiengesellschaft) under the laws of the Republic of Austria) € 500,000,000 1.50 per cent. Notes due 2024 VERBUND AG, Vienna, Republic of Austria (the "Issuer" or "VERBUND"), will issue on 20 November 2014 (the "Issue Date") € 500,000,000 1.50 per cent. Notes due 2024 (the "Notes"). The Notes will be redeemed at par on 20 November 2024. The Notes will bear interest from and including 20 November 2014 to, but excluding, 20 November 2024 at a rate of 1.50 per cent. per annum, payable annually in arrear on 20 November in each year, commencing on 20 November 2015. This prospectus (the "Prospectus") constitutes a prospectus within the meaning of Article 5.3 of the Directive 2003/71/EC of the European Parliament and the Council of November 4, 2003, as amended (the "Prospectus Directive"). This Prospectus will be published in electronic form together with all documents incorporated by reference on the website of the Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu). This Prospectus has been approved by the Commission de Surveillance du Sector Financier of the Grand Duchy of Luxembourg (the "CSSF") in its capacity as competent authority under the Luxembourg law relating to prospectuses (Loi relative aux prospectus pour valeurs mobilières, the "Prospectus Law"), as amended, which implements the Prospectus Directive into Luxembourg law. The Issuer has requested the CSSF to provide the competent authority in the Republic of Austria ("Austria") with a certificate of approval attesting that the Prospectus has been drawn up in accordance with the Prospectus Law. -

Characterizing the Spatiotemporal Variability of Groundwater
Characterizing the spatiotemporal variability of groundwater levels of alluvial aquifers in different settings using drought indices Johannes Christoph Haas1, 2 and Steffen Birk1, 2 1Institute of Earth Sciences, NAWI Graz Geocenter, University of Graz, Austria 2FWF-DK Climate Change, University of Graz, Austria Correspondence to: Johannes Christoph Haas ([email protected]) Abstract. To improve the understanding of how aquifers in different alluvial settings respond to extreme events in a changing environment, we analyze standardized time series of groundwater levels (Standardized Groundwater level Index - SGI), pre- cipitation (Standardized Precipitation Index - SPI), and river stages of three subregions within the catchment of the river Mur (Austria). Using correlation matrices, differences and similarities between the subregions, ranging from the Alpine upstream 5 part of the catchment to its shallow foreland basin, are identified and visualized. Generally, river stages exhibit the highest correlations with groundwater levels, frequently affecting not only the wells closest to the river, but also more distant parts of the alluvial aquifer. As a result, human impacts on the river are transferred to the aquifer, thus affecting the behavior of groundwater levels. Hence, to avoid misinterpretation of groundwater levels in this type of setting, it is important to account for the river and human impacts on it. 10 While the river is a controlling factor in all of the subregions, an influence of precipitation is evident too. Except for deep wells found in an upstream Alpine basin, groundwater levels show the highest correlation with a precipitation accumulation period of six months (SPI6). The correlation in the foreland is generally higher than that in the Alpine subregions, thus corre- sponding to a trend from deeper wells in the Alpine parts of the catchment towards more shallow wells in the foreland. -

Die Schmetterlingsfauna an Der Mur Flussabwärts Von Graz
© Landesmuseum Joanneum Graz; download unter www.biologiezentrum.at Joannea Zool. 7: 35–169 (2005) Die Schmetterlingsfauna an der Mur flussabwärts von Graz (Lepidoptera) Heinz HABELER Zusammenfassung: Von Kalsdorf südlich Graz bis Bad Radkersburg an der Grenze zu Slowenien wurde der Schmetterlingsbestand systematisch punktuell an acht Stellen im Nahbereich der Mur untersucht, hinzu kommen noch zahlreiche Streufunde von weite- ren Stellen. Es konnten 1.127 Arten mit 11.643 Funddaten dokumentiert werden. Ins- gesamt wurden rund 89.100 Exemplare beobachtet und bestimmt. Der Bestand wird nach unterschiedlichen Gesichtspunkten ausführlich analysiert, die Ergebnisse sind re- präsentativ für die Murbegleitlandschaft entlang von rund 65 Flusskilometern. Es han- delt sich größtenteils um eine nachtaktive Laubwaldfauna mit geringen Anteilen hygro- philer Arten. Als weitgehend ungefährdet können 64 % der daraufhin untersuchten 648 Arten angesehen werden, allerdings sind als anthropogen gefährdet 12 % (Rote Liste-Arten) einzustufen. Die 191 Einzelstück-Arten (nur ein einziges Mal registriert) haben mit 17 % am Artbestand einen hohen Anteil. Bei 47 % aller Funddaten wurde nur ein einziges Exemplar der betreffenden Art beobachtet. Das lässt auf durchschnitt- lich kleine und schwache Populationen schließen. Mit logarithmischen Ansätzen wer- den Naturgesetze sichtbar gemacht. Abstract: From Kalsdorf, South of Graz to Bad Radkersburg at the border to Slovenia the fauna of Lepidoptera was investigated systematically at eight locations in the vicin- ity of the river Mur. More data are added from some other locations. 1.127 species were documented amounting to a total of 11.643 data. In total about 89.100 speci- mens were investigated and determined. The data were comprehensively analysed from various aspects. The results are representative of a ca. -

Smart Power. Sustainable Solutions for the Future of Energy
Smart Power. Sustainable solutions for the future of energy. DMA – Disclosures on Management Approach Supplement to the Integrated Annual Report 2017 Disclosures on Management Approach In this document, we present an overview of VERBUND’s central management systems. Date: 31 December 2017 Contents Strategy ............................................................................................................................................... 5 Corporate Governance ..................................................................................................................... 5 The Austrian Code of Corporate Governance ........................................................................ 5 Implementation of the Code of Corporate Governance at VERBUND ................................ 5 Management board ................................................................................................................... 6 Supervisory board ..................................................................................................................... 6 Annual General Meeting .......................................................................................................... 7 Rules of procedure .................................................................................................................... 8 Minority protection in stock corporation law ......................................................................... 8 Stakeholder management ............................................................................................................... -

Co2-Reduction Targets Call for Applying Bat; a New 800 Mw Combined Cycle Power Plant South of Graz
Parallel session Producing more with less: Efficiency in Power Generation CO2-REDUCTION TARGETS CALL FOR APPLYING BAT; A NEW 800 MW COMBINED CYCLE POWER PLANT SOUTH OF GRAZ Josef Tauschitz, Martin Hochfellner VERBUND-Austrian-Thermal Power GmbH & Co KG CO2-REDUCTION TARGETS CALL FOR APPLYING BAT; A NEW 800 MW COMBINED CYCLE POWER PLANT SOUTH OF GRAZ Josef Tauschitz, Martin Hochfellner, VERBUND-Austrian-Thermal Power GmbH & Co KG ABSTRACT Seeing the problem of increasing electricity demand in Austria combinded with the targets to reduce CO2 emissions and the fact that older power stations will be closed, Verbund has decided to start the project work for a 800MW gas fired combined cycle power plant south of Graz. The project targets are to realize a power plant according to best available technology. In the presentation the state of the art of combined cycle power plants will be presented on basis of this new Verbund project. Also the environmental effects of the technology change (partial replacement of existing units by new units using BAT) will be presented. 1 1 Short description of Austrian Thermal Power / ATP ATP is a company of the Verbund Group, which operates thermal power plants. In 2003 ATP produced 5,97 TWh electricity, of which 91 % from coal and 9 % from oil. The installed capacity amounts 1901 MW, from this capacity 756 MW are already in cold standby. Because of the closing of a coal mine another 330 MW unit will be transferred to cold standby in 2006. By this the capacity of ATP power stations will be reduced to 850 MW in total. -

BIG Solar Graz: Results of a Techno-Economic Feasibility Study
BIG Solar Graz: Results of a techno-economic feasibility study Patrick Reitera*, Hannes Poiera, Christian Holtera aS.O.L.I.D., Gesellschaft für Solarinstallation und Design mbH, Puchstrasse 85, 8010, Graz, Austria Abstract Current heat generation for district heating (DH) in Graz, Austria is primarily from waste heat of fossil-fired combined heat and power (CHP) plants. Due to low prices on the European electricity market, the operation of CHP plants is not economic sound anymore and may lead to problems for cities, that are highly dependent on the heat of such plants. The operator of the CHP plants in Graz recently announced their closure in 2020. Almost 80% of the overall heat production has to be replaced. The research focus of this paper is to analyze the technical and economic potential of integrating a centralized large-scale solar thermal system including seasonal pit storage and absorption heat pumps for DH. Therefore, the purpose of the research is to determine the techno-economic optimum size of such a solar system, that can be integrated into the district heating system of Graz. The study includes the design of a technical concept using dynamic simulation, an investigation of appropriate land for collectors and the storage and an economic cost evaluation of its realization. First results indicate a techno-economic optimum of the system of 450,000 m² providing 20% solar fraction of the overall heat demand. Especially, the use of a series of absorption heat pumps with a total capacity of 100 MW is a key element in the system in order to accelerate the cooling down process of the seasonal pit storage and enables a higher solar fraction. -

Umwelterklärung Mellach 2018
Kraftwerksstandort Mellach Umwelterklärung 2018 VERBUND Thermal Power GmbH & Co KG REG.NO. AT-000002 Kraftwerksstandort Mellach VERBUND Thermal Power GmbH & Co KG Umwelterklärung 2018 Redaktion VERBUND Thermal Power GmbH & Co KG, Werksgruppe Mellach/Werndorf: Krenn Peter, Parfuß Manfred, Ziegler Werner, Schöngrundner Werner, Wolkerstorfer Gerhard Berichtsart Umwelterklärung 2018 gem. geltender EMAS-VO Anmerkungen Daten bis Ende 2017 2/45 Umwelterklärung 2018 – Kraftwerksstandort Mellach Vorwort der Geschäftsführung Für die VERBUND Thermal Power GmbH & Co KG (VTP), einen der größten Strom- und Fernwärmeproduzenten Österreichs, stellt die Umweltverantwortung eine maßgebliche Handlungsgrundlage dar. Die VTP ist stolz darauf, dass das Fernheizkraftwerk (FHKW) Mellach und das Gas- und Dampfturbinen-Kombinationskraftwerk (GDK) Mellach der erste Kraftwerksstandort in Österreich war, der bereits 1996 freiwillig der Öko-Auditierung unterzogen wurde. Zur Optimierung der umweltrelevanten Aktivitäten wurde ein Managementsystem gemäß EMAS- Verordnung und international gültigen Norm ISO 14001 eingeführt. Es unterstützt den Standort bei der freiwilligen und kontinuierlichen Verbesserung, über den gesetzlichen Rahmen hinaus, sowie bei der Steuerung der Arbeitsabläufe und ermöglicht eine entsprechende Nachweisführung. Basierend auf den Umweltleitsätzen von VERBUND wurde eine standortbezogene Umweltpolitik erstellt. Periodisch werden alle relevanten Tätigkeiten in technischer und organisatorischer Hinsicht überprüft. Aus den dabei gewonnenen Erkenntnissen, -

Gas- Und Dampfturbinen-Kombinationskraftwerk Mellach Zusammenfassung Der Umweltverträglichkeitserklärung
Gas- und Dampfturbinen-Kombinationskraftwerk Mellach Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitserklärung Verfasser: Dipl.-Ing. Martin Hochfellner Ing. Peter Krenn Dipl.-Ing. Dr. Armin Baumgartner Ing. Egon Berl Zusammenfassung UVE / GDK Mellach Seite 2/66 VERBUND-Austrian Thermal Power GmbH & Co KG UVE / GDK Mellach Zusammenfassung INHALT 1 AUFGABENSTELLUNG 7 1.1 Einleitung 7 1.2 Anforderungen an eine Umweltverträglichkeitserklärung 8 1.3 Aufbau der Umweltverträglichkeitserklärung 9 2 GRÜNDE FÜR DIE AUSWAHL DES VERFAHRENS 10 2.1 Energiewirtschaftliche Notwendigkeit 10 2.2 Auswahl der Anlagentechnik 11 3 BESCHREIBUNG DES VORHABENS 13 3.1 Art und Zweck des Vorhabens 13 3.2 Projektphasen 13 3.2.1 Planungs-, Errichtungs- und Betriebsphase 13 3.2.2 Nachsorgephase 14 3.3 Standort 14 3.4 Technische Beschreibung des Vorhabens 15 3.4.1 Verfahrens- und Anlagentechnik 15 3.4.2 Emissionen 18 3.4.3 Stoffflüsse 21 4 FACHBEREICHE DER UVE 22 4.1 Energiewirtschaft 22 4.1.1 Beschreibung des Ist-Zustandes 22 4.1.2 Auswirkungen des Vorhaben 23 4.1.3 Gesamtbeurteilung aus energiewirtschaftlicher Sicht 23 4.2 Verkehr 24 4.2.1 Beschreibung des Ist-Zustandes bzw. der Nullvariante 24 4.2.2 Auswirkungen des Vorhabens – Bauphase 24 4.2.3 Auswirkungen des Vorhabens – Betriebsphase 25 4.2.4 Auswirkungen des Vorhabens – Störfall 25 4.2.5 Gesamtbeurteilung „Verkehr“ 25 VERBUND-Austrian Thermal Power GmbH & Co KG Seite 3/66 Zusammenfassung UVE / GDK Mellach 4.3 Ausbreitung und Klima 26 4.3.1 Ermittlung des Untersuchungsraums 26 4.3.2 Auswirkungen des Vorhabens – Bauphase -

Bürgerborschüre
www.goessendorf.com Bürgerinformation der Marktgemeinde Gössendorf 2 Vorwort Liebe Gössendorferinnen und Gössendorfer! In der heutigen Zeit erhält man jegliche Informationen schon in digitaler Form. Ob über Computer, Tablet oder Smartphone, das Internet steht praktisch überall zur Verfügung und man kann binnen weniger Sekunden Informationen fi nden. Auch wir haben mit unserer Homepage www.goes- sendorf.com eine informative Plattform geschaffen. Für alle jene, die Wissenswertes über die Marktgemeinde Gössendorf fernab der modernen Technik, gerne einfach nachschlagen möchten, ist diese Broschüre gedacht. Gemeinsam mit dem aktuellen Ortsplan von Gössendorf haben wir die wichtigsten Informationen kompakt zu- sammengefasst. Neben einem Überblick über unsere Einrichtungen fi nden Sie in dieser Ausgabe auch ein Verzeichnis über die in unserer Gemeinde ansässigen Betriebe und Dienstleister. © Furgler © Ich freue mich, stellvertretend für die gesamte Gemeindevertretung, dass es gelungen ist, wieder eine neue Bürgerbroschüre aufzulegen. Herzlich bedanken möchte ich mich beim Tourismusverband Gös- sendorf, der Werbeagentur „Windstärke 7“, dem Vermessungsbüro INNOGEO Ziviltechniker GmbH und vor allem den Mitarbeiterinnen im Gemeindeamt. Sie haben zum Gelingen dieser Broschüre wesentlich beigetragen. Viel Freude beim Nachschlagen! Ihr Bürgermeister Gerald Wonner 3 Tlg 2 018 Das Gemeindegebiet Gössendorf Kleinstädtisches Flair & grüne Ge- ner Infrastruktur und Stadtnähe punk- bzw. Landwirtschaftsbetriebe entfalten mütlichkeit – ein unerfüllbarer Wohn- tet. und verleihen Gössendorf genau die traum? Sympathische Wirklichkeit in Groß und Klein fühlen sich hier ge- richtige Dynamik. Um die individuellen Gössendorf! Die steirische Gemeinde nauso wohl wie Alt und Jung. Bewe- Wünsche und Anforderungen jedes in direkter Nachbarschaft zu Graz ver- gungsfreudige profi tieren von einem Einzelnen zu erfüllen, investiert die Ge- eint die Vorzüge beider Welten. -

Bestandserhebung Der Herpetofauna Des Unteren Murtals
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Herpetozoa Jahr/Year: 1994 Band/Volume: 7_1_2 Autor(en)/Author(s): Zimmermann Petra, Kammel Werner Artikel/Article: Bestandserhebung der Herpetofauna des unteren Murtals, unter besonderer Berücksichtigung von Natrix tessellata tessellata (Laurenti, 1768) (Österreich: Steiermark; Squamata: Serpentes: Colubridae). 35-58 ©Österreichische Gesellschaft für Herpetologie e.V., Wien, Austria, download unter www.biologiezentrum.at HERPETOZOA 7 (1/2): 35 - 58 Wien, 30. Juni 1994 Bestandserhebung der Herpetofauna des unteren Murtals, unter besonderer Berücksichtigung von Natrixjessellata tessellata (LAURENTI, 1768) (Österreich: Steiermark; Squamata: Serpentes: Colubridae) Herpetological inventory of the lower Mur river valley, with special regard to Natrix tessellata tessellata (LAURENTI, 1768) (Austria: Styria; Squamata: Serpentes: Colubridae) PETRA ZIMMERMANN & WERNER KAMMEL ABSTRACT In 1992 and 1993 the authors collected data on the distribution of amphibians an reptiles along the lower Mur river (Styria: Austria) and the mouths of its tributaries. Data originated from actual field work as well as from the herpetological data base of the Natural History Museum of Vienna and from recent faunistic liter- ature. The distribution of the species, the herpetozoonoses of natural subunits of the study area, and referring anthropogenic injuries are described. The biotopes of the Dice Snake, Natrix tessellata tessellata (LAURENTI, 1768) are treated in more detail. Out of 15 amphibian and 8 reptile species occurring in the area Bufo viridis and Pelobates fuscus are close to extinction. An old record of Lacerta viridis could not be confirmed. KURZFASSUNG In den Jahren 1992 und 1993 fährten die Autoren eine überwiegend qualitative herpetologische Bestands- erhebung in den flußbegleitenden Aulandschaften der unteren Mur (Steiermark: Österreich) und den Mün- dungsbereichen ihrer Zubringer durch. -
Vogelhegegebietes Mellach": Libellen, Lurche, Kriechtiere Und
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Mitteilungen der Abteilung für Zoologie am Landesmuseum Joanneum Graz Jahr/Year: 1992 Band/Volume: 46_1992 Autor(en)/Author(s): Brunner Helwig, Holzinger Werner E. Artikel/Article: Aus der Fauna des "Vogelhegegebietes Mellach": Libellen, Lurche, Kriechtiere und Vögel (Odonata, Amphibia, Reptilia, Aves) 1-16 ©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Mitt. Abt. Zool. Heft 46 S. 1—16 Graz 1992 Landesmus. Joanneum Aus der Fauna des „Vogelhegegebietes Mellach": Libellen, Lurche, Kriechtiere und Vögel (Odonata, Amphibia, Reptilia, Aves) Von Helwig BRUNNER und Werner E. HOLZINGER Eingelangt am 4. Dezember 1990 Inhalt: Aus der Fauna des „Vogelhegegebietes Mellach" südlich von Graz (Steiermark) werden die Artenspektren von Odonata, Amphibia, Reptilia und Aves in größtmöglicher Voll- ständigkeit dargestellt. Ausgehend von diesen faunistischen Bestandsaufnahmen, werden struktu- relle Eigenschaften der Biozönose quantitativ und qualitativ beschrieben. Angesichts rasch voran- schreitender Sukzessionsvorgänge wird die Notwendigkeit von Biotoppflegemaßnahmen betont. Abstract: The fauna of the bird sanctuary Mellach south of Graz (Styria) is pictured by means of individual studies of Odonata, Amphibia, Reptilia and Aves. Based on these faunistic field results, structural features of the biocoenosis are described both in quality and quantity. In view of rapid succession proceedings