Donau-Poster Handout
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
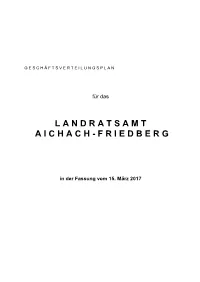
Landratsamtaichach
G E S C H Ä F T S V E R T E I L U N G S P L A N für das L A N D R A T S A M T A I C H A C H - F R I E D B E R G in der Fassung vom 15. März 2017 Allgemeine Bestimmungen Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, werden 1. Aufgaben, die im Verwaltungsgliederungs- und Geschäftsverteilungsplan nicht besonders erwähnt sind, von dem Sachgebiet bearbeitet, dessen Fachbereich mit diesen Aufgaben in engem Zu- sammenhang steht, 2. Angelegenheiten, die Aufgabenbereiche mehrerer Sachgebiete berühren, von dem Sachgebiet federführend bearbeitet, bei dem von der Sache her der Schwerpunkt liegt, 3. alle Nebengesetze, Verordnungen, Durchführungs- und Ausführungsbestimmungen von dem Sachgebiet bearbeitet, das für den Vollzug des maßgebenden Gesetzes zuständig ist, 4. Ordnungswidrigkeiten von dem Sachgebiet verfolgt, in dessen Zuständigkeit die Rechtsvorschrift fällt, gegen die verstoßen wurde, 5. Kosten nach dem Kostengesetz und der Kostensatzung von dem Sachgebiet festgesetzt, das die kostenpflichtige Amtshandlung vorgenommen hat, 6. die Unterschriftsbefugnisse nach der Dienstordnung für das Landratsamt in der jeweils geltenden Fassung geregelt, 7. steuerrechtliche Angelegenheiten (z. B. im Bereich Umsatzsteuer) von dem Sachgebiet bearbeitet, in dessen Zuständigkeit die Aufgabe fällt, die den steuerbaren Tatbestand verursacht. Als An- sprechpartner für grundsätzliche steuerrechtliche Angelegenheiten fungiert dabei ab 01.04.2017 das Sachgebiet 11, 8. die Feststellungs- und Anordnungsbefugnisse für die Bewirtschaftung von Kreis-, Staats- und Bundesmitteln durch besonders erteilte Ermächtigungen geregelt, 9. die Träger öffentlicher Belange in Raumordnungsverfahren der Landesplanung durch das Sach- gebiet 41 beteiligt sowie die Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und sonstigen Verfah- ren durch das Sachgebiet 41 koordiniert. -

A Modern Interpretation of the Account Given in the Flyer
An interpretation of the content of the flyer displayed in ‘Brenpunkt Europas’ ( page 208 - 7.28 Brennpunkt Europas - Bayerische Schlösserverwaltung Zug. – Nr.932) which is also the source of Professor Zenneti’s article in the Dillinger Historical Society year book for 1908 titled Bericht über die Schlacht bei Höchstädt 1704 von einem Mitkämpfer, pages 78-102. A Full and Impartial Relation Of the battle fought on the 13th August 1704 (N.S.) in the plain of Hochstette (Höchstädt), between the villages of Pleintheim (Blindheim), Overklau (Oberglauheim), and Lutzingen. Wherein the army of the High Allies, under the command of his Grace the Duke of Marlborough and Prince Eugene of Savoy, obtained a most complete and most glorious victory over the combined forces of the Elector of Bavaria, and the Marshals of France, Tallard and Marcin. Together with proper references to the plan of the several camps and marches of both armies: exactly drawn by Col. Ivoy, Quartermaster General, under his Grace the Duke of Marlborough, and carefully engraved on two copper plates. The third edition with additions. To give a faithful relation of this battle, which by a particular and visible providence turned to the immortal glory of the Arms of the Queen of Great Britain, and her Allies; it is necessary to speak of the motions we made after the fight near Donawerz (Donauwörth). After that good success , we passed the Danube, and then the Lech without any opposition; and having reduced the town of Rayn (Rain), we were in a manner, masters of all Bavaria, which the Electoe abandoned to us: so that we posted ourselves where we thought fit, particularly at Aycha (Aichach), which is a very fine town, and at Schrobbenhause (Schrobenhausen), where we fettled our magazines. -

Stratigraphy of Late Quaternary Fluvial Terraces at the Confluence of the Lech and Danube Valleys
Quaternary Science Journal GEOZON SCIENCE MEDIA Volume 60 / Number 4 / 2011 / 414–424 / DOI 10.3285/eg.60.4.02 ISSN 0424-7116 E&G www.quaternary-science.net Stratigraphy of Late Quaternary fluvial terraces at the confluence of the Lech and Danube valleys Patrick Schielein, Gerhard Schellmann, Johanna Lomax Abstract: The main purpose oft the study is the Würmian Lateglacial and Holocene valley development at the confluence of the Lech and Danube valleys, located in the Northern Alpine Foreland. The morphological features in the study area were surveyed by field mapping and high resolution Digital Elevation Models. The deposits of both rivers were examined in numerous outcrops and dated using radiocarbon and luminescence measurements. Also archaeological data and historical maps were taken into account. The oldest terrace of the valley floor is a Würmian Lateglacial Niederterrasse, which is only prevalent in the Danube valley slightly downstream of the confluence. Fragmentary terraces of Preboreal/Boreal age have been preserved in both valleys and gravel deposits of this age extensively underlie younger terraces. The Atlantic period is not represented by river channel deposits in the study area. In contrast, Subboreal and Subalantic gravel deposits morphologically dominate the lower Lech valley and the Danube valley downstream of the confluence. Up to six Subatlantic terraces accompany the recent courses of Lech and Danube. The distribution and morphological appearance of the Late Subatlantic terraces at the Danube upstream of the confluence refer to a meandering river, whereas the morphology of the youngest Lech terraces predominantly relates to an anabranching river. Downstream of the Lech – Danube confluence the Subatlantic terrace morphology is a transitional one between a meandering and an anabranching depositional setting. -

Bürgerbroschüre Der Stadt Aichach
Bürgerbroschüre Leben, Wohnen und Arbeiten in Aichach www.aichach.de 1 Grußwort des Bürgermeisters Aichach ist wunderschön, liebenswert und lebenswert. Wer möchte dies bestreiten. Eine STADT, die aus ihrer ganz besonderen Geschichte als „Wiege und Namensgeber der WITTELSBACHER“ auch ihre Dynamik für Gegen- wart und Zukunft begründet. Nicht zuletzt der historische Burgplatz in Ober- wittelsbach und das idyllische Sisi-Schloss in Unterwittelsbach legen Zeugnis ab von dieser Foto: Stadt Aichach ganz Bayern prägenden Epoche. Schulangebot und über zahllose attraktive Aber Aichach bietet nicht nur Geschichte: Kinderbetreuungseinrichtungen. Und über ein Wollte man all die sportlichen, kulturellen und topmodernes Kreiskrankenhaus sowie über- auch gesellschaftlichen Angebote nutzen, die durchschnittlich viele Fachärzte, die Versorgung es hier gibt, man wäre chancenlos! Nicht zuletzt auch im Krankheitsfall gewährleisten. die unzähligen Vereine und Organisationen sor- gen dafür, dass es praktisch nie langweilig wird. Kurz: AICHACH ist eine echte PERLE im WITTELSBACHER LAND, ist einfach „gut bei- Oder sorgen beispielsweise bei den freiwilligen nander“, mit seiner Kernstadt und seinen nicht Feuerwehren oder auch beim BRK dafür, dass weniger als 16 Ortsteilen, alle attraktiv, mit alle hier in Sicherheit leben können. eigener Identität. Aber all das muss natürlich „transparent“ gemacht werden. Denn „Informa- Und Aichach verfügt über eine hohe Wohn-, Ein- tion ist nun mal der Kitt unserer Gesellschaft ...“. kaufs- und Aufenthaltsqualität, mit zahlreichen Und Information ist Grundvoraussetzung für ein attraktiven Einzelhandelsgeschäften innerhalb erfolgreiches, weil lebendiges Stadtleben. unserer preisgekrönten Altstadt, zwischen den beiden Stadttoren, in den beiden Vorstädten Die Ihnen vorliegende Broschüre gibt Ihnen und im daran angebundenen Einkaufszentrum kompakt und übersichtlich einen Überblick. Milchwerk. Gemütliche Cafés und Gastronomie- Sie sollten sie deshalb auch immer griffbereit betriebe laden zum Schlemmen und Verweilen haben. -

Bischöfliches Seelsorgeamt Außenstelle Schrobenhausen Miteinander 2
Bischöfliches Seelsorgeamt Außenstelle Schrobenhausen Miteinander 2. Halbjahr 2017 Zusammen für Menschen in vielen Lebenswelten 1 Unser Team Außenstelle Schrobenhausen Liebe Leserinnen und Leser, „Glaube & Kultur“ – unter diesem Motto steht der Dekanats- kirchentag, der mit einem reichhaltigen Programm vom 20.-22. Oktober 2017 in Neuburg/Do. stattfindet - diesmal vor dem Hin- Franziska Wenger Nicole Binknus Dr. Thomas Wienhardt Gudrun & Bernhard Fendt tergrund des Reformationsgedenkens. Im Neuburger Renais- Büroleiterin Verw.-Angestellte Pastoralreferent Pastoral- & Gemeindereferent(in) sanceschloss, einem Zentrum der Reformation unter Pfalzgraf Außenstelle Schrobenhausen Außenstelle Schrobenhausen Referat Gemeindeentwicklung Referat Ehe und Familie Ottheinrich, findet daher von Juli bis November unter dem Titel „FürstenMacht & wahrer Glaube“ auch eine Ausstellung statt, in deren Zentrum u.a. die Neuburger Schlosskapelle sowie als ganz besonderes Machtsymbol der Reichsapfel von Friedrich V. steht. Nach Art eines Kaleidoskops lässt sich unser christlicher Glaube in unzähligen Farben und Facetten betrachten. Doch die wichtigste scheint mir, ebenfalls in einer Kurzformel ausgedrückt, „Glaube = Leben“! Als Christen tragen wir den Namen dessen, der unsere Hoffnung ist: Jesus Christus, Pfr. Dominik Zitzler Bettina Harvolk Maria Hanisch in dem Gott Mensch wurde, um uns nahe zu sein. Nichts Menschliches ist ihm fremd und jede Jugendseelsorger, BDKJ Präses Jugendreferentin Verw.-Angestellte Dunkelheit hat er selbst durchlitten. So dürfen wir getrost -

Wittelsbacher Land & Augsburger Land
RegioMagazin 2020 AUGSBURG Wittelsbacher Land & Augsburger Land NEU! Titelfoto: Wolfgang B. Kleiner www.fuggerstrasse.eu UNESCO-WELTERBE! DIE BAYERISCHE DAS AUGSBURGER DIE „STAUDEN“: AUGSBURGS WASSER LANDESAUSSTELLUNG RENAISSANCERATHAUS HÜGEL UND WÄLDER Denkmäler und Megathema: In Aichach und Friedberg: 400 Jahre – das Jubiläum: Die Landschaft im Westen Martin Kluger, context verlag Augsburg | Nürnberg – www.context-mv.de Kanäle und Wassertürme, zwei Wittelsbacherstädte der Monumentalbau von von Augsburg hat sich ihren Kraftwerke und Brunnen und ein Königsmord Stadtwerkmeister Elias Holl urigen Charme bewahrt Titelfoto: INHALT 10 24 26 38 56 68 DIE BAYERISCHE LANDESAUSSTELLUNG 2020 38 Zu den Städten der Wittelsbacher 2020 erlesen nach Friedberg und Aichach Die Doppelausstellung „Stadt befreit. Wittelsbacher WOHER DER REICHTUM DER FUGGER KAM Gründerstädte“ – Wege zu Mauern, Morden und Macht 8 Auf der „Europäischen Fuggerstraße“ Die Ausstellung „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründer- zu den Spuren des Montankonzerns städte“ in Friedberg und Aichach erklärt die Gründung Seit 2019 führt eine Kulturreiseroute nach Österreich, altbayerischer Städte bis in das Spätmittelalter. Sehens- Italien, in die Slowakei, ins Allgäu – und nach Augsburg würdigkeiten der Wittelsbacher findet man im „Wittels- Mit Erz aus ihren Bergwerken in den Alpen und in den bacher Land“ – und in Augsburg sowie an der Donau. Karpaten wurden die Augsburger Fugger legendär reich. Die neue „Europäische Fuggerstraße“ führt jetzt in die Bergstädte und Bergdörfer, in Bergwerke -

Informationsbroschüre Nis Das Einkaufserleb Für Die Ganze Familie
FRIEDBERG INFORMATIONSBROSCHÜRE NIS DAS EINKAUFSERLEB FÜR DIE GANZE FAMILIE. TOPAKTUELLE INSPIRATIVE RIESIGE AUSWAHL AN ÜBER 30 TRENDS WOHNDESIGNS MÖBELN UND KÜCHEN FACHABTEILUNGEN ERLEBNISEINKAUF ZUVERLÄSSIGE EXZELLENTE QUALITÄT AUS MEISTER- AUF 4 ETAGEN LIEFERUNG FACHBERATUNG HAND SEIT 1925 SENSATIONELLE MARKEN-AUSWAHL 86316 Friedberg Öffnungszeiten Segmüller Einrichtungshaus der Hans Segmüller Augsburger Str. 11-15 Mo bis Fr: 10:00 bis 20:00 Uhr Polstermöbelfabrik GmbH & Co. KG Tel.: 0821/6006-0 Samstag: 09:30 bis 20:00 Uhr Münchner Straße 35 | 86316 Friedberg | 201623 Vorwort FGU'TUVGP$ØTIGTOGKUVGTU4QNCPF'KEJOCPP Herzlich Willkommen in Friedberg, unserer Herzogstadt an der Romantischen Straße. Die vorliegende Informationsbroschüre will Ihnen bei den Angelegenheiten des alltäg- NKEJGP.GDGPUDGJKNƃKEJUGKP&CHØTDKNFGPYKTOÒINKEJUVWOHCUUGPFFKG$GTGKEJG-WNVWT Soziales, Gesellschaft und Politik ab. Weiterführende Infos zu unserem umfassenden Dienstleistungsangebot erhalten Sie zu FGP$GUWEJU\GKVGPCPFGT+PHQVJGMKOJKUVQTKUEJGP4CVJCWU&KGUGJCVOQPVCIUFKGPU- VCIUWPFFQPPGTUVCIUXQPDKU7JTIGÒHHPGVUQYKGOKVVYQEJUWPFHTGKVCIU XQPDKU7JT&QTVƂPFGP)ÀUVG$GUWEJGTWPF6QWTKUVGPCWUHØJTNKEJG+PHQT- mationen über Friedberg, das Wittelsbacher Land und die Region. Sprechen Sie uns an – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Sie gerne individuell, denn Friedberg DKGVGVUQXKGNOGJTCNUUKEJKPGKPGT$TQUEJØTGCDDKNFGPNÀUUV In Friedberg erwartet Sie ein breit gefächertes Veranstaltungsangebot für alle Alters- ITWRRGP'TNGDGP5KGFCUCNNGFTGK,CJTGUVCVVƂPFGPFGJKUVQTKUEJG#NVUVCFVHGUVd(TKGFDGTIGT -

Romantic Road®
PLANNING GUIDE Romantic Road ® from the River Main to the Alps Sightseeing Itinerary Insider tips 2 PLANNING GUIDE LONG DISTANCE HIKING TRAIL CONTENTS Hiking in the countryside along the Romantic Road ..................... 2 460 km of unadulterated romanticism .............................. 3 Tips for explorers, connoisseurs and aficionados .......................... 3 Würzburg ............................... 4/5 Wertheim ............................... 6/7 Tauberbischofsheim ................ 8/9 Lauda-Königshofen .............. 10/11 Bad Mergentheim .................12/13 Weikersheim ........................14/15 Röttingen ................................16 Creglingen ...............................17 Rothenburg ob der Tauber ......18/19 Hiking in the Countryside along the Romantic Road Schillingsfürst ..........................20 Almost everyone has heard of it: the Romantic Road, where you will immediately see why it is called “above Romantic journey through time ...21 the unbroken series of romantic towns and landscapes the Tauber”. Beforehand, you will have passed through Feuchtwangen .....................22/23 between Würzburg and Füssen, between the valley of Lauda-Königshofen, Bad Mergentheim, Weikersheim, Dinkelsbühl .........................24/25 the River Main and the foothills of the Alps. The Roman- Röttingen and Creglingen with its famous Church of Wallerstein...............................26 tic Road Long Distance Cycle Path has been in existence our Lord. The Franconian Heights are more severe since 1988; in 2006 a route -

DER ALTBAIERISCHE OXENWEG Langenmosen Haidforst Linden Bayernnetz Für Radler
W ANDERN UND R ADFAHREN N E R L A N D im Schrob RO B EN H AU S E S C H im Touren durch das Schrobenhausener Land Ein kostenloses E-Book beschreibt Touren für Wanderer und Altbaierischer Oxenweg Niederarnbach Radfahrer rund um den Altbaierischen Oxenweg. Es bietet *ausgeschildert* Berg im Gau Dettenhofen interessante Informationen über alle Sehenswürdigkeiten und enwart - h Ih Ho r detaillierte Streckenbeschreibungen mit topo grafischen Karten. S Hohenried t a Oberarnbach n Download: www.schrobenhausen.de/wandern-radfahren. d o Brunnen r t t B I I Das E-Book informiert auch über An- Altbaierischer Oxenweg I IC ID bindungen an die Paartalbahn sowie das DER ALTBAIERISCHE OXENWEG Langenmosen Haidforst Linden Bayernnetz für Radler. Vier Jahrhunderte lang - zwischen 1350 und 1750 - wurden Edelshausen Gröbern Ingolstadt Hohenwart jährlich bis zu 200.000 Grauochsen aus der ungarischen Hohenwart Winkelhausen Wangen 5 km 7 km Tief ebene in den Westen getrieben, vor allem um die großen Hinterkaifeck Paar Waidhofen 5 km Städte mit Fleisch zu versorgen. Sandizell IA Schrobenhausen 8 km 300 Altbaierischer Oxenweg Hörzhausen Eines der Ziele war Augsburg, damals eine der bedeutendsten Paar I Waidhofen Radersdorf 9 km Handelsstädte Europas. Einer der Triebwege verlief durch das Hagenauer BRB Mit dem Rad Schrobenhausener Land. Gefördert von der EU rufen Gemein- Forst Schrobenhausen Rundtouren BRB den aus dem Schrobenhausener Land diesen alten Triebweg Diepoltshofen 11 km Aichach Hörzhausen I BRB - Bahnhöfe wieder ins Gedächtnis. Ausgeschildert wurde eine Wander- drei Hauptrouten Weilach *nicht ausgeschildert* Schrobenhausen III Dasing Radersdorf und Radstrecke von Hohenwart über Schrobenhausen bis ins Halsbach 4 km II vier Nebenrouten 13 km Aichach Wittelsbacher Land und nach Augsburg. -

Betreuungsangebote Für Kinder Im Landkreis Aichach-Friedberg
Betreuungsangebote für Kinder im Landkreis Aichach-Friedberg Einrichtung Straße PLZ Ort Ortsteil Telefon E-Mail / Fax Träger Straße Ort Gemeinde Adelzhausen Kindertagesstätte "Haus Gemeinde Adelzhausen Aichacher Straße 86559 Schulstraße 11 86559 Adelzhausen 08258/10 35 [email protected] für Kinder" Adelzhausen über VG Dasing 12 Adelzhausen Gemarkung Naturkindergarten Gemeinde Adelzhausen Aichacher Straße 86559 Eurasburger Forst 86559 Adelzhausen 08205/9605-15 [email protected] Waldkönig über VG Dasing 12 Adelzhausen Flur Nr. 1 Gemeinde Affing Kindertagesstätte Zeller Str. 9 86444 Affing Haunswies 08207/96 29 07-0 [email protected] Gemeinde Affing Mühlweg 2 86444 Affing "Krambambuli" Kindergarten Bergen Gloggerberg 1 86444 Affing Bergen 08207/958667 [email protected] Gemeinde Affing Mühlweg 2 86444 Affing 08207/9636409 Kinderhaus "mittendrin" 86444 Affing [email protected] Gemeinde Affing Mühlweg 2 86444 Affing Affing Stadt Aichach kindergarten.schulstrasse@aich 86551 Kindergarten Kunterbunt Schulstr. 2 a 86551 Aichach 08251/82 74 73 Stadt Aichach Stadtplatz 48 ach.de Aichach kindergarten.holzgartenstrasse 86551 Kindergarten Holzgarten Holzgartenstr. 3 86551 Aichach 08251/82 74 78 Stadt Aichach Stadtplatz 48 @aichach.de Aichach Kindergarten Unter- kindergarten.unterschneitbach@ 86551 Unterschneitbacher Hüttenstr. 9 86551 Aichach 08251/82 74 77 Stadt Aichach Stadtplatz 48 schneitbach aichach.de Aichach Landzwerge 1 Stand 25.02.2021 Betreuungsangebote für Kinder im Landkreis Aichach-Friedberg Einrichtung Straße PLZ Ort Ortsteil Telefon E-Mail / Fax Träger Straße Ort Kindergarten Zeller Griesbecker- kindergarten.griesbeckerzell 86551 Lorenzstr. 26 86551 Aichach 08251/24 64 Stadt Aichach Stadtplatz 48 Rasselbande zell @aichach.de Aichach Kindergarten Oskar-von-Miller-Str. kindergarten.oskar-von-miller- 86551 86551 Aichach 08251/82 74 79 Stadt Aichach Stadtplatz 48 Abenteuerland 41 a [email protected] Aichach Kath. -

Wandern Und Radfahren Im Schrobenhausener Land Altbaierischer Oxenweg Niederarnbach *Ausgeschildert* Berg Im Gau Dettenhofen
Rund um den altbaierischen Oxenweg Wandern und Radfahren im Schrobenhausener Land Altbaierischer Oxenweg Niederarnbach *ausgeschildert* Berg im Gau Dettenhofen Oberarnbach Hohenried Brunnen I IB IC ID Langenmosen Haidforst Touren im Linden I Edelshausen Gröbern Überblick Wangen Winkelhausen Hinterkaifeck Paar Sandizell A I Hohenwart 300 I Paar Hagenauer Waidhofen Forst Diepoltshofen Schrobenhausen Rundtouren mit dem Rad Hörzhausen Weilach Tour I - SCHLÖSSERTOUR Halsbach III SchrobenhausenSandizellLangen- mosenBerg im GauOberarnbach Oberlauterbach Paar I BrunnenNiederarnbachHohenried Unterbern- HohenwartSchrobenhausen bach Habertshausen Tour II - KIRCHENTOUR 1 (Süd-West) Peutenhausen SchrobenhausenRettenbachMaria Rettenbach II Beinberg Gachenbach Kühbach Raders- Aresing RadersdorfHörzhausenSchrobenhausen dorf III Tour III - KIRCHENTOUR 2 (Süd-Ost) Westerham SchrobenhausenRettenbachMaria BeinbergGachenbachWeilachAresing Haslangkreit Autenzell III OberlauterbachDiepoltshofen WaidhofenSchrobenhausen Maria Spitalmühle Paar Beinberg Rundtouren *nicht ausgeschildert* Kühbach Hauptroute 300 Gachenbach Weilach Nebenroute II 3 • INHALT 4 Vorwort 43 Kirchentour Süd-West Streckenbeschreibung Sehenswürdigkeiten 5 Schrobenhausener Land – Ein Naturerlebnis Schrobenhausen – Maria Beinberg – Gachenbach Kühbach – Hörzhausen – Schrobenhausen 8 Anbindungen – Tourenplanung – Adressen 51 Kirchentour Süd-Ost Streckenbeschreibung Sehenswürdigkeiten 9 Touren im Überblick Schrobenhausen – Maria Beinberg – Aresing Oberlauterbach – Waidhofen – Schrobenhausen -

Land Enclosure and Bavarian State Centralization (1779-1835)
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 7-1-2020 Reshaping an Earthly Paradise: Land Enclosure and Bavarian State Centralization (1779-1835) Gregory DeVoe Tomlinson Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the European History Commons, and the Social History Commons Recommended Citation Tomlinson, Gregory DeVoe, "Reshaping an Earthly Paradise: Land Enclosure and Bavarian State Centralization (1779-1835)" (2020). LSU Doctoral Dissertations. 5308. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/5308 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. RESHAPING AN EARTHLY PARADISE: LAND ENCLOSURE AND BAVARIAN STATE CENTRALIZATION (1779-1835) A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of History by Gregory DeVoe Tomlinson B.A., San José State University, 2009 M.A., San José State University, 2012 August 2020 Acknowledgments The Central European History Society (CEHS) funded a visit to the Bayerisches Haupstaatsarchiv and Staatsarchiv München in the summer of 2016. Further support came from the LSU history department and the generous contributions of members of the LSU Osher Lifelong Learning Institute (OLLI) for a subsequent visit in the summer of 2018. The staffs of the Bayerisches Haupstaatsarchiv and Staatsarchiv München are extremely dedicated, professional, and were more than helpful with their assistance.