Abschlussbericht
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
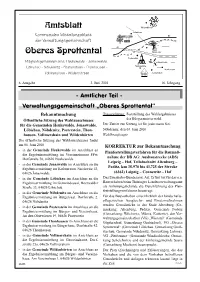
AB 2010 06.Pdf
��������� ��������������������������� ��������������������������� ������������������ ����Mitgliedsgemeinden ���� ���������� �� sind: ����������� Heukewalde �� ����������� - Jonaswalde � - �������������������������������������������������Löbichau - Nöbdenitz - Posterstein - Thonhausen - ���������������������������Vollmershain - Wildenbörten 6. Ausgabe 3. Juni 2010 16. Jahrgang - Amtlicher Teil - Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“ Bekanntmachung Tagesordnung: Feststellung des Wahlergebnisses Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses der Bürgermeisterwahl. für die Gemeinden Heukewalde, Jonaswalde, Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei. Löbichau, Nöbdenitz, Posterstein, Thon- Nöbdenitz, den 03. Juni 2010 hausen, Vollmershain und Wildenbörten Wahlbeauftragte Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet am 06. Juni 2010 KORREKTUR zur Bekanntmachung - in der Gemeinde Heukewalde im Anschluss an Planfeststellungsverfahren für die Baumaß- die Ergebnisermittlung im Vereinszimmer FFw, Dorfstraße 30, 04626 Heukewalde nahme der DB AG: Ausbaustrecke (ABS) Leipzig – Hof, Teilabschnitt Altenburg – - in der Gemeinde Jonaswalde im Anschluss an die Paditz, km 38,970 bis 43,725 der Strecke Ergebnisermittlung im Kulturraum Nischwitz 43, 04626 Jonaswalde (6362) Leipzig – Connewitz – Hof - in der Gemeinde Löbichau im Anschluss an die Das Eisenbahn-Bundesamt, Ast. Erfurt hat für das o.a. Ergebnisermittlung im Gemeindesaal, Beerwalder Bauvorhaben beim Thüringer Landesverwaltungsamt Straße 33, 04626 Löbichau als Anhörungsbehörde die Durchführung -

Richtlinie Sonderprogramm Klimaschutz
Richtlinie des Freistaates Thüringen für die Zuweisungen an Gemeinden und Landkreise für Klimaschutz 1. Zuweisungszweck, Rechtsgrundlage 1.1 Der Freistaat Thüringen, vertreten durch die Ministerin für Umwelt, Energie und Naturschutz, gewährt Zuweisungen nach Maßgabe dieser Richtlinie auf der Grundlage des Thüringer Corona-Pandemie-Hilfefondsgesetzes und des Thüringer Klimagesetzes sowie des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes unter Anwendung der §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) sowie der hierzu erlassenen Verwaltungsvorschriften in den jeweils geltenden Fassungen. 1.2 Zweck der Zuweisung ist es, Investitionen von Gemeinden und Landkreisen für Klimaschutz nach § 7 Absätze 1 und 4 ThürKlimaG zu ermöglichen und damit gleichzeitig Hilfen für die Stabilisierung der kommunalen Haushalte und zum Erhalt der Leistungsfähigkeit nach § 2 Abs. 2 Punkt 8 Thüringer Corona-Pandemie- Hilfefondsgesetz im Bereich Klimaschutz zu leisten. Ziel der Investitionen sind kommunale Beiträge zur Klimaneutralität. 1.3 Ein Rechtsanspruch auf die Zuweisung besteht nicht. 2. Gegenstand der Zuweisung Gegenstand der Zuweisung sind Finanzhilfen für Investitionen im kommunalen Klimaschutz. 3. Zuweisungsempfänger Zuweisungsempfänger nach dieser Richtlinie sind die Thüringer Gemeinden und Landkreise. 4. Art und Umfang, Höhe der Zuweisung 4.1 Art und Form der Zuweisung, Finanzierungsart Die Zuweisung wird als nicht rückzahlbarer Zuschuss in Form einer Projektförderung als Festbetragsfinanzierung gewährt. 4.2 Verwendung Die Zuweisung kann für sämtliche Projektausgaben für Investitionen und die Vorbereitung solcher im kommunalen Klimaschutz im Sinne von §§ 4, 5, 7, 8 und 9 ThürKlimaG verwendet werden. Eine nicht abschließende Positivliste von möglichen Maßnahmen findet sich in Anlage 1 der Richtlinie. 4.3 Höhe der Zuweisung Die Höhe der Zuweisung bemisst sich für Gemeinden, Landkreise und kreisfreie Städte nach den Anlagen 2a, 2b und 2c dieser Richtlinie, soweit nicht nach Nr. -

Amtsblatt Oberes Sprottental
Amtsblatt Kommunales Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Oberes Sprottental Mitgliedsgemeinden sind: Heukewalde - Jonaswalde - Löbichau - Nöbdenitz - Posterstein - Thonhausen - Vollmershain - Wildenbörten 12. Ausgabe 1. Dezember 2016 22. Jahrgang Für ausschließlich amtliche Bekanntmachungen erscheint ein zusätzliches Amtsblatt im Dezember. Das nächste reguläre Amtsblatt erscheint am 05.01.2017. Redaktionsschluss ist am 19.12.2016. VG „Oberes Sprottental“ | 01.12.2016 | Seite 2 Informationen Amtlicher Teil VG „Oberes Sprottental“ Hinweis: Die Veröffentlichung des Amtsblattes erfolgt auf Nöbdenitz, Am Gemeindeamt 4 www.vg-sprottental.de unter Verwaltung/Amtsblätter. Rufnummern Damit sind öffentliche Bekanntmachungen auch im Inter- Zentrale/Auskunft 034496 230 - 00 net zugänglich. Vorsitzende 230 - 26 Hauptamt (Personal/Soziales) 230 - 12 VG „Oberes Sprottental“ Hauptamt (Beitragswesen/Allgem.) 230 - 27 Liegenschaften 230 - 28 Bekanntmachung Bauamtsverwaltung 230 - 24 In der Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der Ver- Kämmerei 230 - 17 waltungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“ vom 11. Au- Steuern/Mieten/Pachten 230 - 16 Kasse 230 - 15 gust 2016 wurde folgender Beschluss gefasst: Einwohnermeldeamt 230 - 14 Beschluss Nr. 14/III/2016: Die Niederschrift der Sitzung Ordnungsamt 230 - 13 vom 19. Mai 2016 wird hiermit bestätigt. KOBB 230 - 21 Fax 034496 23023 Bekämpfung der Geflügelpest Öffnungszeiten VG „Oberes Sprottental“ Anordnung von Maßnahmen nach §§ 13, 65 Geflügel- Montag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr pest-Verordnung in Verbindung mit § 38 Abs. 11 und § 6 Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr Abs. 1 Nr. 11 a Tiergesundheitsgesetz Mittwoch geschlossen Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr Nach Prüfung erlässt das Landratsamt Altenburger Land Freitag geschlossen folgende Öffnungszeiten Einwohnermeldeamt Allgemeinverfügung Montag 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr 1. -

Bundestagswahl Am 26. September 2021 in Thüringen - Einteilung Der Wahlkreise
Bundestagswahl am 26. September 2021 in Thüringen - Einteilung der Wahlkreise Stand: 1.1.2021 WK- Wahlkreisname Gebiet des Wahlkreises Nr. 189 Eichsfeld – Nordhausen – der Landkreis Eichsfeld mit den Gemeinden: Kyffhäuserkreis Am Ohmberg, Arenshausen, Asbach-Sickenberg, Berlingerode, Birkenfelde, Bodenrode-Westhausen, Bornhagen, Brehme, Breitenworbis, Buhla, Burgwalde, Büttstedt, Dieterode, Dietzenrode/Vatterode, Dingelstädt, Ecklingerode, Effelder, Eichstruth, Ferna, Freienhagen, Fretterode, Geisleden, Geismar, Gerbershausen, Gernrode, Glasehausen, Großbartloff, Haynrode, Heilbad Heiligenstadt, Heuthen, Hohengandern, Hohes Kreuz, Kella, Kirchgandern, Kirchworbis, Krombach, Küllstedt, Leinefelde-Worbis, Lenterode, Lindewerra, Lutter, Mackenrode, Marth, Niederorschel, Pfaffschwende, Reinholterode, Rohrberg, Röhrig, Rustenfelde, Schachtebich, Schimberg, Schönhagen, Schwobfeld, Sickerode, Sonnenstein, Steinbach, Steinheuterode, Tastungen, Teistungen, Thalwenden, Uder, Volkerode, Wachstedt, Wahlhausen, Wehnde, Wiesenfeld, Wingerode, Wüstheuterode der Landkreis Nordhausen mit den Gemeinden: Bleicherode, Ellrich, Görsbach, Großlohra, Harztor, Heringen/Helme, Hohenstein, Kehmstedt, Kleinfurra, Lipprechterode, Niedergebra, Nordhausen, Sollstedt, Urbach, Werther der Landkreis Kyffhäuserkreis mit den Gemeinden: Abtsbessingen, An der Schmücke, Artern, Bad Frankenhausen/ Kyffhäuser, Bellstedt, Borxleben, Clingen, Ebeleben, Etzleben, Freienbessingen, Gehofen, Greußen, Helbedündorf, Holzsußra, Kalbsrieth, Kyffhäuserland, Mönchpfiffel-Nikolausrieth, -

Amtsblatt Nr. 5 / 2015
Amtsblatt Kommunales Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Oberes Sprottental Mitgliedsgemeinden sind: Heukewalde - Jonaswalde - Löbichau - Nöbdenitz - Posterstein - Thonhausen - Vollmershain - Wildenbörten 06. Ausgabe 7. Mai 2015 21. Jahrgang Das nächste Amtsblatt erscheint am 04.06.2015. Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 25.05.2015. VG „Oberes Sprottental“ | 07.05.2015 | Seite 2 Informationen Amtlicher Teil VG „Oberes Sprottental“ Hinweis: Die Veröffentlichung des Amtsblattes erfolgt auf Nöbdenitz, Am Gemeindeamt 4 www.vg-sprottental.de unter Verwaltung/Amtsblätter. Rufnummern Damit sind öffentliche Bekanntmachungen auch im Inter- Zentrale/Auskunft 034496 230 - 00 net zugänglich. Vorsitzende 230 - 26 Hauptamt (Personal/Soziales) 230 - 12 VG „Oberes Sprottental“ Hauptamt (Beitragswesen/Allgem.) 230 - 27 Liegenschaften 230 - 28 Bauamtsverwaltung 230 - 24 Veröffentlichung der Bodenrichtwerte Kämmerei 230 - 17 Bekanntmachung vom 20. April 2015 Steuern/Mieten/Pachten 230 - 16 Die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte des Kasse 230 - 15 Freistaates Thüringen haben zum Stichtag 31. Dezember Einwohnermeldeamt 230 - 14 Ordnungsamt 230 - 13 2014 auf Grund der Kaufpreissammlung flächendeckend KOBB 230 - 21 Bodenrichtwerte ermittelt und veröffentlicht. Fax 034496 23023 Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken inner- Öffnungszeiten VG „Oberes Sprottental“ Montag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr halb eines abgegrenzten Gebietes (Bodenrichtwertzone), Dienstag -

Die Einwohnerzählung Im Amt Altenburg Im Jahre 1580
SCHRIFTENREIHE DER STIFTUNG STOYE Band 43 Alfred Maschke Die Einwohnerzählung im Amt Altenburg im Jahre 1580 bearbeitet von Karlheinz Weidenbruch 2007 MARBURG AN DER LAHN Ephorie Altenburg im Jahre 1580 Gliederung: Diözese Altenburg – Stadt Diözese Altenburg – Land Untergliederung: 4 Lokaladjunkturen Schmölln, Monstab, Lucka, Gößnitz Abb. 1: Amt Altenburg 1580 Schriftleitung: Dr. Jochen Steinecke Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme Alfred Maschke: Die Einwohnerzählung im Amt Altenburg im Jahre 1580 bearbeitet von Karlheinz Weidenbruch. – Marburg / Lahn: Stiftung Stoye 2006 (Schriftenreihe der Stiftung Stoye; Bd. 43) ISBN 978-3-937230-07-8 © 2007 Stiftung Stoye, Marburg / Lahn Layout: Satzstudio Mocker, Eichenau Druck: MVR Druck GmbH, Brühl ISBN 978-3-937230-07-8 Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort . 7 Mitarbeiterverzeichnis . 8 I. Einleitung .......................................................... .9 II. Die Superintendentur Altenburg 1580 ................................... .10 II.1 Die Diözese Altenburg-Stadt . 10 II.2 Die Diözese Altenburg-Land . 11 II.3 Die Einwohnerzählung 1580 . 16 III. Die Einwohner der Ephorie Altenburg .................................. .20 III.1 Die Einwohner der Diözese Altenburg-Stadt . 20 III.2 Die Einwohner der Diözese Altenburg-Land . 44 IV. Quellen- und Literaturverzeichnis ....................................... 236 IV.1 Glossar und Abkürzungsverzeichnis . 236 IV.2 Quellenverzeichnis . 238 IV.3 Literaturverzeichnis . 238 IV.4 Bildnachweis . 240 V. Register ............................................................. 241 V.1 Ortsregister . 241 V.1.1 Ortsregister, alphabetisch geordnet . 242 V.1.2 Ortsregister, nummerisch geordnet . 246 V.1.3 Ortsergänzungen . 249 V.1.3.1 Namen, Zuordnungen, Kirchenbücher . 249 V.1.3.2 Anzahl der Einwohner pro Ort . 256 V.2 Personenregister . 263 V.2.1 A . 264 V.2.2 B . 264 V.2.3 C . 267 V.2.4 D . 268 V.2.5 E . -

(Sonderausgabe) Öffnen
Nr. 09/S | Samstag, 29. September 2018 Jahrgang 22 - Amtlicher Teil - Landratsamt Altenburger Land | Fachdienst Kommunalaufsicht Altenburg, 14. September 2018 Bekanntmachung des Landratsamtes Altenburger Land als untere Rechtsaufsichtsbehörde zum Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur freiwilligen Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2019 (ThürGNGG 2019) (DS 6/6060) sowie Änderungsantrag der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 30. August 2018 (Vorlage 6/4530) Anhörung der Einwohner der Gemeinden Altkirchen, Dobitschen, Drogen, Göhren, Göllnitz, Lumpzig, Mehna, Starkenberg, Kriebitzsch, Lödla, Monstab, Rositz, Heukewalde, Jonaswalde, Löbichau, Nöbde- nitz, Posterstein, Thonhausen, Vollmershain und Wildenbörten sowie der Stadt Schmölln In diesem zur Anhörung vorgelegten Gesetzentwurf - Die Stadt Schmölln nimmt als erfüllende Gemeinde der Landesregierung und dem o. g. Änderungsantrag für die Gemeinden Dobitschen, Göllnitz, Mehna, werden für den Landkreis Altenburger Land folgende Heukewalde, Jonaswalde, Löbichau, Posterstein, Strukturänderungen vorgeschlagen: Thonhausen und Vollmershain die Aufgaben einer § 1 Verwaltungsgemeinschaft nach § 51 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) wahr. - Die Verwaltungsgemeinschaft „Altenburger Land“ wird aufgelöst. - Die Verwaltungsgemeinschaft „Rositz“ wird um die Gemeinden Göhren und Starkenberg erweitert. - Die Gemeinden Altkirchen, Drogen und Lumpzig werden aufgelöst. Die Gebiete der aufgelösten Ge- Als alternative Zuordnungsoption kommt für die Ge- meinden werden in das -

Gemeindeverwaltungen Im Altenburger Land
Gemeindeverwaltungen im Altenburger Land Name Anschrift Telefon/Fax Mail Homepage Markt 1 Tel: 03447 594-0 Stadtverwaltung Altenburg [email protected] http://www.altenburg.eu 04600 Altenburg Fax: 03447 594-139 Markt 1 Tel: 034491 76-0 Stadtverwaltung Schmölln stadtverwaltung(at)schmoelln.de http://www.schmoelln.de 04626 Schmölln Fax: 034491 76-110 Freiheitsplatz 1 Tel: 034493 / 700 Stadtverwaltung Gößnitz [email protected] http://www.goessnitz.de 04639 Gößnitz Fax: 034493 / 21473 Rathausstraße 1 Tel: 03448 443-0 Stadtverwaltung Meuselwitz [email protected] http://www.meuselwitz.de/ 04610 Meuselwitz Fax: 03448 3498 Pegauer Straße 17 Tel: 034492 31-0 Stadtverwaltung Lucka [email protected] http://www.lucka.de/ 04613 Lucka Fax: 034492 31-199 Verwaltungsgemeinschaft Altenburger Dorfstraße 32 Tel: 034495 730-0 [email protected] www.altenburgerland.de Land 04626 Mehna Fax: 034495 730-10 Schmöllner Straße 13 Tel: 034491 22233 Gemeinde Altkirchen [email protected] www.altenburgerland.de 04626 Altkirchen Fax: 034495 79609 Straße der Einheit 8 b Tel: 034495 79320 Gemeinde Dobitschen [email protected] http://www.dobitschen.de 04626 Dobitschen Fax: 034495 73010 Hauptstraße 2 Tel: 034491 22212 Gemeinde Drogen [email protected] www.altenburgerland.de 04626 Drogen Fax: 034495 79609 Eisenberger Straße 7 Tel: 03447 311441 Gemeinde Göhren [email protected] http://www.goehren-thueringen.de 04603 Göhren Fax: 034495 73010 Hauptstraße 3 Tel: 034495 79475 Gemeinde Göllnitz [email protected] www.altenburgerland.de -

Gültig Ab 15.12.2019 Thonhausen % 355 Drosen Untschen - Schmölln
Thonhausen % 355 Schmölln - Untschen Drosen Betriebstagsgruppe Montag-Freitag (außer Feiertag) Fahrtnummer 004 018 018 012 016 028 020 024 036 032 040 040 043 044 056 052 060 059 069 Verkehrsbeschränkung - . - - . - - Tx ` TS4 TF4 - . - - TS5 C Zone Haltestellen đ đ đ đ đ 572|324 Schmölln, Bahnhof................................ 2 ab 04:42 06:39 06:39 06:46 06:58 07:06 ... ... 08:24 08:24 11:39 11:39 12:20 12:28 ... ... 14:30 14:30 16:36 572|324 Schmölln, Gymnasium ............................ 1 | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... 14:35 14:35 | 572|324 Schmölln, Crimmitschauer Str................. 04:44 06:41 06:41 06:48 | | ... ... 08:26 | | | | | ... ... | | | 572|324 Schmölln, Förderzentrum........................ | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... | 14:39 | 572|324 Schmölln, T-Müntzer-Siedlung................ 04:48 06:45 06:45 06:52 | | ... ... 08:30 | | | | | ... ... | | | 572|324 Schmölln, Bach-/Bergstr H1.................... | | | | 06:59 07:08 ... ... | 08:26 11:41 11:41 12:22 12:30 ... ... 14:37 14:43 16:38 572|324 Schmölln, Ronneburger Straße............... | | | | 07:00 07:10 ... ... | 08:28 11:43 11:43 12:24 12:32 ... ... 14:39 14:45 16:40 324 Schloßig .................................................. | | | | 07:01 07:12 ... ... | 08:30 11:45 11:45 12:26 12:34 ... ... 14:41 14:47 16:42 324 Burkersdorf bei Schmölln ........................ | | | | 07:03 07:14 ... ... | 08:32 11:47 11:47 12:29 12:36 ... ... 14:43 14:49 16:44 324 Untschen ................................................ | | | | 07:04 07:15 ... ... | 08:33 11:48 11:48 12:31 12:37 ... ... 14:44 14:50 16:45 324 Kleinstechau............................................ | | | | | | ... ... | 08:35 11:50 11:50 12:33 | ... ... | | | 324 Großstechau, Schule............................... | | | | | | ... ... | 08:37 11:52 11:52 12:35 | .. -

Amtsblatt Oberes Sprottental
Amtsblatt Kommunales Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Oberes Sprottental Mitgliedsgemeinden sind: Heukewalde - Jonaswalde - Löbichau - Nöbdenitz - Posterstein - Thonhausen - Vollmershain - Wildenbörten 08. Ausgabe 2. Juli 2015 21. Jahrgang Das nächste Amtsblatt erscheint am 06.08.2015. Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 27.07.2015. VG „Oberes Sprottental“ | 02.07.2015 | Seite 2 Informationen Amtlicher Teil VG „Oberes Sprottental“ Hinweis: Die Veröffentlichung des Amtsblattes erfolgt im Internet auf www.vg-sprottental.de unter Verwaltung/Amtsblätter. Damit sind öf- Nöbdenitz, Am Gemeindeamt 4 fentliche Bekanntmachungen auch im Internet zugänglich. Rufnummern Zentrale/Auskunft 034496 230 - 00 Gemeinde Heukewalde Vorsitzende 230 - 26 Hauptamt (Personal/Soziales) 230 - 12 Hauptamt (Beitragswesen/Allgem.) 230 - 27 Bekanntmachung Liegenschaften 230 - 28 2. Änderung des Flächennutzungsplanes, Sachlicher Bauamtsverwaltung 230 - 24 Teilflächennutzungsplan Windkraft, Aufstellungsbe- Kämmerei 230 - 17 schluss (Beschluss Nr. 248 – 61/2015) Steuern/Mieten/Pachten 230 - 16 Der Gemeinderat der Gemeinde Heukewalde hat in seiner Kasse 230 - 15 Sitzung am 28. Mai 2015 den Aufstellungsbeschluss für die Einwohnermeldeamt 230 - 14 2. Änderung des gemeinsamen Flächennutzungsplanes Ordnungsamt 230 - 13 für das gesamte Gebiet der Gemeinden Heukewalde, Jo- KOBB 230 - 21 naswalde, Vollmershain und Thonhausen gefasst. Fax 034496 23023 Der Beschluss lautet wie folgt: Öffnungszeiten VG „Oberes Sprottental“ Montag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr „Der Gemeinderat fasst den Aufstellungsbeschluss für Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes, Teilfort- Mittwoch geschlossen schreibung „Windenergie“, im Sinne des § 5 Abs. 2 b Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr BauGB zur Fortschreibung des bestehenden Flächen- Freitag geschlossen nutzungsplanes für das gesamte Gebiet der Gemeinden Heukewalde, Jonaswalde, Vollmershain und Thonhausen Öffnungszeiten Einwohnermeldeamt – Sachlicher Teilflächennutzungsplan Windkraft. -

Altenburger Land Greiz Gera
4839 4840 Lucka Teuritz Prößdorf Breitenhain Lucka 4940 Falkenhain Meuselwitz Haselbach Ruppersdorf Haselbach Bünauroda Serbitz Bosengröba Mumsdorf Waldschlößchen Treben Fockendorf Gröba Schnauderhainichen Treben Alte Grube Wintersdorf Plottendorf Kleintreben 4941 Pahna UV 9 3 Fockendorf Heukendorf Am Bahnhof 4939 Zipsendorf Pflichtendorf Primmelwitz Waltersdorf Trebanz Brossen Meuselwitz Lehma Bruderzeche Neubraunshain Pöschwitz Pähnitz Gerstenberg Gerstenberg Zschaschelwitz Rautenberg Borgishain Kriebitzsch Gorma Rositz UV7 Siedlung am 1 3 UV8 9 0 Knau / Schafteich 7 Neupoderschau UV Altpoderschau Rositz Oberzetzscha Windischleuba Windischleuba Kriebitzsch Zechau-Ost Obermolbitz Untermolbitz Pöppschen Zechau Zschernitzsch Rasephas Schelditz Remsa Bocka Neuposa Altenburg Kauerndorf Unterlödla Nord Poschwitz Kleinröda Rödigen Eugenschacht Schelchwitz Kraschwitz Kröbern Wilhelm-Pieck-Siedlung Oberlödla 0 8 Posa 1 Großröda Lödla / Wilchwitz Pöhla Monstab 3 Schömbach 9 / Starkenberg Monstab Wieseberg Drescha Altenburg 7 UVMünsa Neubauernsiedlung Neuenmörbitz 5041 Kostitz Krebitzschen Steinwitz Altenburg Südost Starkenberg Lossen Nobitz Kreutzen Tegkwitz Kotteritz 5039 Kraasa Dölzig Altenburg Werksiedlung A l t e n b u r g e r Gödern Göhren A l t e n b u r g e r Wernsdorf Naundorf Misselwitz Niederleupten Kosma Altendorf Dobraschütz Lutschütz Göhren Paditz Langenleuba-Niederhain Wüstenroda Zweitschen Mehna Zschechwitz Oberleupten LL aa nn dd Tanna Langenleuba-Niederhain Mehna Breesen Kürbitz Stünzhain Klausa Götzenhäuser Lohma Zschernichen -

Sprottental Mitgliedsgemeinden Sind: Heukewalde - Jonaswalde - Löbichau - Nöbdenitz - Posterstein - Thonhausen - Vollmershain - Wildenbörten
Amtsblatt Kommunales Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Oberes Sprottental Mitgliedsgemeinden sind: Heukewalde - Jonaswalde - Löbichau - Nöbdenitz - Posterstein - Thonhausen - Vollmershain - Wildenbörten 09. Ausgabe 6. August 2015 21. Jahrgang Das nächste Amtsblatt erscheint am 03.09.2015. Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist am 24.08.2015. VG „Oberes Sprottental“ | 06.08.2015 | Seite 2 Informationen Amtlicher Teil VG „Oberes Sprottental“ Hinweis: Die Veröffentlichung des Amtsblattes erfolgt auf Nöbdenitz, Am Gemeindeamt 4 www.vg-sprottental.de unter Verwaltung/Amtsblätter. Rufnummern Damit sind öffentliche Bekanntmachungen auch im Inter- Zentrale/Auskunft 034496 230 - 00 net zugänglich. Vorsitzende 230 - 26 Hauptamt (Personal/Soziales) 230 - 12 VG „Oberes Sprottental“ Hauptamt (Beitragswesen/Allgem.) 230 - 27 Liegenschaften 230 - 28 Bauamtsverwaltung 230 - 24 Bekanntmachung Kämmerei 230 - 17 Öffentliche Sitzung der Gemeinschaftsversammlung Steuern/Mieten/Pachten 230 - 16 Werte Einwohner der Mitgliedsgemeinden der Verwal- Kasse 230 - 15 tungsgemeinschaft „Oberes Sprottental“, Einwohnermeldeamt 230 - 14 Ordnungsamt 230 - 13 hiermit lade ich Sie zur öffentlichen Sitzung der Gemein- KOBB 230 - 21 schaftsversammlung Fax 034496 23023 Sitzungstag: 2. September 2015 Sitzungsort: Bürgerstube in Nöbdenitz, Dorfstraße 2 Öffnungszeiten VG „Oberes Sprottental“ Montag 09:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 15:00 Uhr Beginn: 19:30 Uhr Dienstag 09:00 – 12:00 Uhr recht herzlich ein. Mittwoch geschlossen Tagesordnung: Donnerstag 09:00 – 12:00