Frühes 17. Jahrhundert)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
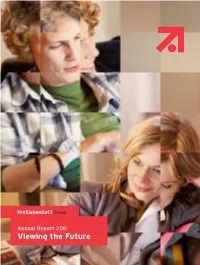
Viewing the Future U2
Annual Report 2011 Viewing the Future U2 VIEWING THE FUTURE 14 BROADCASTING GERMAN-SPEAKING 42 BROADCASTING INTERNATIONAL 128 DIGITAL & ADJACENT 214 CONTENT PRODUCTION & GLOBAL SALES R EPORTS FROM CONSOLIDATED THE EXECUTIVE FINANCIAL AND SUPER- STATEMENTS VISORY BOARD 130 I ncome Statement 131 S tatement of Comprehensive Income 16 LETTER FROM THE CEO 132 S tatement of Financial Position 18 M EMBERS OF THE EXECUTIVE BOARD 133 C ash flow Statement 20 REPORT OF THE SUPERVISORY BOARD 134 S tatement in Changes in Equity 26 P roposed Allocation of Profits 135 N otes 26 M anagement Declaration and Corporate Governance Report 211 R esponsibility Statement of the Executive Board G ROUP MANAGE- 212 A uditor‘s Report MENT REPORT 44 T HE YEAR 2011 AT A GLANCE 46 B usiness Operations and Business ADDITIONAL Conditions 60 T- V HIGHLIGHTS 2011 INFORMATION 62 B usiness Performance 80 S egment Reporting 216 Key Figures: Multi-Year-Overview 83 E mployees 217 Finance Glossary 88 T o he Pr SiebenSat.1 Share 218 M edia Glossary 92 N on-Financial Performance 219 I ndex of Figures and Tables Indicators 221 E ditorial Information 98 PB U LIC VALUE 222 Financial Calendar 100 E vents after the Reporting Period 101 R isk Report 116 O utlook 120 P ROGRAMMING OUTLOOK FOR 2012 Klapper vorne innen U2 PROSIEBENSAT.1 AT A GLANCE The ProSiebenSat.1 Group was established in 2000 as the largest TV company in Germany. Today, we are present with 28 TV stations in 10 countries and rank among Europe‘s leading media groups. -

Milford Performance Center Boosts Charity, Economy
LOCAL POSTAL CUSTOMER Presort Std. Highest Circulation Newspaper in Milford and Orange U.S. Postage PAID When there’s better writing, there’s better reading. Permit #729 Shelton, CT Milford-Orange Times Vol. 8 / Issue 15 www.TheOrangeTimes.com December 19, 2019 Transportation Milford Performance Center Boosts Runs Through Charity, Economy Milford And By Brandon T. Bisceglia Orange The Milford Performance Center has made By Brandon T. Bisceglia it through its third year as a venue for the arts in the city. In that time, founder Steve Cooper, Gov. Ned Lamont’s plan to improve a photographer who also takes pictures for the transportation systems in Connecticut runs Milford-Orange Times, has coupled his efforts through Milford and Orange. to bring in first-class entertainment with his The proposal, dubbed CT2030, lays out efforts to give back to the community. a host of specific projects around the state The most recent example of this charity meant to shore up aging infrastructure, was a donation of $31,000 to Rotary District eliminate choke points and shorten 7980, which covers much of southern commute times. Connecticut, for its global polio eradication The total cost, estimated at $19.4 billion, initiative. The money came as a result of the would be paid for through a mix of low- MPC’s final third season show, featuring interest federal grants, money from the famed musician Arlo Guthrie. state’s Special Transportation Fund and – That show attracted over 900 patrons. most controversially – by tolling trucks at The money raised through ticket sales was certain locations throughout the state. -

Body Curves and Story Arcs
Body Curves and Story Arcs: Weight Loss in Contemporary Television Narratives ! ! ! Thesis submitted to Jawaharlal Nehru University and Università degli Studi di Bergamo, as part of Erasmus Mundus Joint Doctorate Program “Cultural Studies in Literary Interzones,” in partial fulfilment of the requirements for the degree of ! Doctor of Philosophy ! ! by ! ! Margaret Hass ! ! ! Centre for English Studies School of Language, Literature and Culture Studies Jawaharlal Nehru University New Delhi - 110067, India 2016 ! Table of Contents !Acknowledgements !Foreword iii Introduction: Body Curves and Story Arcs Between Fat Shame and Fat Studies 1 Liquid Modernity, Consumer Culture, and Weight Loss 5 Temporality and Makeover Culture in Liquid Modernity 10 The Teleology of Weight Loss, or What Jones and Bauman Miss 13 Fat Studies and the Transformation of Discourse 17 Alternative Paradigms 23 Lessons from Feminism: Pleasure and Danger in Viewing Fat 26 Mediatization and Medicalization 29 Fictional Roles, Real Bodies 33 Weight and Television Narratology 36 Addressing Media Texts 39 Selection of Corpus 43 ! Description of Chapters 45 Part One: Reality! TV Change in “Real” Time: The Teleologies and Temporalities of the Weight Loss Makeover 48 I. Theorizing the Weight Loss Makeover: Means and Ends Paradoxes 52 Labor Revealed: Exercise and Affect 57 ! Health and the Tyranny of Numbers 65 II. The Temporality of Transformation 74 Before/After and During 81 Temporality and Mortality 89 Weight Loss and Becoming an Adult 96 I Used to Be Fat 97 ! Jung und Dick! Eine Generation im Kampf gegen Kilos 102 III. Competition and Bodily Meritocracy 111 The Biggest Loser: Competition, Social Difference, and Redemption 111 Redemption and Difference 117 Gender and Competition 120 Beyond the Telos: Rachel 129 Another Aesthetics of Competition: Dance Your Ass Off 133 ! IV. -

Mythos Bauhaus
Fernsehen 14 Tage TV-Programm 7. bis 20.2.2019 „Lotte am Bauhaus“, 13. Februar, 20.15 in der ARD Mythos Bauhaus Festung zu vermieten? Federico Fellini Feature über das Kreuzberger Zum 25. Todestag: Dragoner-Areal im Kulturradio Zehn Filme in einer DVD-Box tipTV_0419_01_Titel [P]_21041522.indd 1 24.01.19 17:43 FERNSEHEN 7. – 20.2. TELEVISOR Unerwünschte Transparenz VON LUTZ GÖLLNER Seit Juli 2016 vertritt der österreichi- sche Wirtschaftswissenschaftler und Jurist Leonhard Dobusch den Be- STUDIOCANAL reich „Internet“ im Fernsehrat des FOTO ZDF. Fast zeitgleich begann er auf der Plattform Netzpolitik.org und auf Twitter (@leonidobusch) über seine Arbeit dort zu bloggen. Sein Ziel: Transparenz schaffen in einem Gre- mium, das davon lebt, dass Ent- HONZIK STANISLAV / FICTION UFA / MDR scheidungen, die alle Zuschauer FOTO betreffen, unter Ausschluss der Öf- Passt, wackelt und hat Luft: Lotte (Alicia von Rittberg, Foto) beim Bauen fentlichkeit gefällt werden. Eine For- derung, die von einem Urteil des ARBEITSWELT Verfassungsgerichts unterstützt wur- de. Nur einige Mitglieder im Fern- sehrat selber sehen das nicht so ein. Dobuschs Blog ist auch deshalb so Der „Neue Mensch“ lesenswert, weil er immer Ross und Reiter benennt, aber niemanden an- Zum 100. Geburtstag des Bauhauses beleuchtet die ARD das klagt oder denunziert. Natürlich gibt Schicksal der Frauen, die dort studierten und lehrten es auch der Reform des Rates nach wie vor rote und schwarze „Freun- it dem „Tunnel“ entstaubte die jun- Paul Seligmann (Noah Saavedra) – ist eng deskreise“, und Dobusch protokol- M ge Firma teamWorx vor zwei Jahr- an das ihrer Ausbildungsstätte gekettet, liert alles, was in diesen Zirkeln ge- zehnten das deutsche Geschichtsdrama. -

Wealth Year 1500
Wealth Year 1500 Produced by the SASI group (Sheffield) and Mark Newman (Michigan) In the year 1500 European territories were some of the wealthiest on earth, when measured by the Gross Domestic Product (GDP) per person. The regions with the largest total GDPs were Eastern Asia and Southern Asia. These were also the most populous regions at that time. The regions with the lowest GDP in 1500 were Central Africa and Southeastern Africa. These regions also had the lowest GDP per person. In 2002 these regions enjoyed an even smaller proportion of the world total GDP expressed in purchasing power parity dollars than they did in 1500. Territory size shows the proportion of worldwide Gross Domestic Product equalised in US$ in purchasing power parity that was produced there in 1500. TOP TEN AND OTHER NOTABLE RATES OF WEALTH PER PERSON IN YEAR 1500 TIMELINE OF WORLD WEALTH Rank Territory Value Rank Territory Value 40000 1 Italy 1100 11 Norway 640 35000 2 Belgium 875 12 Switzerland 632 30000 3 Netherlands 761 21 Portugal 606 25000 4 Denmark 738 23 China 600 20000 Land area 5 France 727 53 India 550 15000 Technical notes 6 United Kingdom 714 60 Ireland 526 • Data are from Angus Maddison’s 2003 The World 10000 Economy. 7 Austria 707 61 Japan 500 • Gross Domestic Product is measured in Purchasing 8 Sweden 695 65 Iraq 499 5000 Power Parity (PPP) US$, thus PPP US$1 has the 0 same purchasing power in every territory. This 9 Germany 688 86 Turkey 496 annual gross domestic product in US$ per power parity by region person purchasing PPP is in 1990 prices. -

Johnson & Johnson Recall Cuts OTC Sales by Quarter
OTC30-04-10p1.qxd 27/4/10 13:01 Page 1 30 April 2010 COMPANY NEWS 3 Johnson & Johnson recall Ransom has no plans to 3 sell more brands Recall not only reason for 4 J&J’s slump cuts OTC sales by quarter Omega Pharma sees sales rise 5 by 4% to over C200 million oluntarily recalling Tylenol and other Neil Consumer Healthcare business a warn- Boehringer OTC goes up 6 VOTC products in response to regula- ing letter about the unit’s Las Piedras plant in despite economic crisis tory concerns slashed US sales by Johnson Puerto Rico. Pharmstandard snaps up stake 7 & Johnson’s OTC & Nutritionals business The firm immediately initiated a voluntary Novartis OTC grows ahead of market 8 unit by a quarter in the first three months recall of certain lots of its Benadryl, Motrin, Economic crisis hits turnover at Krka 9 of this year. Rolaids, Simply Sleep, St Joseph Aspirin and Sales by the business in the US had slump- Tylenol products made at the facility (OTC 36.6 restructures as 10 turnover declines ed by 25.3% to US$542 million (C404 million) bulletin,10 February 2010, page 22). The re- in the period, revealed Dominic Caruso, John- call applied to the Americas, the United Arab GENERAL NEWS 11 son & Johnson’s chief financial officer,who ad- Emirates (UAE) and Fiji. mitted that second-quarter sales would also be Consumer reports of “an unusual mouldy, EMA recommends bufexamac 11 hit by the recall. He claimed, however, that the musty or mildew-like odour that, in a small withdrawal action had “not really impacted physician rec- number of cases, was associated with tempo- Germany’s BAH fears the rise of 12 ommendation or consumer preferences” for the rary and non-serious gastrointestinal events” mail-order pharmacy company’s OTC products. -

Ein Todesbote Ermittelt
Fernsehen 14 Tage TV-Programm 25.1. bis 7.2.2018 Ein Krimi von Volker Schlöndorff: „Der namenlose Tag“ am 5.2. im ZDF Ein Todesbote ermittelt Kampf ums Vaterland Electric Dreams Feature über rechtsradikale Milizen Anthologie-Serie nach den Storys von in den USA im SWR 2 Philip K. Dick bei Amazon Prime tipTV_0318_01_Titel [P]_18515232.indd 1 18.01.18 18:14 FERNSEHEN 25.1. – 7.2. SEITENBLICKE Keine Quote VOM TELEVISOR Natürlich ist das ganz doll gemein von den deutschen Zeitungsverle- gern, dass sie das öffentlich-recht- PRIME CHANNEL4/AMAZON liche Fernsehen dauernd „Staats- FOTO fernsehen“ nennen. Mit dem Staat hat der Rundfunkrat natürlich gar nix zu tun (auch wenn er haupt- sächlich aus Parteisoldaten und „gesellschaftlich relevanten Grup- pen“ besteht). Das sind alles KLEIN ZDF/CONNY Kampforte, die der Televisor aus FOTO der Ferne und eher amüsiert beob- Jakob Franck (Thomas Thieme, Foto, li.) ist der Todesengel von Erfurt achtet. Aber wenn, wie am 12. Januar das PRIMETIME-KRIMI TV-Quoten-Messsystem komplett ausfällt und die Reaktionen aller Sender – öffentlich-rechtlicher und kommerzieller – darin besteht, be- Schlöndorfs Rache treten in die Luft zu gucken, dann ist das schon sehr witzig. Denn Der Kinoregisseur Volker Schlöndorff kehrt ins Fernsehen zurück egal ob nun werbe- oder rundfunk- steuerfinanziert, die Quote ist r ist der Todesbote einer gepegten könne „Ich war mir nicht sicher, ob genug schließlich der Lebensschlauch, an E Kleinstadt. Seit Jahren überbringt Spannung aukommen kann. Genau ge- dem angeblich alle hängen. Sie ist Kriminalkommissar Jakob Franck den nommen passiert ja nichts, was einen der Grund für das miese Programm Angehörigen der Opfer von Verbrechen klassischen Krimi ausmacht.“ von Sat.1Pro7RTLKabel1. -

Jomar Template
Journal of Martial Arts Research, 2019, Vol. 2, No. 2 DOI: 10.15495/ojs_25678221_22 Kristin Behr & Peter Kuhn A Fighter’s Life Conceptualizing a Cross-Cultural Research Program Abstract The paper conceptualizes a cross-cultural research program on fighters’ lives. Within the research context of research on athletes’ careers, fighters’ (auto-)biographies, disciplinary studies about fighting, and successful aging at work the authors aim at modelling typical life courses of fighters at a maximum diversity. The main data source are in-depth interviews with high- and top-level martial artists and combat sports athletes. Concerning findings, an overview is presented which can be put in the nutshell that fighters’ lives are diverse, dis- tinct, and dynamic. Against this backdrop the authors provide an outlook on further re- search. Zusammenfassung In dem Beitrag geht es um die Konzeption eines interkulturellen Forschungsprogramms zum Leben von Kämpfern. In den Forschungszusammenhängen Karriereforschung von Athleten, (Auto-)Biographien von Kämpfern, Studien verschiedener Disziplinen über Kampfsport und erfolgreiches Altern am Arbeitsplatz zielen die Autoren darauf ab, typische Lebensverläufe von Kämpfern in maximaler Vielfalt zu modellieren. Hauptdatenquelle sind biografische In- terviews mit Top-Athlet*innen im Kampfsport. Die Befunde führen zur Schlussfolgerung, dass Lebensläufe von Kämpfern vielfältig, spezifisch und dynamisch sind. Vor diesem Hintergrund geben die Autoren einen Ausblick auf die weitere Forschung. Keywords Martial arts; combat sports; athletes’ careers; cross-cultural approach; biography; in-depth interview Contact Prof. Dr. Peter Kuhn University of Bayreuth [email protected] This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International and published in the JOMAR | Journal of Martial Arts Research (ISSN 2567-8221) on 2019-07-11 For more: j-o-mar.com Behr, K. -

Julia Mattes Lagerthas Schwestern? Über Kämpferinnen in Der (Früh-)Geschichte Und Waffengräber Von Frauen in Nordeuropa
Julia Mattes Lagerthas Schwestern Julia Mattes Lagerthas Schwestern? Über Kämpferinnen in der (Früh-)Geschichte und Waffengräber von Frauen in Nordeuropa. Zusammenfassung Während kämpfende Frauen längst fester Bestandteil der westlichen Popkultur und somit für viele jüngere Menschen selbstverständlich sind, finden sie von Seiten der Geschichtswissenschaft keine sonderliche Beachtung. Obwohl die Geschichtsschreibung zahlreiche Beispiele für kämpfende Frauen, Kriegerinnen und Soldatinnen verzeichnete, genießt diese Thematik innerhalb des Faches keine große Aufmerksamkeit. Noch weniger befasst sich die prähistorische Archäologie mit diesem Topos. Obwohl in letzter Zeit eindeutige eisenzeitliche Frauen-Waffengräber in Skandinavien und England zu Tage kamen, scheint die Interpretation "Kriegerin" für viele Wissenschaftler, insbesondere in der Archäologie, ein Problem zu sein. Das Bild von Frauen in Waffen wird trotz vielzähliger historisch belegter Exempel und entsprechender archäologischer Befunde schlichtweg abgelehnt. Oft wird angeführt, es gäbe keine historischen Belege für die Existenz streitender Frauen. Dies ist schlichtweg falsch. Ziel dieses Papers ist es, der Forschung einen kleinen Überblick über die entsprechenden Aktivitäten von Frauen in früheren Jahrhunderten zu geben und sich ferner mit der Frage auseinander zusetzen, weshalb dies für große Teile der rezenten archäologischen Forschung so problematisch zu sein scheint. Dies offenbart auch eine historisch gewachsene, fundamentale methodische Problematik des Faches. Schlüsselworte: Archäologie; Geschichte; Kunstgeschichte; England; Finnland; Norwegen; Schweden; Skandinavien; Mittelalter; Wikingerzeit; Frauengrab; Methodik; Schwertfunde; Waffengräber; Kriegerin; Schildmaid; Japan; Ninja; Onna-bugeisha; Samurai; Kreuzzug, Kriegszug; Krieg. Abstract While for quite some time fighting women have been a fixed part of western pop culture and thus a normal sight for younger people, historical science has so far not been paying any particular attention to them. -

130404 Party Hugos GB
Communications Motorsport Daniel Schuster Tel : +49 841 89-38009 E-mail: [email protected] www.audi-motorsport.info Party time: the DTM family guest of Audi • Audi starts the 2013 DTM season with almost 500 guests • DTM drivers enjoy evening in Munich scene hotspot H’ugo’s • Audi Financial Services and Akrapovič presented as partners Ingolstadt, April 4, 2013 – Audi staged an impressive launch on Thursday evening to signal the start of the crucial preparation phase for the season opening in exactly one month. The event was attended by almost 500 guests from sport, industry and the media. At the heart of the turmoil in the Munich trend restaurant H’ugo’s: the eight DTM drivers, Motorsport Boss Dr. Wolfgang Ullrich and numerous VIPs. If this evening was a foretaste for the 2013 DTM season, then the fans can look forward to an exciting year: at the ‘Audi DTM Warm-up 2013’ in the Munich scene hotspot H’ugo’s, the drivers around double Champion Timo Scheider, shooting star Edoardo Mortara as well as newcomer Jamie Green appeared easygoing and relaxed, but also feisty and ready for action. “Our goal is to bring the title back to Ingolstadt,” explained Scheider on behalf of his team-mates. Audi issued the invitation to Munich to present its squad for the 2013 season to media representatives and all other members of the DTM family. The guests had the opportunity to have a quiet chat away from the pit lane and paddock with the racing drivers, team bosses and the personalities responsible for motorsport at the four rings, and to get in tune together for the ten races. -

Bryan Adams. Performer & Photo Artist
ISSUE NO 03 | 2020 Bryan Adams. Performer & Photo Artist. NICK VEASEY. The man with the X-ray eyes. SOUTH AFRICA. A travel diary. CHRISTINE THEISS. Dr. Kick, reloaded. EUR SFR USD USA 8 USA GERMANY 8 SWITZERLAND 10 “THE HELL GAP” The travel trend of glamping charmingly combines an outdoor FROM THE JAMES HARMONICA FROM vacation close to nature with a luxurious, classy break. What is particularly attractive about this type of travel is that it BRAND TIFFANY & CO. could hardly be any more individual. Everyone writes their very own story. The knife for go-getters and those The ultimate campfire instrument: who want to change the world: a sterling-silver harmonica in C major Glamping – a portmanteau formed from the terms “glamorous” from the new Men’s Collection. For cozy and “camping” – promises the relaxed lifestyle of camping, but a named after the arrowhead found at luxury version. Thanks to the latest technology, a special feature Hell Gap in Wyoming. hours around the fire. of these extraordinary adventures is that you can go up to a week thejamesbrand.com tiffany.com without electricity or water. Camping by picturesque lakes or in USD 395.00 the middle of the forest, far away from the masses of tourists, €360.00 gives you a moment of peace and, above all, time to find yourself. A couch and your own kitchen in among the natural world – a romantic vision that has long since become attractive not only to dropouts and lovers of garden gnomes. CIT-E BACKPACK Anyone who assumes camping is inferior to a luxury vacation should take a trip with the “Flair” mobile home from FROM SAINT LAURENT Niesmann+Bischoff. -

Dossier: Interviews
Dossier Interviews Kultur Jana Seibert Seite 2 Britta Schümchen 4 Yvonne Buschermöhle 6 Politik Ximena Bustamente 8 Anne Schlüter 10 Jana Falk 12 Medien Lisa Granzow 14 Susan Gössling 16 Kremena Atanasova 17 Nithupa Kumaranantham 19 Ioanna Pipidi 21 Job & Karriere Patrizia Reimann 24 Patrick Hagedorn 26 Isabel Jarosch 28 Bildung Julia Wilms 30 Kristina Siebert 31 Tim Kühne 33 Delia Träger 35 Leben Marius Lauff 37 Sport Brigitte Lieb 39 Kerstin Klocke 41 Tim Diekmann 43 Svenja Vogel 45 Rianna Hoffmann 47 Seminar „Interviews im Print- und TV-Journalismus“ Leitung: Miriam Sahli M.A. „Große Krisen sind super, da schreibt man sich die Seele gesund!“ Warum auch Krisenzeiten weiterführen und ein leeres Konto von Vorteil sein kann: Ein Gespräch mit Autorin Claudia Schreiber über Inspiration, den Tod und die Zukunft. Claudia Schreiber, 1958 als Claudia Klemme in Nordhessen geboren, studierte Publizistik, Pädagogik und Soziologie in Göttingen und Mainz. Sie arbeitete drei Jahre als Redakteurin und Reporterin beim Südwestfunk, sowie drei Jahre beim Zweiten Deutschen Fernsehen in Mainz. Nach Auslandsaufenthalten in Moskau und Brüssel lebt sie heute als freie Autorin in Köln. Ihr Roman „Emmas Glück“ erschien 2003, wurde mittlerweile in zehn Sprachen übersetzt und 2006 mit Jördis Triebel und Jürgen Vogel in den Hauptrollen verfilmt. Zur Zeit schreibt sie unter anderem an dem Drehbuch zu ihrem Buch „Süß wie Schattenmorellen“. Von Jana Seibert 2 Claudia Schreiber. Foto: Anita Affendranger Claudia Schreiber, du bist eine erfolgreiche Schriftstellerin, Drehbuchautorin und Geschichtenerzählerin. Claudia, was inspiriert? Claudia Schreiber: Inspiration, das ist Hirn und Herz. Hinhören, hinsehen, sich über jeden Mist aufregen, mit Menschen jeden Alters und jeder Herkunft unterhalten.