Geschichte Der Olympiaregion Seefeld
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Interalpen Magazine Autumn & Winter 2020 / 2021
Interalpen Magazine Autumn & Winter 2020 / 2021 Dear guests, None of us could have imagined that 2020 would begin the way it did. After a long period of contemplation, the desire for normality and the world we know is returning. A situation like this becomes less of a challenge if eased by enduring values, a sense of security and a sprinkle of variety. At the Interalpen-Hotel Tyrol, we have ensured everything is ready for you, and gathered from many sources of inspiration, to guarantee you another magnifi- cently relaxing and refreshing stay with us. Once again, there are countless treasures to be dis- covered during the autumn and winter seasons in the Tyrolean Alps. Just some of the options include fascinating cultural hikes in the vibrant colours of the countryside, impressive visits to museums in towns with urban flair, enchanting Christmas markets with breath-taking views and devilishly entertaining folklore events. As always, every thrilling programme of activities ultimately brings you home to the comfort of our popular facilities and offerings. Enjoy the peace and space of the Interalpen-spa, choose from a colourful potpourri of feel- good treatments, and treat yourself to culinary delights crafted in our award-winning kitchens. Over the past few months, one message has been re- ceived very clearly by all: The key to a happy life is to concentrate on the essentials, and to enjoy the special things every day has to offer. We are looking forward to welcoming you back to our hotel, and until your arrival we wish you all the very best. -

Flyer Wanderparadies Obere Isar (PDF, 2.91MB)
DAV_2021_OBERE_ISAR_LEUTASCH.qxp_0708_DAV_BERGER_WETTERSTEIN 15.04.21 10:43 Seite 1 Hier können Sie aus- und zusteigen Unterwegs im Gebirge Mit der Bahn zum Wandern nach Die Anreise mit der Bahn Dank der vielen Haltestellen ist die Bahn das ideale Verkehrsmittel zur Anreise in die Mittenwald, Scharnitz und Seefeld ist günstiger, als Sie denken: Region Mittenwald – Scharnitz – Seefeld. Mit der Bahn kommen Sie bequem an alle Ausgangspunkte der umseitig beschriebenen Touren – und abends auch wieder entspannt nach Hause. Wer im Gebirge unterwegs ist, sollte sich mit den alpinen Gefahren vertraut machen und seine Tour sorgfältig planen. Trotz aller Infrastruktur sind die Berge rund um Mittenwald, er kennt ihn nicht: den morgendlichen Stau von Das bis Klais oder Mittenwald gültige Regio-Ticket Scharnitz und Seefeld ein alpines Gebiet, in dem es zu Mit der Bahn München in Richtung Berge, am Abend das glei- Werdenfels gilt täglich ab 0 Uhr und kostet für Einzelrei- Wetterstürzen, Steinschlag und anderen unvorhergesehenen W Ereignissen kommen kann. che nervenaufreibende Spiel in die andere Rich- sende 22 € pro Tag und für bis zu vier Mitfahrer jeweils in die Berge tung. Dabei verfügen das Werdenfelser Land und die Olym- weitere 8 €. piaregion Seefeld über exzellente Bahnverbindungen! Doch Bis zu drei Kinder (6–14 Jahre) sowie generell Kinder unter Tipps für die Tourenplanung es gibt noch mehr Gründe, das Auto einfach mal stehen zu 6 Jahren können kostenlos mitgenommen werden. Es gilt lassen. in den Nahverkehrszügen der DB auf ausgewählten 14 Wander- und Bergtouren in der Strecken im Werdenfelser Land, in den RVO-Bussen und weiteren regionalen Verkehrsunternehmen sowie in den Region um Mittenwald, Scharnitz Zügig & unkompliziert: Mit der Bahn kön- Regionalzügen und S-Bahnen im Münchner S-Bahn- und Seefeld nen Sie in 100 Minuten ohne Umsteigen Bereich. -

Fact Sheet Olympiaregion Seefeld-Leutasch
Fact Sheet Olympiaregion Seefeld-Leutasch (Er)lebenswert für 3 Generationen Lage Internationale Urlaubsdestination im Herzen der Alpen Seehöhe 1.180 m Kurzportrait Eingebettet und geschützt durch die Gipfel des Wettersteingebirges, die Hohe Munde, den Alpenpark Karwendel und das Landschaftsschutzgebiet Wildmoos besticht das nach Süden hin geöffnete, sonnige Hochplateau auf 1.200 m durch seine einmalige Lage und bietet zusätzlich ein „Anreise-Plus“: Die 5 Orte sind bequem mit internationalen Zugverbindungen (Intercity-Anschluss direkt nach Seefeld), Flughafen Innsbruck (25 min.), Flughafen München (90 min.), per Auto via Garmisch – Mittenwald „vignettenfrei“. Ein attraktives Regionalbus-System verbindet alle Orte. Klare Bergluft, wunderbare Landschaft und intakte Natur, ein Sportangebot, das keine Wünsche offen lässt, eine Vielzahl von Veranstaltungen und echte Tiroler Gastfreundschaft. In den fünf ganz unterschiedlichen Orten Seefeld, Leutasch, Mösern / Buchen, Reith und Scharnitz findet man vom luxuriösen 5*****S Hotel bis zum Komfort-Bauernhof alles. Hauptorte Seefeld: 3.200 Einwohner 1.200 m Seehöhe Leutasch: 2.200 Einwohner 1.140 m Seehöhe Scharnitz: 1.300 Einwohner 964 m Seehöhe Reith: 1.200 Einwohner 1.180 m Seehöhe Mösern: 344 Einwohner 1.250 m Seehöhe Berggipfel Zugspitze 2.962 m Birkkarspitze 2.749 m Hohe Munde 2.662 m Gehrenspitze 2.367 m Seefelder Spitze 2.221 m Rotmoosalm 2.030 m Entfernungen München 126 km / 95 Minuten Innsbruck 24 km / 30 Minuten Verkehrsspinne Geo-Koordinaten LAT 47.370255 Hotel Xander LON 11.142969 Aparthotel Xander GmbH www.xander-leutasch.at Seite 1 von 4 Unterkünfte & In den fünf Orten der Olympiaregion Seefeld-Leutasch findet man Übernachtungen alle denkbaren Unterkünfte - vom luxuriösen 5*Superior Hotel über alle Hotelkategorien bis hin zum gemütlichen Gasthof, freundliche und familiär geführte Frühstückspensionen, Komfortbauernhöfe und voll ausgestattete Appartements in allen Größen sowie Campingplätze. -

Mit Der Bahn Zum Wandern Nach Mittenwald, Scharnitz Und Seefeld
Hier können Sie aus- und zusteigen Unterwegs im Gebirge Mit der Bahn zum Wandern nach Die Anreise mit der Bahn Dank der vielen Haltestellen ist die Bahn das ideale Verkehrsmittel zur Anreise in die Mittenwald, Scharnitz und Seefeld ist günstiger, als Sie denken: Region Mittenwald – Scharnitz – Seefeld. Mit der Bahn kommen Sie bequem an alle Ausgangspunkte der umseitig beschriebenen Touren – und abends auch wieder entspannt nach Hause. Wer im Gebirge unterwegs ist, sollte sich mit den alpinen Gefahren vertraut machen und seine Tour sorgfältig planen. Trotz aller Infrastruktur sind die Berge rund um Mittenwald, er kennt ihn nicht: den morgendlichen Stau von So kostet mit dem bis Klais oder Mittenwald gültigen Scharnitz und Seefeld ein alpines Gebiet, in dem es zu Mit der Bahn München in Richtung Berge, am Abend das glei- Regio-Ticket Werdenfels die Tageskarte für Einzelreisen- Wetterstürzen, Steinschlag und anderen unvorhergesehenen Ereignissen kommen kann. W che nervenaufreibende Spiel in die andere Rich- de 23 € aus dem gesamten Münchner S-Bahn-Netz über in die Berge tung. Dabei verfügen das Werdenfelser Land und die Olym- Garmisch-Partenkirchen bis an den Fuß des Karwendelge- piaregion Seefeld über exzellente Bahnverbindungen! Doch birges. Bis zu vier Mitfahrer zahlen jeweils weitere 8 €. Tipps für die Tourenplanung es gibt noch mehr Gründe, das Auto einfach mal stehen zu Bis zu drei Kinder (6 bis einschl. 14 Jahre) sowie generell lassen. Kinder unter 6 Jahren können kostenlos mitgenommen 14 Wander- und Bergtouren in der werden. Eine ganze Familie (2 Erwachsene, 3 Kinder bis Region um Mittenwald, Scharnitz einschl. 14 Jahre) bezahlt also nur unschlagbare 31 €! Zügig & unkompliziert: Mit der Bahn kön- Wenn Sie von außerhalb des Münchner Raums anreisen, und Seefeld nen Sie in 100 Minuten ohne Umsteigen empfiehlt sich das Bayern-Ticket. -

Repairing Innsbruckerstraße / Regaining Scharnitz
SCHOOL/DEPARTMENT: Architecture & Planning COURSE OUTLINE: ARCHDES700 / Semester 1, 2017 1.0 GENERAL COURSE INFORMATION Course Code: ARCHDES700 Course Title: Advanced Design 1 Points Value: 30 points Prerequisites: N/a Restrictions: N/a Course Director: Prof Andrew Barrie, Room 335, Building 421, [email protected] Course Co-ordinator: Dr Ross Jenner, Room 547, Building 421, [email protected] Teaching Staff: Mike Davis and Alexander Sacha Milojevic, [email protected] and [email protected] 2.0 CLASS CONTACT HOURS University of Auckland: Monday, Tuesday & Friday, 1pm – 5pm; Level 3 Design Studios, Building 421. Universität Innsbruck: Monday- Friday, 10am – 6pm 3.0 COURSE PRESCRIPTION A studio based inquiry into an architectural topic approved by the Head of School of Architecture and Planning intended to facilitate in-depth study that is both tailored to a student's own interest and aligned with the School's research clusters, sharing workshops, discussions, pin-ups and tutorials. REPAIRING INNSBRUCKERSTRAßE / REGAINING SCHARNITZ 1-4. 5-7. 1 | 13 REPAIRING A MAIN STREET / REGAINING A TOWNSCAPE Scharnitz is on the verge of a significant phase of urban recovery. The main public space of the town, Innsbrucker Straße (Innsbruck Street), is the municipality’s sector of the Seefelder Straße or Austrian Federal Road B177 from the Inntal becoming the German Federal Road E533 a few hundred metres north of the centre of Scharnitz. The town’s main street, over the past few decades, has barely survived the destructive effects of modern-day volumes of goods vehicle and tourist traffic serviced by petrol stations, imbisslokal (takeaways) and some visitor accommodation. -
Masterarbeit
Masterarbeit Titel der Masterarbeit: „Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt!“ - Der „Abwehrkampf“ der „Hitlerjugend“ in den letzten Kriegsmonaten mit besonderer Berücksichtigung des Kampfes um Scharnitz und des Kriegsendes in Tirol im Mai 1945 Verfasser: Dominik ENDER, BA 01116297 angestrebter akademischer Grad: Master of Arts (MA) Innsbruck, 2018 Studienkennzahl lt. Studienblatt: C 066 803 Studienrichtung lt. Studienblatt: Masterstudium Geschichte Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Mag. Dr. Thomas Albrich „Wir werden weiter marschieren, wenn alles in Scherben fällt!“ Der „Abwehrkampf“ der „Hitlerjugend“ in den letzten Kriegsmonaten mit besonderer Berücksichtigung des Kampfes um Scharnitz und des Kriegsendes in Tirol im Mai 1945 HJ-Bann Patch, [http://www.alteregaliazone.net/wp-content/uploads/2016/01/HJ_FLAGBEARER.jpg], eingesehen 22.09.2017. Eigene Darstellung. 2 Inhaltsverzeichnis I. Einleitung ................................................................................................................................ 4 1. Quellenlage ............................................................................................................................. 7 2. Die ideologische Prägung der Hitlerjugend ........................................................................... 8 2.1 Die „Wehrertüchtigungslager“ der Hitlerjugend ............................................................ 13 2.2 Von der Hitlerjugend in die deutschen Streitkräfte ........................................................ 16 2.3 Die „Verführung“ -

Karwendel - Geologischer Bau Und Versuch Einer Tektonischen Rückformung
Geol.Paläont.Mitt. Band 8 Innsbruck Festschrift S.227-288 Innsbruck, Sept. 1978 W.HEISSEL Karwendel - geologischer Bau und Versuch einer tektonischen Rückformung von G. Heißel Zusammenfassung Gestützt auf die ersten detaillierten Geländeaufnahmen großer Gebiete des Karwendelgebirges (Nördliche Kalkalpen, Oberost- alpin; nördlich von Innsbruck, Tirol, Österreich) seit 0. AMPFERER (1912, 1950) zeigt sich ein in wesentlichen Punkten vollkommen neues Bild des geologischen Baus dieses Gebirges. Es/ handelt sich grundsätzlich um eine sehr komplizierte nordver- gente Decken- und Schuppentektonik mit Transportbeträgen bis in den Zehnerkilometerbereich, vielleicht vereinzelt auch darüber. Die Argumente anderer Autoren, die für gebundene (autochthone) Tektonik (vor allem der Inntaldecke) sprachen, konnten wider- legt werden. Zwischen Lechtaldecke (tiefere Decke) und Inntal- decke (höhere Decke) befindet sich eine Zone ausgeprägter Schup- pung, die sogenannte Karwendelschuppenzone, deren Bau vieler- orts erstmals im Detail festgelegt werden konnte. Die Interpre- tation des Baus der Inntaldecke erfuhr im Zug der Geländearbei- ten (1974-1978) ebenfalls bedeutende Veränderungen. Vor allem sei auf die endgültige Festlegung der Umrahmung der Inntaldecke im Karwendel auf die einzigen unbestreitbaren und daher eindeu- tigen Grenzen verwiesen sowie auf die Interngliederung der Inntaldecke in 12 nordvergente Großfalten (bisher 6). Schließ- lich wurde erstmals die charakteristische Kleinfaltung am Kar- wendelsüdrand erkannt, der sekundär teilweise Südvergenz auf- geprägt wurde. Jede festgestellte Südvergenz sowie die teil- weise vorhandene Steilstellung von Bewegungsbahnen im Karwendel Anschrift des Verfassers: Dr. Günther Heißel, Institut für Geologie und Paläontologie, üniversitätsstraße 4, A-6O2O Innsbruck sind auf eine spätere tektonische Phase(Nachdrängen weiterer ober- bis unterostalpiner Einheiten auf den Decken- und Schuppen- bau des Karwendeis) zurückzuführen. Es werden kurz auch überre- gionale tektonische Fragen sowie morphologische und hydrogeolo- gische Fragen etc. -

HIKING- & Cultural GUIDE of the Olympiaregion Seefeld
€ 3,- HIKING- & CULTURaL GUIDE of the Olympiaregion Seefeld www.seefeld.com, [email protected], Tel. +43 (0)5 08800 www.seefeld.com, [email protected], Tel. +43 (0)5 08800 2 OlympiaregiOn Seefeld a village for any age Dear hikers, Description The little hiking and culture guidebook offers a We have put together a fantastic network of hi- wealth of ideas and suggestions to help you king and mountain bike routes throughout the enjoy your holiday to the full the way you want. Olympiaregion Seefeld. All the trails mentioned It will accompany you as you explore this en- here are signposted and marked and maintai- chanting region of unrivalled scenic diversity. ned on a regular basis. We kindly ask you to Nestling amid the stunning mountains of the follow only the sign-posted trails, not to leave Wetterstein range, the Alpenpark Karwendel any rubbish lying around and to take care of and the Wildmoos landscape protection area, our countryside. In the following pages, de- the Olympiaregion Seefeld provides the ideal tailed descriptions of the main hiking trails and 'base camp' for all those who want 'that bit mountain bike routes can be found. You will more' out of their holiday. Whether you want to find the trail numbers on both the hiking and explore the many themed walking trails and find mountain bike map and on the signposts in out all about the local flora and fauna as well as the countryside. The hiking trails are classified the traditions and customs of the locals living according to walking time and level of difficul- on the plateau, or you simply want to savour ty and sub-divided into easy walks, half-day the tranquillity of solitary summits – you’re sure hikes, full-day hikes and summit climbs. -
Familien- & Ausflugstipps
DE FAMILIEN- & AUSFLUGSTIPPS Olympiaregion Seefeld seefeld.com 2 INHALT FAMILIEN & AUSFLUGSTIPPS WASSERWELTEN Schwimmbäder ...................................................... 5 Badeseen .................................................................6 Seen ..........................................................................8 Kneippanlagen ..................................................... 10 Angeln ......................................................................11 Klammen .................................................................12 Isarursprung ..........................................................14 Kajakfahren ............................................................15 Sup & Sup-Yoga ....................................................15 Tretbootfahren .....................................................15 TIERE Alpakas ....................................................................17 Reiten ......................................................................17 Pferdekutschen-Fahrten ....................................19 Streichelzoo ......................................................... 20 AUSSICHTSPLATTFORMEN & BERGBAHNEN Aussichtsplattformen.........................................23 Bergbahnen ..........................................................24 ERLEBNISWANDERUNGEN Erlebniswanderungen ........................................27 3 KUNST & KULTUR Sakralbauten ........................................................33 Museen ..................................................................35 -

Oberammergau and Its Passion Play, 1910. Munich. Routes to Oberammergau. Oberammergau and Its Environs. the Royal Castles. Garmi
DD UC-NRLF 901 025&7 to C\J m GIFT OF Mr* M Mangasarian log. Bruckmann's Illustrated Guide. assion Play 1910 Munich, Routes to Oberammergau, "to Royal Castles, Garmisch etc. etc. Illlllllll III HI IHIIIII HHII Illlllllllllllllllllllllllllllllll Illllllllll I Royal Umbrella Manufactory of Austria J. B. FENSTERER By Appointment to the Royal Court of Bavaria 44 Theatinerstr. 44 MUNICH Entrance Perusastr. Umbrellas, Parasols, En Tout Cas, Walking Sticks. German, French and English Style. On parle frangais. <<#>* English Spoken. Daily Supply of Novelties. Branch in NUREMBERG, Kaiserstr. 21. I 111[111] I HIIIIIIIIIIIIIMl SCHENKER & Co. TOURIST OFFICE MUNICH, 16 PROMENADEPLATZ 16. TELEGRAMS: WELTREISEN. - TELEPHONES: 4700, 4701, 4702, 2203. Official Agents for the Passion Play at Oberammergau 1910. Branch-Offices: Bad Kissintjen Bad Reichenhall Nuremberg Kurhausstrasse 4 Central-Station Bozen Oberammergau Hotel Greii Building Hotel Wittelsbach Luggage forwarding and ticket office of the Royal Bavarian State-Railways, Rgency of all Steamship- Companies of the world. Correspondents of THOS. COOK & SON. Sleeping Car Hgency. Hll kinds of Railway and Steamship Tickets. Motor car excursions around the city and its environs. Conducted tours to all parts of the world. Conducted and independant tours to Oberammergau and the royal Castles. Hrrangements to witness the Passion Play. General Agency of the ,,GENTRAL GARAGE" in Ober- ammergau 1910 Central Agency of the ,,UNION", Auto Fernverkehr, Munich. I Permanent Exhibition of the G fi Munich ; G flrtists Association G Maximilianstr. 26 Munich Maximilianstr, 26 G in the building of the Old National (! Museum (nouj Deutsches Museum) 2582 G Telephone I Open daily fldmission 50 Pfg. I Visiting time: on I Weekdays 96 o'clock, :: Sundays :: I and Holidays 101 o'clock. -

Ceremonious Ground-Breaking Ceremony for Scharnitz Bypass
World of PORR 167/2015 PORR Updates Ceremonious ground-breaking ceremony for Scharnitz bypass From left to right: Michael Pichler (TEERAG-ASDAG), Günter Guglberger (Tunnel and Bridge Construction Section), Herbert Winderl and Werner Huber (Innsbruck's building authority), Christian Molzer (Department of Traffic and Roads), Deputy Governor Josef Geisler, Mayor Isabella Blaha, Thomas Schnabl (Gebr. Haider), Markus Morianz (Marti). Image: PORR AG On 24 October 2015, Mayor Isabella Blaha, Deputy Governor Josef Geisler and Christian Molzer, Head of the Department of Traffic and Roads, have given the starting signal for construction work on Scharnitz bypass with the ground- breaking ceremony. The bypass branches off the B177 south of its entrance into the town of Scharnitz, runs over the Gießenbach, past the sports field and into the Porta Claudia Tunnel. After 100 m of running above ground, the road reconnects to the existing Seefelder Straße B177 via a new bridge crossing the Isar River directly at the border with Bavaria. "Once the Scharnitz bypass has been completed, only a fourth of the traffic load we see today will roll through the town centre. This project yields a sustainable improvement of the quality of living as well as huge opportunities for the rural and touristic development of Scharnitz," Deputy Governor and Roadworks Officer Josef Geisler said in the framework of the bypass' celebratory ground-breaking ceremony. At construction costs of EUR 34 million, Scharnitz bypass currently represents the province's largest road construction project and is being implemented by a consortium consisting of Marti Tunnelbau GmbH, Gebrüder Haider Erdbau and TEERAG-ASDAG Tyrol providing technical leadership. -
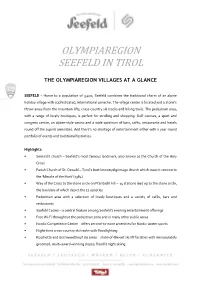
Olympiaregion Seefeld in Tirol
OLYMPIAREGION SEEFELD IN TIROL THE OLYMPIAREGION VILLAGES AT A GLANCE SEEFELD – Home to a population of 3,400, Seefeld combines the traditional charm of an alpine holiday village with sophisticated, international panache. The village centre is located just a stone’s throw away from the mountain lifts, cross-country ski tracks and hiking trails. The pedestrian area, with a range of lovely boutiques, is perfect for strolling and shopping. Golf courses, a sport and congress centre, an alpine-style casino and a wide spectrum of bars, cafés, restaurants and hotels round off the superb amenities. And there’s no shortage of entertainment either with a year-round portfolio of events and traditional festivities. Highlights: • Seekirchl church – Seefeld’s most famous landmark, also known as the Church of the Holy Cross • Parish Church of St. Oswald – Tyrol’s best known pilgrimage church which owes it renown to the ‘Miracle of the Host’ (1384) • Way of the Cross to the stone circle on Pfarrbichl hill – 14 stations lead up to the stone circle, the boulders of which depict the 12 apostles • Pedestrian area with a selection of lovely boutiques and a variety of cafés, bars and restaurants • Seefeld Casino – a central feature among Seefeld’s evening entertainment offerings • Free Wi-Fi throughout the pedestrian zone and in many other public areas • Nordic Competence Centre – offers second-to-none amenities for Nordic winter sports • Night-time cross-country ski tracks with floodlighting • Rosshütte and Gschwandtkopf ski areas – state-of-the-art ski lift