Das Japanische Haiku in Deutscher Ubersetzung
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
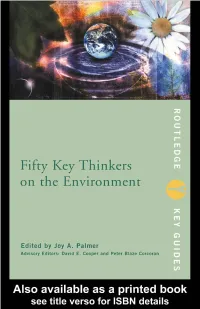
Fifty Key Thinkers on the Environment
FIFTY KEY THINKERS ON THE ENVIRONMENT Fifty Key Thinkers on the Environment is a unique guide to environmental thinking through the ages. Joy A.Palmer, herself an important and prolific author on environmental matters, has assembled a team of thirty-five expert contributors to summarize and analyse the thinking of fifty diverse and stimulating figures—from all over the world and from ancient times to the present day. Among those included are: • philosophers such as Rousseau, Spinoza and Heidegger • activists such as Chico Mendes • literary giants such as Virgil, Goethe and Wordsworth • major religious and spiritual figures such as Buddha and St Francis of Assissi Lucid, scholarly and informative, these fifty essays offer a fascinating overview of mankind’s view and understanding of the physical world. Joy A.Palmer is Professor of Education and Pro-Vice-Chancellor at the University of Durham. She is Director of the Centre for Research on Environmental Thinking and Awareness at the University of Durham, Vice- President of the National Association for Environmental Education, and a member of the IUCN Commission on Education and Communication. She is the author and editor of numerous books and articles on environmental issues and environmental education. Advisory Editors: David E.Cooper, University of Durham, and Peter Blaze Corcoran, Florida Gulf Coast University. ROUTLEDGE KEY GUIDES Ancient History: Key Themes and Approaches Neville Morley Cinema Studies: The Key Concepts (second edition) Susan Hayward Eastern Philosophy: Key Readings -

Seminararbeit: Qmet
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OTHES MAGISTERARBEIT Titel der Magisterarbeit Das zeitgenössische deutschsprachige Haiku: Imitation oder eigenständige Dichtung? Analyse eines Kulturtransfers Verfasserin Karin Dögl Bakk. phil. angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosophie (Mag. phil.) Wien, 2011 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 066 843 Studienrichtung lt. Studienblatt: Magisterstudium Japanologie Betreuerin: Dr. Ingrid Getreuer-Kargl, Ao. Univ. Prof. - - 2 Ich möchte mich bei Eveline Dögl, Lennart-Pascal Hruška, Georges Hartmann, Dietmar Tauchner und meiner Betreuerin Frau Prof. Ingrid Getreuer-Kargl für ihre unermüdliche Unterstützung und aufmunternden Worte herzlich bedanken. かたつむり そろそろ登れ 富士の山 (小林一茶) - - 3 Inhaltsverzeichnis Technische Hinweise .................................................................................................................. 5 Abkürzungsverzeichnis .............................................................................................................. 5 Verzeichnis japanischer Ausdrücke ........................................................................................... 5 1 Einleitung .......................................................................................................................... 8 2 Problemstellung .............................................................................................................. 11 2.1 Die Theorie des Kulturtransfers ................................................................................ -

Cantos: a Literary and Arts Journal
Cantos: A Literary and Arts Journal EDITOR John J. Han ASSISTANT EDITOR Ashley Anthony EDITORIAL ASSISTANTS Mary C. Bagley Sara Choate Mary Ellen Fuquay Rachel Hayes Douglas T. Morris COVER ART (“Magnolia”) COVER DESIGN Carol Sue Horstman Jenny Gravatt Cantos: A Literary and Arts Journal is published every April by the Department of English at Missouri Baptist University. It is designed to provide writers and poets with a venue for their artistic expressions and to promote literary awareness among scholars and students. The views expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily represent those of Missouri Baptist University. Compensation for contributions is one copy of Cantos. Copyrights revert to authors and artists upon publication. SUBMISSIONS: Cantos welcomes submissions from the students, faculty, staff, alumni, and friends of Missouri Baptist University. Send previously unpublished manuscripts as e-mail attachments (Microsoft Word format) to the editor at [email protected] by March 1 each year. However, earlier submissions receive priority consideration. Poems should consist of 40 or fewer lines; limit up to five poems per submission. Prose submissions must be less than 2000 words; we consider up to three works from each author. We do not accept simultaneous submissions. By submitting, you certify that the work is your own and is not being considered elsewhere. Accepted manuscripts are subject to editing for length, clarity, grammar, usage, conciseness, and appropriate language. Along with your work, please submit a 50-100 word biographical sketch in third-person narrative. SUBSCRIPTIONS & BOOKS FOR REVIEW: Cantos subscriptions, renewals, address changes, and books for review should be mailed to John J. -

3Ce70fcf2def46fef69305cd567fb
REDISCOVERING BASHO ■i M ft . ■ I M S 0 N ;V is? : v> V,•• I 8 C: - :-4 5 1k: ; fly j i- -i-h. • j r-v?-- m &;.*! .! * sg ‘Matsuo Basho’ (Basho-o Gazo) painting by Ogawa Haritsu (1663-1747) (Wascda University Library, Tokyo) REDISCOVERING BASHO A 300TH ANNIVERSARY CELEBRATION f,:>; TED BY r.N HENRY GILL ' IDREW GERSTLE GLOBAL ORIENTAL REDISCOVERING BASHO A 300TH ANNIVERSARY CELEBRATION Edited by Stephen Henry Gill C. Andrew Gcrstlc First published 1999 by GLOBAL ORIENTAL PO Box 219 Folkestone Kent CT20 3LZ Global Oriental is an imprint of Global Boohs Ltd © 1999 GLOBAL BOOKS LTD ISBN 1-901903-15-X All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing from the Publishers, except for the use of short extracts in criticism. British Library Cataloguing in Publication Data A CIP catalogue entry for this book is available from the British Library Set in Bembo llpt by Bookman, Hayes, Middlesex Printed and bound in England by Bookcraft Ltd., Midsomer Norton, Avon Contents List of Contributors vii 1. Introduction - Shepherd’s Purse: A Weed for Basho 1 STEPHEN HENRY GILL 2. An Offering of Tea 13 MICHAEL BIRCH ; o and I: The Significance of Basho 300 Years after 16 his Death . - 'NEHIKO HOSHINO 4. ■ seiuation of Basho in the Arts & Media 24 : C HEN HENRY GILL 5. ri : ao has been Found: His Influence on Modem 52 Japanese Poetry VlIROFUMI WADA 6. Laughter in Japanese Haiku 63 NOBUYUKI YUASA 7. -

Biblio:Basho-27S-Haiku.Pdf
Published by State University of New York Press, Albany © 2004 State University of New York All rights reserved Printed in the United States of America No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission. No part of this book may be stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means including electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior permission in writing of the publisher. For information, address State University of New York Press, 90 State Street, Suite 700, Albany, NY 12207 Production by Kelli Williams Marketing by Michael Campochiaro Library of Congress Cataloging in Publication Data Matsuo Basho¯, 1644–1694. [Poems. English. Selections] Basho¯’s haiku : selected poems by Matsuo Basho¯ / translated by David Landis Barnhill. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-7914-6165-3 — 0-7914-6166-1 1. Haiku—Translations into English. 2. Japanese poetry—Edo period, 1600–1868—Translations into English. I. Barnhill, David Landis. II. Title. PL794.4.A227 2004 891.6’132—dc22 2004005954 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Basho¯’s Haiku Selected Poems by Matsuo Basho¯ Matsuo Basho¯ Translated by, annotated, and with an Introduction by David Landis Barnhill STATE UNIVERSITY OF NEW YORK PRESS for Phyllis Jean Schuit spruce fir trail up through endless mist into White Pass sky Contents Preface ix Selected Chronology of the Life of Matsuo Basho¯ xi Introduction: The Haiku Poetry of Matsuo Basho¯ 1 Translation of the Hokku 19 Notes 155 Major Nature Images in Basho¯’s Hokku 269 Glossary 279 Bibliography 283 Index to Basho¯’s Hokku in Translation 287 Index to Basho¯’s Hokku in Japanese 311 Index of Names 329 vii Preface “You know, Basho¯ is almost too appealing.” I remember this remark, made quietly, offhand, during a graduate seminar on haiku poetry. -

Revue Du Tanka Francophone N°13
REVUE DU TANKA FRANCOPHONE N°13 Table des matières Présentation Le mot du Directeur........................................................................6 Section 1 Histoire et évolution du tanka..........................................................9 Jane Reichhold et le tanka : 30 ans d’histoire. Adaptation de l’anglais : Janick Belleau................................................................................ 10 Le mot pivot dans le tanka, par Patrick Simon................................17 Gradus ad Mont Tsukuba : une Introduction à la Culture du Vers Lié au Japon, par H. Mack Horton.......................................................25 Section 2 .................................................................................. 67 Principes du tanka..........................................................................68 Tanka de poètes contemporains Sélection de 11 tanka sur 100 reçus................................................71 Greg Ashbow, Patrick Druart, Huguette Ducharme, Julien Gargani, Vincent Hoarau, Yann Redor, Pascal Serpolet, Patrick Simon, Jean Vegmann Pour nos amis au Japon...................................................................74 Section 3 Renga / tan renga / haïbun...........................................77 Le hareng saur, Rengoum par Luce Pelletier et Jean-Claude Nonnet..........................................................................................78 Section 4 : Présentation de livres et d’auteurs............................ 83 Tanka zen d’hier et d’aujourd’hui , Conception -

Books in Foreign Languages: in Alphabetical Order According to Author As of 2019/12/15
Books in Foreign Languages: in alphabetical order according to author as of 2019/12/15 Autor / Editor Title Publisher Year Place ID No. Aafjes, Bertus Rechter Ooka-mysteries Meulenhoff 1982 Amsterdam, A-6-1 Netherlands Abbasi, Saeed My Haiku Studio Abbasi 2012 Toronto, A-34-1 Canada Abid, Asghar Pandh (Advice in English) Pakistan T.V. ? Islamabad, A-14-1 Centre Pakistan A-Bomb Memorial Day Haiku Haiku Meeting, The: 33rd A.D.M.Haiku 1999 Kyoto, Japan A-23-1 Meeting (ed.) Organization Committee A-Bomb Memorial Day Haiku Haiku Meeting, The: 34th A.D.M.Haiku 2000 Kyoto, Japan A-23-2 Meeting (ed.) Organization Committee A-Bomb Memorial Day Haiku Haiku Meeting, The: 36th A.D.M.Haiku 2002 Kyoto, Japan A-23-3 Meeting (ed.) Organization Committee A-Bomb Memorial Day Haiku Haiku Meeting, The: 40th A.D.M.Haiku 2006 Kyoto, Japan A-23-4 Meeting (ed.) Organization Committee A-Bomb Memorial Day Haiku Haiku Meeting, The: 41st A.D.M.Haiku 2007 Kyoto, Japan A-23-5 Meeting (ed.) Organization Committee Addis, Stephen Haiga: Takebe Socho and the Haiku- Marsh Art Gallery 1995 Honolulu, HI, A-15-2*Z Painting Tradition U.S.A. Addis, Stephen Haiku Garden, A: The Four Seasons in Weatherhill 1999 New York, A-15-3 Poems and Prints NY, U.S.A. Addis, Stephen Haiku Menagerie, A : Living Creatures in Weatherhill 1992 New York, A-15-1 Poems and Prints NY, U.S.A. Addiss, Stephen cloud calligraphy Red Moon Press 2010 Winchester, A-15-5*S VA, U.S.A. -

Matsuo ■ Basho
; : TWAYNE'S WORLD AUTHORS SERIES A SURVEY OF THE WORLD'S LITERATURE ! MATSUO ■ BASHO MAKOTO UEDA JAPAN MATSUO BASHO by MAKOTO UEDA The particular value of this study of Matsuo Basho is obvious: this is the first book in English that gives a comprehen sive view of the famed Japanese poet’s works. Since the Japanese haiku was en thusiastically received by the Imagists early in this century, Basho has gained a world-wide recognition as the foremost writer in that miniature verse form; he is now regarded as a poet of the highest cali ber in world literature. Yet there has been no extensive study of Basho in Eng lish, and consequently he has remained a rather remote, mystical figure in the minds of those who do not read Japanese. This book examines Basho not only as a haiku poet but as a critic, essayist and linked-verse writer; it brings to light the whole range of his literary achievements that have been unknown to most readers in the West. * . 0S2 VS m £ ■ ■y. I.. Is:< i , • ...' V*-, His. -.« ■ •. '■■ m- m mmm t f ■ ■ m m m^i |«|mm mmimM plf^Masstfa m*5 si v- mmm J 1 V ^ K-rZi—- TWAYNE’S WORLD AUTHORS SERIES A Survey of the World's Literature Sylvia E. Bowman, Indiana University GENERAL EDITOR JAPAN Roy B. Teele, The University of Texas EDITOR Matsuo Basho (TWAS 102) TWAYNES WORLD AUTHORS SERIES (TWAS) The purpose of TWAS is to survey the major writers — novelists, dramatists, historians, poets, philosophers, and critics—of the nations of the world. -

Metamorphosis Haiku of Basho Magnolia Seitan Pubs
Issue 1 July 2009 price: free (as in beer) Metamorphosis Haiku of Basho Magnolia Seitan Pubs Also in this issue: Does science really exist? Infant cannibalism recipes on a budget Crossword Clinton on hunting with hounds Is Swine Flu a cover for the REPTILIAN AGENDA? So this article's got the word "fuck" in it, what the fuck are you going to do about it? 2 The Rationalia Magazine Team Editor: Pappa Contributors: Clinton Huxley, Dasein, FrigidSymphony, Meekychuppet, Ryokan, Xamonas Chegwé Conspirators: bornagainatheist, Charlou, DP Layout and Design: Pappa No part of this magazine may be reproduced without the explicit written permission of Rationalia Association. The articles remain the intellectual property of their respective authors. Stick that in your pipe and smoke it! Advertisement: Bible Opoly One of the most popular Christian games of all time! BIBLEOPOLY has very unique game play. The object of the game is to be the first player to build a church in one of the Bible cities. In BIBLEOPOLY, you can't win by destroying your opponents. You will only win by assisting the fellow players. Cooperation is what allows you to gain the things necessary to build your church and be a winner. Go Jesus!!! 3 Editorial Features Why don't politicians just fuck off? On Love and Barley Haiku of Basho.................. 4 We've all got them; town and county Pubs................................................................... 14 councillors, mayors, commissioners, MPs, Analysis: Metamorphosis....................................17 senators, prime ministers, presidents, Under Magnolia's Shade.................................... 19 dictators... our lives are ruled and run by them, often at a distant level, but every day our Fiction: Quorp's Tableau.................................... -

View Digital Version
juxtafour Research and Scholarship in Haiku 2018 The Haiku Foundation 1 JUXTAPOSITIONS 1.1 juxtafour ISBN 978-0-9826951-5-9 Copyright © 2018 by The Haiku Foundation JUXTAfour is the print version of Juxtapositions 4.1. A journal of haiku research and scholarship, Juxtapositions is published by The Haiku Foundation. The Haiku Foundation PO Box 2461 Winchester VA 22604-1661 USA www.thehaikufoundation.org/juxta Senior Editor Peter McDonald General Editors Stephen Addiss Randy M. Brooks Bill Cooper Ce Rosenow Review Editor Ce Rosenow Haiga Editor Stephen Addiss Managing Editor Jim Kacian Technical Manager Dave Russo Proofreader Shrikaanth Krishnamurthy 2 Contents Editor’s Welcome . Peter McDonald … 5 Haiga: “leaves” . Marlene Mountain … 7 The Pig and the Boar . Clayton Beach … 9 Haiga: “winter” . Marlene Mountain … 53 Sonia Sanchez’s ‘magic/now’ . Meta L. Schettler … 55 Haiga: “leave my trees” . Marlene Mountain … 73 The Postdomestic Woman . Joshua Gage … 75 Haiga: “are we enough?” . Marlene Mountain … 89 Texts within Texts . Richard Tice … 91 Haiga: “a thin line” . Marlene Mountain … 109 Matter and Method . Donald Eulert … 111 Haiga: “rain forest” . Marlene Mountain … 131 Review: East-West Literary Imagination . Tiffany Austin … 133 Review: African-American Haiku . Joshua Gage … 137 Review: Sonia Sanchez’s Poetic Spirit through Haiku . Joshua Gage … 143 Review: Haiku Before Haiku . Michael Dylan Welch … 149 Review: The River of Heaven . Michael Dylan Welch … 157 Haiga: “frog” . Marlene Mountain … 169 Juxta Haiga . Stephen Addiss … 171 Juxta Contributors . 173 Juxta Staff . 175 Haiga: “a hawk circles” . Marlene Mountain … 177 3 JUXTAPOSITIONS 1.1 4 Editor’s Welcome We are proud to partner with The Haiku Foundation in presenting Juxtapositions 4 in this, our fourth year of providing a scholarly outlet for haiku research. -

Download This PDF File
Studi di estetica, anno XLVIII, IV serie, 2/2020 Sensibilia ISSN 0585-4733, ISSN digitale 1825-8646, DOI 10.7413/18258646129 Lorenzo Marinucci Hibiki and nioi A study of resonance in Japanese aesthetics Abstract In this article I will attempt a definition of “resonance”: first reflecting about it in general terms and then trying to address its role in Japanese aesthetics, in partic- ular poetics. While far from being limited to East Asian aesthetic expressions, I will show how the experience of “resonance” has played a comparatively more central role in this cultural context, shaping peculiar forms of poetry. It is therefore useful to observe non-European sources, if only to understand our hidden cultural as- sumptions before this kind of phenomenon and suspend our prejudices more effec- tively in examining it. After examining the use of atmospheric resonance in waka and in renga I will focus on haikai 俳諧 poetics and on the notions of hibiki 響き (echo) and nioi 匂い (scent) in the theoretical discussions on poetry among Matsuo Bashō 松尾芭蕉 (1844-1894) and his disciples. Keywords Resonance, Synesthesia, Japanese poetry Received: 10/04/2020 Approved: 10/06/2020 Editing by: Giulio Piatti © 2020 The Author. Open Access published under the terms of the CC-BY-4.0. [email protected] 119 Lorenzo Marinucci, Hibiki and Nioi 1. Resonance How do we define “resonance”? A first safe assumption is declaring that resonances are phenomena. A resonance is not, however, a single, isolated phenomenon: in order for a resonance to occur, it is necessary for two elements, two noemata, to be both present in our consciousness. -

Basho's Haikus
Basho¯’s Haiku Basho¯’s Haiku Selected Poems by Matsuo Basho¯ Matsuo Basho¯ Translated by, annotated, and with an Introduction by David Landis Barnhill STATE UNIVERSITY OF NEW YORK PRESS Published by State University of New York Press, Albany © 2004 State University of New York All rights reserved Printed in the United States of America No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission. No part of this book may be stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means including electronic, electrostatic, magnetic tape, mechanical, photocopying, recording, or otherwise without the prior permission in writing of the publisher. For information, address State University of New York Press, 90 State Street, Suite 700, Albany, NY 12207 Production by Kelli Williams Marketing by Michael Campochiaro Library of Congress Cataloging in Publication Data Matsuo Basho¯, 1644–1694. [Poems. English. Selections] Basho¯’s haiku : selected poems by Matsuo Basho¯ / translated by David Landis Barnhill. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-7914-6165-3 — 0-7914-6166-1 1. Haiku—Translations into English. 2. Japanese poetry—Edo period, 1600–1868—Translations into English. I. Barnhill, David Landis. II. Title. PL794.4.A227 2004 891.6’132—dc22 2004005954 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 for Phyllis Jean Schuit spruce fir trail up through endless mist into White Pass sky Contents Preface ix Selected Chronology of the Life of Matsuo Basho¯ xi Introduction: The Haiku Poetry of Matsuo Basho¯ 1 Translation of the Hokku 19 Notes 155 Major Nature Images in Basho¯’s Hokku 269 Glossary 279 Bibliography 283 Index to Basho¯’s Hokku in Translation 287 Index to Basho¯’s Hokku in Japanese 311 Index of Names 329 vii Preface “You know, Basho¯ is almost too appealing.” I remember this remark, made quietly, offhand, during a graduate seminar on haiku poetry.