17 Oberes Westerzgebirge (OWEG)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Saxony: Landscapes/Rivers and Lakes/Climate
Freistaat Sachsen State Chancellery Message and Greeting ................................................................................................................................................. 2 State and People Delightful Saxony: Landscapes/Rivers and Lakes/Climate ......................................................................................... 5 The Saxons – A people unto themselves: Spatial distribution/Population structure/Religion .......................... 7 The Sorbs – Much more than folklore ............................................................................................................ 11 Then and Now Saxony makes history: From early days to the modern era ..................................................................................... 13 Tabular Overview ........................................................................................................................................................ 17 Constitution and Legislature Saxony in fine constitutional shape: Saxony as Free State/Constitution/Coat of arms/Flag/Anthem ....................... 21 Saxony’s strong forces: State assembly/Political parties/Associations/Civic commitment ..................................... 23 Administrations and Politics Saxony’s lean administration: Prime minister, ministries/State administration/ State budget/Local government/E-government/Simplification of the law ............................................................................... 29 Saxony in Europe and in the world: Federalism/Europe/International -

Staatsbetrieb Sachsenforst Forstbezirk Eibenstock
Staatsbetrieb Sachsenforst Forstbezirk Eibenstock n Johanngeorgenstadt (01) n Antonsthal (02) n Conradswiese (03) n Bockau (04) n Sosa (05) n Wildenthal (06) n Eibenstock (07) n Hundshübel (08) n Schönheide (09) n Carlsfeld (10) n Grünheide (11) n Aue (12) n Schneeberg (13) Informationen des Forstbezirkes Eibenstock Regionale Zuständigkeiten und Leistungsangebote für unsere Waldbesitzer Mit dem Vollzug der Verwaltungsreform zum Unsere Leistungsangebote: 01. 08. 2008 wurden die Zuständigkeiten zum Vollzug des Sächsischen Waldgesetzes und die kostenfreie und unabhängige fachliche Be- damit verbundenen Aufgaben teilweise neu ratung zu allen Fragen der Waldbewirtschaf- zugeordnet. tung, z. B.: praktische Durchführung der Waldpflege, Die untere Forstbehörde des Erzgebirgskreises Holzernte und Verjüngung einschließlich In- übernimmt die hoheitlichen Aufgaben, die mit formationen zu Fördermöglichkeiten dem Vollzug des Sächsischen Waldgesetzes Maßnahmen bei Waldschäden wie Schnee- und der Durchsetzung seiner Bestimmungen bruch oder Borkenkäferbefall verbunden sind. Walderschließung, Beachtung des Natur- schutzes bei der Waldbewirtschaftung Die Forstbezirke des Staatsbetriebes Sachsen- forst nehmen weiterhin die Aufgaben der Angebot von Betreuungsleistung bei der fachlichen Beratung und Betreuung der nicht- Durchführung von Wirtschaftsmaßnahmen staatlichen Waldbesitzer wahr und es ist uns in Ihrem Wald gegen Entgelt, z. B.: wichtig, Ihnen unsere Leistungen anzubieten Auszeichnen von Beständen und Ihnen Ihre regionalen Ansprechpartner im Überwachen -

Sosa, Weitersglashütte, Wildenthal Und Wolfsgrün Eibenstock Erste Baumaßnahmen Beginnen
Nr. 09 5. Mai 2017 26. Jahrgang Amtsblatt der Stadt Eibenstock mit ihren Ortsteilen Blauenthal, Carlsfeld, Neidhardtsthal, Oberwildenthal, Sosa, Weitersglashütte, Wildenthal und Wolfsgrün Eibenstock Erste Baumaßnahmen beginnen Auch wenn der Bewilligungsstand bei der Förderung der für dieses Jahr im Haushalt geplanten Baumaßnahmen noch nicht sehr groß ist, so können doch die ersten Baumaßnahmen beginnen. Im Weg zur Handlung hat der Zweckverband Wasserwerke Westerzgebirge mit der Verlegung des Abwasserkanals begonnen. Bei die- ser Maßnahme handelt es sich um ein koordiniertes Projekt mit der Stadt Eibenstock. Nach Abschluss Blauenthal der Kanalbauarbeiten möchte die Stadt dann die Straßendecke grundhaft ausbauen. Der Förderbescheid liegt aber noch nicht vor. Mit der Vergabe des Straßenbauvorhabens „An der Vodelstraße“ startet die Stadt das einzige bisher bewilligte Straßenbauvorhaben. Die Baumaßnahmen werden hierzu in der 2. Maihälfte beginnen. Beeinträchtigungen für den städtischen Verkehr sind aufgrund des Nebenstraßencharakters bei- der Straßen nicht zu erwarten. Für Anlieger wird eine Zufahrt teilweise nicht möglich sein, da nur ein eng begrenzter Verkehrsraum zur Verfügung steht. Hierzu Carlsfeld bitten wir bereits jetzt um Verständnis. Sosa Wildenthal Fortsetzung S. 4 Seite 2 – 09/2017 Auersbergbote Amtliche Bekanntmachung - 7,5 % wünschen eine intensivere Bachbett- bzw. “Brief aus dem Rathaus” Bachmauerreinigung. Auswertung der Umfrage zur Alle weiteren sonstigen Hinweise lagen bezüglich des jeweiligen Straßenreinigungssatzung der Stadt Eibenstock Themas deutlich unter 5 %. So wurde u. a. der Zustand der Spiel-, Bolz- und Sportplätze kritisiert. Ein weiterer deutlich hervorge- Im vergangenen Jahr haben wir mit einer Postwurfaktion tretener Schwerpunkt ist das zu lasche Vorgehen der Stadt gegen eine Befragung unter den Haushalten der Stadt Eibenstock die Hinterlassenschaften von Bürgern in öffentlichen Anlagen zur Neugestaltung der Straßenreinigungssatzung bzw. -

Pre-Conference Fieldtrip: Rift-Flank Volcanism in the Krušné Hory/Erzgebirge Mts
ABSTRACTS & EXCURSION GUIDES 18th to 22nd September 2017 / Kadaň / Czech Republic Basalt2017 Pre-conference fieldtrip: rift-flank volcanism in the Krušné hory/Erzgebirge Mts. area Vladislav Rapprich1, Peter Suhr2, Tomáš Magna1, Zoltán Pécskay3 1 Czech Geological Survey, Klárov 3, 118 21 Prague, Czech Republic 2 Senckenberg, Dresden 3 Institute of Nuclear Research, Hungarian Academy of Sciences, Bem tér 18/C, H-4001 Debrecen, Hungary The Basalt2017 pre-conference field trip focuses on rift-flank volcanism exposed on the northern uplifted rift-shoulder, known as Krušné hory / Erzgebirge Mts. This excursion will lead us to two volcanoes on the edge of the uplifted rift-flank and two other volcanoes within the rift (fig. 1). During the field-trip, various volcanic rocks and volcaniclastic deposits will be observed demonstrating distinct settings on rift-flank and within the rift basins. Fig. 1. Schematic sketch map of the pre-conference field-trip drive. 63 ABSTRACTS & EXCURSION GUIDES 18th to 22nd September 2017 / Kadaň / Czech Republic Locality 1 Hammerunterwiesenthal, a maar-diatreme volcano with younger intrusions of phonolite and tephrite The maar of “Hammerunterwiesenthal” is a compound monogenetic volcano (Kurszlaukis and Barnett, 2003) of Early Oligocene age located in the border region of Germany and the Czech Republic, in the so-called “Sächsisches Erzgebirge” (Saxonian Ore Mountains; Suhr and Goth, 1996). The Erzgebirge is a Hercynian folded and metamorphosed basement block, which consists of para- and orthogneisses, mica schists, amphibolites, phyllites, marbles and Permo–Carboniferous granites and rhyolites. In the Tertiary, a number of smaller volcanic eruptions occurred in this area. They are connected with the extensive volcanic activity in the Eger / Ohře rift southeast of the Erzgebirge Mts. -

Mai Bis Juni / Kräuterzeit Im Erzgebirge
Mai & Kräuterzeit im Erzgebirge Juni Erzgebirgische Kräuter gehören seit jeher zur regionalen Küche. Seit Jahrhunderten von den Erzgebirgern als preisgünstige, dennoch unverzichtbare Zutat der regionalen Küche geschätzt, gibt die würzige Kräutervielfalt den regionalen Spezialitäten ihr besonderes Aroma. Auch für mancherlei Heilanwendung sind auf den artenreichen Bergwiesen des Erzgebirges heilsame Kräuter zu finden. Auf wunderbare Weise entfalten die frischen Kräuter ihren Duft und Würze durch gesunde ätherische Öle und verleihen den Speisen einen herrlich abwechslungsreichen Geschmack. 50 KRÄUTERZEIT IM ERZGEBIRGE MAI & JUNI Ein wahres Fest für die Sinne, denn neben kulinarischen Leckerbissen erwarten die Gäste zur Kräuterzeit besondere Angebote rund um die Pflanzenwelt wie Massagen mit duftenden Kräuterölen, Schaudestillationen und spannende Wanderungen mit kundigen Kräuterfrauen! LÖWENZAHNSALAT 600 g Blätter 200 g Frühstücksspeck in Scheiben 2 kleine Zwiebeln 7 EL Weißwein Essig 4 EL Öl, Salz, Pfeffer Speck anbraten, mit Essig ablö- schen, Öl unterrühren und würzen. Tipp von der Semmelmilda, Schellerhau MAI & JUNI KRÄUTERZEIT IM ERZGEBIRGE 51 Kräuterregion Erzgebirge Der Duft von Heu und blühenden Bergwiesen liegt in der Luft. Das Kochen und Backen mit Kräuter und Wildkräuter, die auf saftigen Bergwiesen, an unscheinbaren Wegesrändern und in liebevoll gepflegten Gärten wachsen und gedeihen, liegen in den Monaten Mai und Juni absolut im Trend. Frische Kräuter geben vielen Gerichten erst den letzten Kick. Ihr tolles Aroma und die wertvollen -

Saxon Raw Material Strategy the Raw Material Economy – an Opportunity for the Free State of Saxony Contents
Saxon Raw Material Strategy The raw material economy – An opportunity for the Free State of Saxony Contents 1. Foreword __________________________________________________________________________________________________ 04 2. Raw materials critical for industry ______________________________________________________________________________ 06 2.1 Raw material mining in the economic value chain __________________________________________________________________ 08 2.2 Developing available raw materials _____________________________________________________________________________ 09 3. Federal and EU strategies (European and national framework conditions) ________________________________________________ 10 4. Raw materials in Saxony ______________________________________________________________________________________ 11 4.1 Local raw materials _________________________________________________________________________________________ 11 4.2 Lignite ____________________________________________________________________________________________________ 12 4.3 Pit & quarry natural resources _________________________________________________________________________________ 13 4.4 Ore and spar _______________________________________________________________________________________________ 14 4.5 Secondary raw materials – reclamation potential ___________________________________________________________________ 17 4.5.1 Availability and potential for substitution ________________________________________________________________ 18 4.5.2 Improving the knowledge -
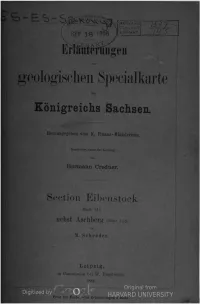
SECTION EIBENSTOCK Nebst ASCHBERG
Original fram Digitized by Go gle HARVARD UNIVERSITY SECTION EIBENSTOCK nebst ASCHBERG. Section Eibenstock gehört den höchstgelegenen Theilen des sächsischen Erzgebirges und Vogtlandes, und zwar dem Eibenstocker Granitgebiete an. Nur ungefähr ein Zehntel ihrer Oberfläche wird von Schollen der dem Granite aufgelagerten , contactmetamorphisch veränderten Phyllitformation gebildet. Andererseits ist der Granit Iocal von zum Theil weit ausgedehnten recenten Gebilden, unter diesen namentlich von Torfmooren überzogen, durch welche jedoch der granitische Untergrund gewissermassen durchschimmert. Endlich wird der Granit noch von einigen wenigen Eruptivgängen, sowie von einer grossen Zahl Secretionsgängen der Eisen- und Zinnerz formation durchsetzt. Quer durch die Nordwestecke der Section Eibenstock zieht sich das ErosionsthaI der Zwickauer l\Iulde, welcher sämmt• liehe Gewässer der Section in ungefähr nach NNO. gerichtetem Laufe zufliessen. V orzüglich in ihren unteren Strecken sind diese Nebenthäler scharf ausgeprägt und tief eingeschnitten, während sie sich an ihren oberen Enden zu flachen Mulden ausbreiten und in der Nähe des ungefähr der Mulde parallel streichenden Erzgebirgs rückens als weite moorige Einsenkungen endigen. Durch diese ein ander fast parallelen Nebenthäler wird das Granitmassiv in eine Anzahl nordwestlich bis nördlich streichender Rücken gegliedert, welche durch kleine Querthälchen eine weitere Gliederung und Ein sattelung erleiden. So liegt zwischen den Thälem der Sosa und der . kleinen Bockau der Riesenberger Rücken, zwischen letzterer und der 1 Go gle 2 SECTION EIBENSTOCK. grossen Bockau der Auersberger Rücken, zwischen dieser und dem Kohlbach der Ellbogener Rücken, zwischen Kohlbach und Wilzsch das vielgipfelige Brückenberg- und Zeisiggesanger Plateau, und endlich zwischen den Thälern der Wilzsch und grossen Pyra der Rücken des Hirschberges. Diese sämmtlichen Bergziige verschmelzen mit ihren südöstlichen Enden zu dem hier plateauartigen Erzgebirgs kamme, welcher ungefähr parallel mit der Mulde in nordost-süd• westlicher Richtung streicht. -

Ortsverzeichnis Für Die Zuständigkeit Der Gerichtsvollzieher
01.03.2021 Amtsgericht Aue-Bad Schlema mit Zweigstelle Stollberg Ortsverzeichnis für die Zuständigkeit der Gerichtsvollzieher Orte Ortsteil von zuständiger Gerichtsvollzieher Adorf Neukirchen Herr Rauh Affalter Lößnitz Frau Manthey Albernau Zschorlau Frau Manthey Antonshöhe Breitenbrunn Frau Springstein Antonsthal Breitenbrunn Frau Springstein Aue Aue-Bad Schlema siehe Straßenverzeichnis - Anl. 1 Auerbach Herr Rauh Bad Schlema Aue-Bad Schlema Herr Schneider Beierfeld Grünhain-Beierfeld Frau Springstein Bermsgrün Schwarzenberg Frau Springstein Bernsbach Herr Schmiedel Beutha Stollberg Herr Sachs Blauenthal Eibenstock Herr Schmiedel Bockau Herr Schmiedel Breitenbrunn Frau Springstein Brünlos Zwönitz Herr Sachs Burkhardtsdorf Herr Rauh Burkhardtsgrün Zschorlau Frau Manthey Carlsfeld Eibenstock Frau Manthey Crandorf Schwarzenberg Frau Springstein Dittersdorf Lößnitz Frau Manthey Dorfchemnitz Zwönitz Herr Sachs Eibenstock Frau Manthey Erla Schwarzenberg Frau Springstein Erlabrunn Breitenbrunn Frau Springstein Erlbach-Kirchberg Lugau Herr Rauh Gablenz Stollberg Herr Scholz-Bierig Gornsdorf Herr Rauh Grüna Lößnitz Frau Manthey Grünhain Grünhain-Beierfeld Frau Springstein Grünstädtel Schwarzenberg Frau Springstein Günsdorf Zwönitz Herr Sachs Hohndorf Herr Rauh Hormersdorf Zwönitz Herr Sachs Hundshübel Stützengrün Herr Schneider Jägershaus Schwarzenberg Herr Schmiedel Jahnsdorf Herr Scholz-Bierig Johanngeorgenstadt Frau Manthey Kemtau Burkhardtsdorf Herr Rauh Kühnhaide Zwönitz Herr Sachs Langenberg Raschau-Markersbach Frau Springstein Lauter Herr -
Radonvorsorgegebiete in Sachsen Freiberg
Radonvorsorgegebiete in Sachsen Freiberg Zwickau Annaberg- Buchholz Plauen Landkreis Mittelsachsen Augustusburg, Stadt Leubsdorf Bobritzsch-Hilbersdorf Lichtenberg/Erzgeb. Brand-Erbisdorf, Stadt Mulda/Sa. Dorfchemnitz Neuhausen/Erzgeb. Eppendorf Oberschöna Flöha, Stadt Oederan, Stadt Frauenstein, Stadt Rechenberg-Bienenmühle Freiberg, Stadt, Universitätsstadt Sayda, Stadt Großhartmannsdorf Weißenborn/Erzgeb. Halsbrücke Als Radonvorsorgegebiete ausgewiesene Gemeinden Pirna Festlegung von Gebieten nach § 121 Absatz 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz ausgewiesenes Gebiet Gemeindegrenzen erstellt durch: Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft Quelle der Basiskarte: © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN), 2020 Vogtlandkreis Adorf/Vogtl., Stadt Markneukirchen, Stadt Auerbach/Vogtl., Stadt Mühlental Bad Brambach Muldenhammer Bad Elster, Stadt Neustadt/Vogtl. Bergen Rodewisch, Stadt Eichigt Schöneck/Vogtl., Stadt Ellefeld Steinberg Falkenstein/Vogtl., Stadt Theuma Grünbach Treuen, Stadt Klingenthal, Stadt Werda Lengenfeld, Stadt Landkreis Zwickau Crinitzberg Kirchberg, Stadt Hartmannsdorf b. Kirchberg Langenweißbach Hirschfeld Wilkau-Haßlau, Stadt Erzgebirgskreis Amtsberg Königswalde Annaberg-Buchholz, Stadt Lauter-Bernsbach, Stadt Aue-Bad Schlema, Stadt Marienberg, Stadt Auerbach Mildenau Bärenstein Oberwiesenthal, Kurort, Stadt Bockau Olbernhau, Stadt Börnichen/Erzgeb. Pockau-Lengefeld, Stadt Breitenbrunn/Erzgeb. Raschau-Markersbach Burkhardtsdorf Scheibenberg, Stadt Crottendorf Schlettau, Stadt Deutschneudorf -

Freiberg Online Geoscience FOG Is an Electronic Journal Registered Under ISSN 1434-7512
FOG Freiberg Online Geoscience FOG is an electronic journal registered under ISSN 1434-7512 2016, VOL 46 Christoph Breitkreuz and Uwe Kroner (conveners) Workshop on “Late Paleozoic magmatism in the Erzgebirge / Krušné hory: Magma genesis, tectonics, geophysics, and mineral deposits” - Abstracts - 42 pages, 23 contributions Content Preface .......................................................................................................................................................... 3 Vertical evolution of the Cínovec granite cupola – chemical and mineralogical record (Breiter) ............... 4 The Late Paleozoic volcanic centres in Central Europe – What do we know and what we need to know! (Breitkreuz) ................................................................................................................................................... 7 The initial phase of the Late Carboniferous Altenberg-Teplice Volcanic Complex: Volcanosedimentary evolution of the Schönfeld–Altenberg Depression Complex (Breitkreuz et al.) .......................................... 9 Reprocessing of deep seismic reflection profiles from the Erzgebirge / Krušné hory area (Buske et al.) .. 11 Correlating the lithofacies schemes of the Late Paleozoic Teplice Rhyolite, Central-European Variscides (German-Czech border) (Casas-García et al.) ........................................................................................... 13 The exhumation channel of the Erzgebirge: From heat advection to the emplacement of Sn-W enriched granites (Hallas et -

Production Marks of Tin Smelters in the Upper Ore Mountains in the 16Th and 17Th Centuries
Production Marks of Tin Smelters in the Upper Ore Mountains in the 16th and 17th Centuries Vítězslav Bartoš In short, it all started with the Thirty Years' War. Europe was divided into two opposing camps, in the Czech lands people were fleeing from their homes into the forests in order to hide from the mercenaries of the two warring parties, towns and villages were being depopulated in fear of reprisals from the counter-Reformation repression, there were not enough people to carry out the work, and there was not enough food to go around. It was not until 1635, after seventeen years of war, that there was some sort of relief: Ferdinand II, Holy Roman Emperor and King of Bohemia, came to an agreement with Saxony, a former ally of Sweden with whom they were at war. This event is known as the Peace of Prague, to which other German princes and also some of the Hanseatic cities were co-signatories. In the Ore Mountains (Krušné hory/Erzgebirge) there were deposits of precious metals and following the previous downturn in business, after which many miners emigrated from the region in order to avoid catholicisation, there was a great revival in mining activities and especially trading. Bohemian tin was one of the region's main foreign commodities of trade with the whole of Europe, and it was often preferred to the less refined Devonian and Cornish tin and of course the inferior, although cheap, tin of Saxony. Due to its purity (it had an impurity level of less than three parts per thousand), Ore Mountain tin was bought up by German merchants both from Augsburg and Nuremberg for the Rhine region, and from Leipzig and Zwickau, who would use the Elbe as a means of transport. -

Erzgebirge/Krušnohoří Mining Region UNESCO-World Heritage
Erzgebirge/Krušnohoří Mining Region UNESCO-World Heritage Over 800 years of mining I 22 component parts Germany/Czech Republic What makes the Erzgebirge/Krušnohoří Mining Region exceptional in a global context? The UNESCO World Heritage site Erzgebirge/Krušnohoří mining region • provides exceptional examples of the outstanding role and strong global influence of the Saxon-Bohemian Ore Mountains as a centre for technological and scientific innovation that emanated from the region from the Renaissance through to the modern era and subsequently influenced developments in other mining regions; • bears exceptional witness to the technological, scientific, administ- Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V. rative, educational, managerial and social aspects underpinning the c/o Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH intangible dimension of the living traditions, ideas and beliefs of the Adam-Ries-Straße 16 people associated with the culture of the Ore Mountains; 09456 Annaberg-Buchholz Telephone +49 3733 1450 • represents a unique example of a coherent mining landscape that was Fax +49 3733 145145 transformed by mining activities from the 12th to the 20th centuries [email protected] and can still be seen today in the mining towns and the associated mining landscapes. www.montanregion–erzgebirge.de 7 July 2019: Living letters “We are World Heritage”, 24 hours after the inscription on the World Heritage List Table of contents Prefaces .............................................................................................................................................................