Gesamter Protokollband
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

155 Otto Heinrich Von Der Gablentz
ARCHIV FÜR CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE POLITIK DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. 01 – 155 OTTO HEINRICH VON DER GABLENTZ SANKT AUGUSTIN 2017 I Inhaltsverzeichnis 1 Vorträge, Aufsätze, Publikationen 1 1.1 Eigene Manuskripte 1 1.1.1 1921 - 1926 1 1.1.2 1927 - 1942 2 1.1.3 1945 5 1.1.4 1946 5 1.1.5 1947 6 1.1.6 1948 8 1.1.7 1949 11 1.1.8 1950 13 1.1.9 1951 15 1.1.10 1952 16 1.1.11 1953 17 1.1.12 1954 19 1.1.13 1955 22 1.1.14 1956 25 1.1.15 1957 27 1.1.16 1958 29 1.1.17 1959 31 1.1.18 1960 33 1.1.19 1961 34 1.1.20 1962 36 1.1.21 1963 38 1.1.22 1964 41 1.1.23 1965 43 1.1.24 1966 45 1.1.25 1967 46 1.1.26 1968 47 1.2 Vorlesungen 48 1.3 Literaturauszüge 50 1.4 Rezensionen und sonstige Stimmen zu Publikationen von der Gablentz' 51 2 Wirtschaft und Industrie nach dem 2. Weltkrieg 52 2.1 Agrarprobleme 52 2.2 Bodenreform 52 2.3 Demontage und Reparationen 52 2.4 Ernährungslage 53 2.5 Industrieplanung und -verwaltung 53 2.6 Volkswirtschaftlicher Arbeitsrat beim Magistrat der Stadt Berlin 53 2.7 Wirtschaftsplanung 53 2.8 Wirtschaftspolitischer Ausschuß der Arbeitsgemeinschaft CDU/CSU 54 3 Politischer Wiederaufbau nach dem Kriege 55 3.1 Politischer und geistiger Neubeginn 55 3.2 Deutsche Ostgebiete, Vertriebene 55 3.3 Landesverfassungen 56 3.4 Lastenausgleich 56 3.5 Staatliche Gliederung 56 4 CDU-Geschichte, Berliner CDU 57 II Inhaltsverzeichnis 4.1 Gründungs- und Aufbauprobleme 57 4.2 Programme 57 4.3 Christlicher Sozialismus 57 4.4 Bildungs- und Kulturpolitik 58 4.5 Tagungen und Parteitage 58 5 Kirchenfragen 60 5.1 Evangelische Kirche allgemein 60 5.2 -

Complete Protocol
125th Bergedorf Round Table Reinventing Europe – Cultural Dimensions of Widening and Deepening January 24th–26th, 2003, Elb Lounge Hamburg CONTENT Picture Documentation 1 Participants 18 Summary 19 Protocol Welcome 21 I. History and Reality of European Culture 23 II. Tasks of Cultural Policy in the Context of Europe’s Widening and Deepening 59 III. Europe’s Cultural Role in the World 89 Annex Participants 125 “Völkertafel” 132 Recommended Literature 134 Glossary 135 Index 149 Previous Round Tables 154 The Körber-Foundation 173 Acknowledgements, Project Information, Imprint 174 INITIATOR Dr. Kurt A. Körber CHAIR Otto von der Gablentz, Ambassador (ret.), President of Europa Nostra, The Hague SPEAKERS Prof. Dr. Hélène Ahrweiler, Danuta Glondys, President, European University, Paris Director, Villa Decius, Krakow Prof. Dr. Üstün Ergüder, Dr. Ursula Keller, Director, Istanbul Policy Center, Istanbul Director, Literaturhaus Hamburg Monika Griefahn MdB, Dr. Bernhard Maaz, Chairwoman, Parliamentary Cultural Committee, Curator of the Old National Gallery, Berlin Berlin Doris Pack MEP, Prof. Yudhishthir Raj Isar, European Parliament, Strasbourg/Brussels Independent Scholar and Consultant, Paris Prof. Dr. Ugo Perone, Hywel Ceri Jones, Director, Cultural Department of the Italian Embassy, Executive Chairman, European Policy Centre, Brussels Berlin Prof. Dr. Karl Schlögel, Jan Roß, European University Viadrina, Frankfurt/Oder DIE ZEIT, Berlin Dr. Gary Smith, Arne Ruth, Director, American Academy, Berlin Journalist, Sundbyberg Gijs de Vries, Prof. Dr. Johano Strasser, Member of the European Convention, The Hague Author, President, PEN Germany, Berg Dr. Levin von Trott zu Solz, Bergedorf Round Table, Berlin PARTICIPANTS Hortensia Völckers, Director, German Federal Cultural Foundation, Jean-Baptiste Cuzin, Halle/Saale Ministry of Culture and Communication, Paris Gottfried Wagner, Catherine David, Secretary General, European Cultural Foundation, Director, Witte de With, center for contemporary art, Amsterdam Rotterdam Dr. -

1 List of Publications
1 Prof. Dr. Robert Picht List of publications A. Books and editing collective works Europe 2020 : Adapting to a changing world / Otto von der Gablentz ; Dieter Mahncke; Pier Carlo Padoan ; Robert Picht (eds.). College of Europe. - Baden-Baden: Nomos Verl.-Ges., 2000. - 105 S., Lit.Hinw. Education funding in Europe : Vol. 2: A pilot study on innovating education and learning ; The role of foundations and corporate funders / Robert Picht. - Brussels: European Foundation Centre, 1998. - XII,183 S., Reg., Lit. S. 171-175 - (An EFC Orpheus Programme Publication.) Au jardin des malentendus : Le commerce franco-allemand des idées / Textes édités par Jacques Leenhardt et Robert Picht - Nouvelle éd. augmentée et actualisée. - Arles: Actes Sud, 1997. - 634 S. - (Babel) Fremde Freunde : Deutsche und Franzosen vor dem 21. Jahrhundert / Hrsg. von Robert Picht ... Deutsch- Französisches Institut. - München ...: Piper, 1997. - 394 S., Reg. L'identité européenne : Analyses et propositions pour le renforcement d'une Europe pluraliste / Robert Picht (Ed.). Une étude de la Trans European Policy Studies Association. - o.O.: Presses Interuniversitaires Européennes, 1994. - 285 S. - (Multicultural Europe; No 4) European societies between diversity and convergence ; Un séminaire tenu au Collège d'Europe, Bruges, décembre 1992 = Les sociétés européennes entre diversité et convergence / Leonce Bekemans ; Robert Picht (Eds.). Collège d'Europe. - o.O.: Presses Interuniversitaires Européennes, 1993. - 156 S. - (Multicultural Europe; No 3) De Gaulle, Deutschland und Europa / Wilfried Loth ; Robert Picht (Hrsg.). - Opladen: Leske und Budrich, 1991. - 224 S., Lit.Hinw. Au jardin des malentendus : Le commerce franco-allemand des idées / Textes édités par Jacques Leenhardt et Robert Picht. - Arles: Actes Sud, 1990. -

Reinventing Europe – Cultural Dimensions of Widening and Deepening
125th Bergedorf Round Table Reinventing Europe – Cultural Dimensions of Widening and Deepening January 24th–26th, 2003, Elb Lounge Hamburg CONTENT Picture Documentation 1 Participants 18 Summary 19 Protocol Welcome 21 I. History and Reality of European Culture 23 II. Tasks of Cultural Policy in the Context of Europe’s Widening and Deepening 59 III. Europe’s Cultural Role in the World 89 Annex Participants 125 “Völkertafel” 132 Recommended Literature 134 Glossary 135 Index 149 Previous Round Tables 154 The Körber-Foundation 173 Acknowledgements, Project Information, Imprint 174 INITIATOR Dr. Kurt A. Körber CHAIR Otto von der Gablentz, Ambassador (ret.), President of Europa Nostra, The Hague SPEAKERS Prof. Dr. Hélène Ahrweiler, Danuta Glondys, President, European University, Paris Director, Villa Decius, Krakow Prof. Dr. Üstün Ergüder, Dr. Ursula Keller, Director, Istanbul Policy Center, Istanbul Director, Literaturhaus Hamburg Monika Griefahn MdB, Dr. Bernhard Maaz, Chairwoman, Parliamentary Cultural Committee, Curator of the Old National Gallery, Berlin Berlin Doris Pack MEP, Prof. Yudhishthir Raj Isar, European Parliament, Strasbourg/Brussels Independent Scholar and Consultant, Paris Prof. Dr. Ugo Perone, Hywel Ceri Jones, Director, Cultural Department of the Italian Embassy, Executive Chairman, European Policy Centre, Brussels Berlin Prof. Dr. Karl Schlögel, Jan Roß, European University Viadrina, Frankfurt/Oder DIE ZEIT, Berlin Dr. Gary Smith, Arne Ruth, Director, American Academy, Berlin Journalist, Sundbyberg Gijs de Vries, Prof. Dr. Johano Strasser, Member of the European Convention, The Hague Author, President, PEN Germany, Berg Dr. Levin von Trott zu Solz, Bergedorf Round Table, Berlin PARTICIPANTS Hortensia Völckers, Director, German Federal Cultural Foundation, Jean-Baptiste Cuzin, Halle/Saale Ministry of Culture and Communication, Paris Gottfried Wagner, Catherine David, Secretary General, European Cultural Foundation, Director, Witte de With, center for contemporary art, Amsterdam Rotterdam Dr. -

Expertenwissen, Habitus Und Kulturelle Codes Im Machtfeld Der EU
Kerstin Poehls Europa backstage 2009-05-28 15-36-16 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 02cf211418339886|(S. 1 ) T00_01 schmutztitel - 1037.p 211418339894 Kerstin Poehls (Dr. phil.) lehrt am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Ihre inhaltlichen Schwerpunkte sind Eliten- forschung und ihre Methodologie, Performanztheorien sowie die Inszenierung Europas als sozialer und symbolischer Raum in Alltag und Museum. 2009-05-28 15-36-17 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 02cf211418339886|(S. 2 ) T00_02 seite 2 - 1037.p 211418339928 Kerstin Poehls Europa backstage Expertenwissen, Habitus und kulturelle Codes im Machtfeld der EU 2009-05-28 15-36-17 --- Projekt: transcript.titeleien / Dokument: FAX ID 02cf211418339886|(S. 3 ) T00_03 titel - 1037.p 211418339958 Die vorliegende Arbeit wurde am 3. Dezember 2007 vom Dekan der Philoso- phischen Fakultät I der Humboldt-Universität zu Berlin, Prof. Dr. Michael Borgolte, als Dissertation anerkannt. Gefördert vom Evangelischen Studien- werk e.V. Villigst. GutachterInnen: Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba, Prof. Dr. Beate Binder Gedruckt mit Hilfe der Geschwister Boehringer Ingelheim Stiftung für Geis- teswissenschaften in Ingelheim am Rhein, der FAZIT-Stiftung und der Dezen- tralen Frauenbeauftragten der Humboldt-Universität zu Berlin. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deut- schen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © 2009 transcript Verlag, Bielefeld This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License. Umschlaggestaltung: gewerk, Berlin Lektorat & Satz: Kerstin Poehls und Matthias Schöbe Druck: Majuskel Medienproduktion GmbH, Wetzlar ISBN 978-3-8376-1037-6 Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier mit chlorfrei gebleichtem Zellstoff. -

¥ Opmaak Vr PDF 26-02-2002 15:51 Pagina 1
• opmaak vr PDF 26-02-2002 15:51 Pagina 1 COLLEGIUM News of the College of Europe - Nouvelles du Collège d’Europe Collegium n° 22 - XII.2001 Special Edition Proceedings of the Conference Integrated security in Europe, a democratic perspective Bruges, 14 – 17 November 2001 Hosted by The Minister of the Interior, H.E. Antoine Duquesne The Directorate-General Enlargement of the European Union Organised by The European Institute for Law-Enforcement Co-operation and The College of Europe An initiative under the authority of the Belgian EU-Presidency July – December 2001 • opmaak vr PDF 26-02-2002 15:51 Pagina 2 • opmaak vr PDF 26-02-2002 15:51 Pagina 1 Integrated Security in Europe, a democratic perspective, 14-17 Nov. 2001 The responsibility of the views expressed in the Collegium belongs to the authors. Collegium n° 22 - XII.2001 • opmaak vr PDF 26-02-2002 15:51 Pagina 2 Integrated Security in Europe, a democratic perspective, 14-17 Nov. 2001 Collegium n° 22 - XII.2001 • opmaak vr PDF 26-02-2002 15:51 Pagina 3 Integrated Security in Europe, a democratic perspective, 14-17 Nov. 2001 Integrated security in Europe, a democratic perspective Bruges, 14 – 17 November 2001 Hosted by The Minister of the Interior, H.E. Antoine Duquesne The Directorate-General Enlargement of the European Union Organised by The European Institute for Law-Enforcement Co-operation and The College of Europe An initiative under the authority of the Belgian EU-Presidency July – December 2001 Collegium n° 22 - XII.2001 • opmaak vr PDF 26-02-2002 15:51 Pagina 4 Integrated Security in Europe, a democratic perspective, 14-17 Nov. -

'Artistic Explorations in Cultural Memory', Workshop
Artistic Explorations in Cultural Memory Research workshop Faculty of Creative and Performing Arts, Leiden University Scheltema, Leiden, 3-4 November 2006 A Report by dr. Mariangela Lavanga Summary Artistic Explorations in Cultural Memory was a very intensive workshop on the interdependences and interrelations between contemporary creativity and cultural heritage, highlighting emblematic cases of confluence, interaction and mutual reinforcement between them. It explored the mechanisms that can be used to remember, the ways contemporary creativity uses to de-freeze and re-discover memories, to shape and alter cultural memory. The workshop, conceived and conveyed by dr. Dragan Klaic, sought to abridge the gap and compensate for a certain lack of mutual understanding between the professionals engaged in the contemporary creativity and those in the cultural heritage. This potential understanding and collaboration are to be anchored in the discovery and re-construction of a cultural memory that fuses memory sites and memory narratives (Klaic, 2005)1. Cultural heritage – in its material and immaterial forms - does not only need preservation and conservation, it also needs a process of de-freezing (Gottfried Wagner) and re- contextualization which only contemporary creativity could trigger. 1. Introduction Through the centuries and also today cultural heritage has being irrevocably lost; this loss is caused by nature- and time-generated devastation as well as human deeds and neglect. Furthermore, in a context of increasing globalisation and commodification, the immaterial cultural heritage is especially vulnerable and at risk. Immaterial heritage concerns skills and cultural artefacts sustained in memory and thus is prone to fall out of use and disappear through collective amnesia (Klaic, 2005)2. -
St Antony's Record
ST ANTONY’S COLLEGE RECORD 2008 CONTENTS 1 - OVERVIEW OF THE COLLEGE The College ............................................................................................................ 1 The Fellowship ....................................................................................................... 3 The Staff ................................................................................................................. 9 2 - COLLEGE AFFAIRS Warden’s Report ..................................................................................................... 11 From the Bursar ...................................................................................................... 14 The Junior Common Room .................................................................................... 16 The Library ............................................................................................................. 17 St Antony’s/Palgrave Series ................................................................................... 18 3 - SPECIAL ARTICLES Malcolm Deas’s Valedictory.................................................................................... 20 Rosemary Thorp’s Valedictory................................................................................ 25 4 - TEACHING AND RESEARCH Academic Disciplines ............................................................................................. 27 African Studies ...................................................................................................... -
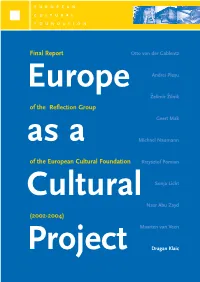
Final Report of the Reflection Group of the European Cultural Foundation (2002-2004)
EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION Final Report Otto von der Gablentz Europe Andrei Ples¸u Z˘elimir Z˘ilnik of the Reflection Group as a Geert Mak Michael Naumann of the European Cultural Foundation Krzysztof Pomian Cultural Sonja Licht Nasr Abu Zayd (2002-2004) Project Maarten van Veen Dragan Klaic Preface One of the ways in which foundations contribute to The Europe that inspired the ECF's founding fathers society is by helping to produce social and cultural as well as the Europe of the 'Eurocrats' are capital. Foundations are private bodies acting within substantially different from the European experience the public sphere, and as such they have an of the coming generation. Continuing the nautical obligation to society to be responsible in what they metaphor, one might say that the ECF, quite an try to achieve. That said, they also have a freedom elderly vessel, sails between prestigious traditions which is less available to public bodies: the freedom and prospective shores. Having taken upon itself a to take risks. Unhindered by cumbersome wide cultural remit, from policy development to the bureaucracy, foundations can invest in undertakings promotion of artistic projects, the ECF as an that are not a 'sure thing', but which have exciting admittedly small foundation runs the risk of getting prospects. They can look beyond day-to-day 'lost in translation' unless it remains constantly open operations to explore uncharted territory and and self-critical. anticipate new directions. All the more reason, then, to invite intellectuals, Yet reality can often be a barrier to reflection, artists, media figures, policy and business experts to organisational demands prevent risk-taking, and re-conceptualize the challenges facing Europe and, individual shortcomings limit the potential to consequently, the ECF. -

PDF Van Tekst
Lof van de lezing. Gids voor de 154 meest prestigieuze lezingen Maaike Grevelink bron Maaike Grevelink, Lof van de lezing. Gids voor de 154 meest prestigieuze lezingen. Elsevier, Amsterdam 2010 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/grev037lofv01_01/colofon.php © 2015 dbnl / Elsevier i.s.m. 11 Voorwoord In 2009 publiceerde Job Cohen een bundel beschouwingen met de voor hem typerende titel Binden. Na afloop van de presentatie gaf de burgemeester van Amsterdam toe dat zijn boek er nooit was geweest, als hij niet zo vaak was gevraagd om een lezing te houden. Uitnodigingen voor de Cleveringa-lezing, de Abel Herzberg-lezing, de H.M. van Randwijk-lezing en een tiental andere dwongen hem zijn gedachten over het opgegeven onderwerp te ordenen en een visie te formuleren. Na een dozijn redevoeringen heb je dan een mooie bundel beschouwingen. Maar voor bundeling zijn die lezingen natuurlijk niet in de eerste plaats bedoeld. Vaak wil een organisatie met een lezing een persoon eren. Zo ging het bij de redactie van Elsevier toen ze in 2009 de H.J. Schoo-lezing introduceerde, genoemd naar de in 2007 overleden voormalige hoofdredacteur van Elsevier, Hendrik Jan Schoo. Maar het komt ook voor dat een club graag jaarlijks aandacht wil besteden aan een thema dat anders onvoldoende wordt belicht. Zie de Burgemeesterslezing. In elk geval is in de loop van vier decennia in Nederland een mozaïek van thematische, veelal ‘prestigieuze’ lezingen ontstaan, die meestal zijn vernoemd naar een persoon. De Cleveringa-lezing is de oudste in dit boek, waarmee niet is gezegd dat vóór 1970 dit soort lezingen niet werd gehouden. -

The Roosevelt Review 2006
Rthe Roosevelt review Eleanor Roosevelt (left), Princess Juliana of the Netherlands (center) and Franklin D. Roosevelt, in the garden of the Roosevelt home at Hyde Park, New York in 1943, a personal friendship that typifies the warmth of Dutch-American relations. Twenty Years of Challenges and Achievements The year 2006 marked the RSC’s 20th launching of an electronic peer-reviewed anniversary celebration, coupled with its return academic journal, European Journal of to its newly renovated offices and library in the American Studies or EJAS by the European beautiful Middelburg Abbey—an exciting Association for American Studies (EAAS) moment for the staff and everyone who has deserves mention. As a major supporter of this ever visited, contributed to and participated in new venture, RSC staff members Cornelis A. the RSC’s activities. Anniversary speeches van Minnen, Hans Krabbendam, and Giles delivered by the president of the Royal Scott-Smith will serve as editors of the section Netherlands Academy of Arts and Sciences, on history, social sciences, and international Professor Frits van Oostrom, and the president relations for the first three years (see page 8). of the European Association for American Studies, Professor Marc Chénetier, clearly The RSC’s commitment to quality is also underscored the great appreciation for the visible in all its other recurring work, RSC’s commitment to scholarship and its place including the Theodore Roosevelt American Newsletter of in Europe which has increased considerably history awards, the Franklin D. Roosevelt the Roosevelt with the passage of time. Four Freedoms ceremony, the research grants Study Center and Fulbright scholar programs, its public Two new projects reflect the RSC’s ongoing lecture series and new book publications. -

German Historical Institute Washington, D.C. Occasional Paper No
German Historical Institute Washington, D.C. Occasional Paper No. 13 CORNERSTONE OF DEMOCRACY The West German Grundgesetz, 1949–1989 with Contributions by Erich J. C. Hahn Michaela Richter Gebhard Ziller David Clay Large CORNERSTONE OF DEMOCRACY The West German Grundgesetz, 1949–1989 Occasional Paper No. 13 ___________ Edited by Detlef Junker, Manfred E. Boemeke and Janine Micunek © Copyright 1995 Published by the GERMAN HISTORICAL INSTITUTE 1607 New Hampshire Avenue, N.W. Washington, D.C. 20009 Tel. (202) 387–3355 Contents Erich J. C. Hahn The Occupying Powers and the Constitutional Reconstruction of West Germany, 1945–1949 7 Michaela Richter The Basic Law and the Democratic Party State: Constitutional Theory and Political Practice 37 Gebhard Ziller Trends in the Development of Federalism under the Grundgesetz (Basic Law), 1949–1989 73 David Clay Large Normifying the Unnormifiable: The Right to Resistance in West German Constitutional History 83 Preface THE FIFTIETH ANNIVERSARY of the end of World War II is a time for commemoration and celebration, for remembrance and retrospection. It is a time to reflect on the results of this most destructive of all wars and to pay tribute to the victims of the Nazi terror, while also remembering the tremendous effort that went into rebuilding the political, economic, and social structures that had been shattered throughout Europe. In Germany, the shock of total military defeat and the liberation not only from a brutal dictatorship but also from a centuries-old mind-set that had paid uncritical obeisance to state authority resulted in the search for a new political orientation and a new constitutional foundation.