Gredleriana Vol
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Langourov Et Al 2018 Inventory of Selected Groups.Pdf
ACTA ZOOLOGICA BULGARICA Zoogeography and Faunistics Acta zool. bulg., 70 (4), 2018: 487-500 Research Article Inventory of Selected Groups of Invertebrates in Sedge and Reedbeds not Associated with Open Waters in Bulgaria Mario Langourov1, Nikolay Simov1, Rostislav Bekchiev1, Dragan Chobanov2, Vera Antonova2 & Ivaylo Dedov2 1 National Museum of Natural History – Sofia, Bulgarian Academy of Sciences, 1 Tsar Osvoboditel Blvd., 1000 Sofia, Bulgaria; E-mails: [email protected], [email protected], [email protected] 2 Institute of Biodiversity and Ecosystem Research, Bulgarian Academy of Sciences, 2 Gagarin Street, 1113 Sofia, Bulgaria; E-mails: [email protected], [email protected], [email protected] Abstract: Inventory of selected groups of the invertebrate fauna in the EUNIS wetland habitat type D5 “Sedge and reedbeds normally without free-standing water” in Bulgaria was carried out. It included 47 locali- ties throughout the country. The surveyed invertebrate groups included slugs and snails (Gastropoda), dragonflies (Odonata), grasshoppers (Orthoptera), true bugs (Heteroptera), ants (Formicidae), butterflies (Lepidoptera) and some coleopterans (Staphylinidae: Pselaphinae). Data on the visited localities, identi- fied species and their conservation status are presented. In total, 316 species of 209 genera and 68 families were recorded. Fifty species were identified as potential indicator species for this wetland habitat type. The highest species richness (with more than 50 species) was observed in wetlands near Marino pole (Plovdiv District) and Karaisen (Veliko Tarnovo District). Key words: Gastropoda, Odonata, Orthoptera, Heteroptera, Formicidae, Lepidoptera, Pselaphinae, wetland. Introduction According to the EUNIS Biodiversity Database, all known mire and spring complex according to the wetlands (mires, bogs and fens) are territories with occurrence of rare and threaten plant and mollusc water table at or above ground level for at least half species. -
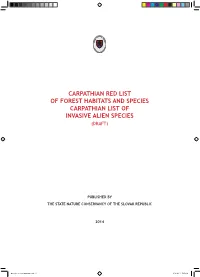
Draft Carpathian Red List of Forest Habitats
CARPATHIAN RED LIST OF FOREST HABITATS AND SPECIES CARPATHIAN LIST OF INVASIVE ALIEN SPECIES (DRAFT) PUBLISHED BY THE STATE NATURE CONSERVANCY OF THE SLOVAK REPUBLIC 2014 zzbornik_cervenebornik_cervene zzoznamy.inddoznamy.indd 1 227.8.20147.8.2014 222:36:052:36:05 © Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2014 Editor: Ján Kadlečík Available from: Štátna ochrana prírody SR Tajovského 28B 974 01 Banská Bystrica Slovakia ISBN 978-80-89310-81-4 Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce Swiss-Slovak Cooperation Programme Slovenská republika This publication was elaborated within BioREGIO Carpathians project supported by South East Europe Programme and was fi nanced by a Swiss-Slovak project supported by the Swiss Contribution to the enlarged European Union and Carpathian Wetlands Initiative. zzbornik_cervenebornik_cervene zzoznamy.inddoznamy.indd 2 115.9.20145.9.2014 223:10:123:10:12 Table of contents Draft Red Lists of Threatened Carpathian Habitats and Species and Carpathian List of Invasive Alien Species . 5 Draft Carpathian Red List of Forest Habitats . 20 Red List of Vascular Plants of the Carpathians . 44 Draft Carpathian Red List of Molluscs (Mollusca) . 106 Red List of Spiders (Araneae) of the Carpathian Mts. 118 Draft Red List of Dragonfl ies (Odonata) of the Carpathians . 172 Red List of Grasshoppers, Bush-crickets and Crickets (Orthoptera) of the Carpathian Mountains . 186 Draft Red List of Butterfl ies (Lepidoptera: Papilionoidea) of the Carpathian Mts. 200 Draft Carpathian Red List of Fish and Lamprey Species . 203 Draft Carpathian Red List of Threatened Amphibians (Lissamphibia) . 209 Draft Carpathian Red List of Threatened Reptiles (Reptilia) . 214 Draft Carpathian Red List of Birds (Aves). 217 Draft Carpathian Red List of Threatened Mammals (Mammalia) . -

Les Mollusques Continentaux De La Région Nord-Pas-De-Calais Liste Des Espèces, Échantillonnage Et Base De Données
Université des Sciences et Technologies de Lille – U.F.R. de Biologie Année 2003 n°ordre Diplôme Supérieur de Recherche en Sciences Naturelles Présenté et soutenu publiquement par XAVIER CUCHERAT le 2 juillet 2003 Les Mollusques Continentaux de la Région Nord-Pas-de-Calais Liste des espèces, Échantillonnage et Base de Données Jury PR. M. DESCAMPS Université de Lille I Président DR. A. LEPRETRE Université de Lille I Rapporteur DR. S. DEMUYNCK Université de Lille I Examinateur DR. J. GODIN Université de Lille I Examinateur DR. J. PRYGIEL Agence de l’Eau Artois-Picardie Examinateur Université des Sciences et Technologies de Lille – U.F.R. de Biologie Année 2003 n°ordre Diplôme Supérieur de Recherche en Sciences Naturelles Présenté et soutenu publiquement par XAVIER CUCHERAT le 2 juillet 2003 Les Mollusques Continentaux de la Région Nord-Pas-de-Calais Liste des espèces, Échantillonnage et Base de Données Arion rufus (LINNAEUS 1758) Lymnaea stagnalis (LINNAEUS 1758) Adultes en parade nuptiale / Forêt Domaniale Adulte / dunes d’Erdeven / Erdeven de Mormal / Locquignol (Nord). 09/2001. (Morbihan). 05/2001. Taille des individus : 90 mm. Taille de l’individu : 60 mm. Photo : GUILLAUME EVANNO Photo : GUILLAUME EVANNO Malacolimax tenellus (O. F. MÜLLER 1774) Cepaea nemoralis nemoralis (LINNAEUS Adulte / Forêt Domaniale de Mormal / 1758) Locquignol (Nord). 09/2001. Adulte / Guebwiller (Haut-Rhin). 04/2003. Taille de l’individu : 35 mm. Taille de l’individu : 25mm. Photo : GUILLAUME EVANNO Photo : ALAIN LEPRETRE Jury PR. M. DESCAMPS Université de Lille I Président DR. A. LEPRETRE Université de Lille I Rapporteur DR. S. DEMUYNCK Université de Lille I Examinateur DR. -

Malakológiai Tájékoztató 11. (Eger, 1992.)
M ALAKOLÓGI AI TÁJÉKOZTATÓ 11. MALACOLOGICAL NEWSLETTER • Kiadja a MÁTRA MÚZEUM TERMÉSZETTUDOMÁNYI OSZTÁLYA Published by THE NATURAL SCIENCE SECTION OF MÁTRA MUSEUM Szerkesztő (Editor) Dr. FÜKÖH LEVENTE HU - ISSN 0230-0648 Distribution of Molluscs of the Molluscan Clay of Two Localities According to Habitats and Feeding Habits (Wind Brickyard, Eger and Nyárjas Hill. Novaj; Hungary) A. Dávid Abstract: Among the Egerian Age exposures of North-east Hungary the Molluscan Clay of Wind Brickyard (Eger) and Nyárjas Hill (Novaj) contain fossils in exceptional richness. Distribution of molluscs of the Molluscan Clay of these two outcrops according to habitats and feeding habits is examined and compared. There are definite differences between the two localities. Introduction Among the several Upper-Oligocene outrops of North-Hungary the Molluscan Clay layers «f _Wind Brickyard, Eger and Nyárjas Hill, Novaj is compared (Fig.l.). These layers contain well-preserved „micro-mollusc" fossils abudantly. The bivalves, gastropods and schaphopods which were living here during the Egerian stage have belonged into the Hinia — Cadulus fossil community. It refers to similar paleoenvironments in case of both localities. The sea was deeper than 120 metres and the bottom was covered by fine-gra ined, clayey sediments. The aim of the investigation was to examine the distribution of the molluscs according to habitats and feeding habits in the collected materials. Methods Fifteen kilograms of clay was taken from both localities. After drying the samples were treated with hot water and peroxide of hydrogen. This material was washed out through a 0,5 nun sieve. At the end the molluscan remains were assorted from among the other fossils (e.gJ^oraminifera, Decapoda, Echinoidea, Osteichthyes). -

Міністерство Екології Та Природних Ресурсів України Наказ 27.06.2018 № 237 Зареєстровано В Міністерстві Юстиції України 19 Липня 2018 Р
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ НАКАЗ 27.06.2018 № 237 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 липня 2018 р. за № 847/32299 Про затвердження Переліку видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області Відповідно до статті 44 Закону України "Про тваринний світ", абзацу двадцять другого підпункту 37 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року № 32, та з метою охорони, використання і відтворення видів тварин, які не занесені до Червоної книги України, але мають особливу наукову, природоохоронну та іншу цінність, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Перелік видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Харківської області (далі - Перелік), що додається. 2. Державній екологічній інспекції України (Яковлєв І.О.) забезпечити контроль за охороною, раціональним використанням і відтворенням видів тварин, занесених до Переліку. 3. Управлінню охорони біорізноманіття та біобезпеки (Богданович Г.В.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра екології та природних ресурсів України Полуйка В.Ю. Заступник Міністра В.М. Вакараш ПОГОДЖЕНО: В.о. Голови Державної екологічної інспекції України І.О. Яковлєв Президент Національної академії наук України академік НАН України Б.Є. Патон Перший заступник Міністра аграрної -

Klicken, Um Den Anhang Zu Öffnen
Gredleria- VOL. 1 / 2001 Titelbild 2001 Posthornschnecke (Planorbarius corneus L.) / Zeichnung: Alma Horne Volume 1 Impressum Volume Direktion und Redaktion / Direzione e redazione 1 © Copyright 2001 by Naturmuseum Südtirol Museo Scienze Naturali Alto Adige Museum Natöra Südtirol Bindergasse/Via Bottai 1 – I-39100 Bozen/Bolzano (Italien/Italia) Tel. +39/0471/412960 – Fax 0471/412979 homepage: www.naturmuseum.it e-mail: [email protected] Redaktionskomitee / Comitato di Redazione Dr. Klaus Hellrigl (Brixen/Bressanone), Dr. Peter Ortner (Bozen/Bolzano), Dr. Gerhard Tarmann (Innsbruck), Dr. Leo Unterholzner (Lana, BZ), Dr. Vito Zingerle (Bozen/Bolzano) Schriftleiter und Koordinator / Redattore e coordinatore Dr. Klaus Hellrigl (Brixen/Bressanone) Verantwortlicher Leiter / Direttore responsabile Dr. Vito Zingerle (Bozen/Bolzano) Graphik / grafica Dr. Peter Schreiner (München) Zitiertitel Gredleriana, Veröff. Nat. Mus. Südtirol (Acta biol. ), 1 (2001): ISSN 1593 -5205 Issued 15.12.2001 Druck / stampa Gredleriana Fotolito Varesco – Auer / Ora (BZ) Gredleriana 2001 l 2001 tirol Die Veröffentlichungsreihe »Gredleriana« des Naturmuseum Südtirol (Bozen) ist ein Forum für naturwissenschaftliche Forschung in und über Südtirol. Geplant ist die Volume Herausgabe von zwei Wissenschaftsreihen: A) Biologische Reihe (Acta Biologica) mit den Bereichen Zoologie, Botanik und Ökologie und B) Erdwissenschaftliche Reihe (Acta Geo lo gica) mit Geologie, Mineralogie und Paläontologie. Diese Reihen können jährlich ge mein sam oder in alternierender Folge erscheinen, je nach Ver- fügbarkeit entsprechender Beiträge. Als Publikationssprache der einzelnen Beiträge ist Deutsch oder Italienisch vorge- 1 Naturmuseum Südtiro sehen und allenfalls auch Englisch. Die einzelnen Originalartikel erscheinen jeweils Museum Natöra Süd Museum Natöra in der eingereichten Sprache der Autoren und sollen mit kurzen Zusammenfassun- gen in Englisch, Italienisch und Deutsch ausgestattet sein. -

Методика За Мониторинг На Малки Сухоземни Охлюви, Stylommatophora (1)
НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ Методика за мониторинг на малки сухоземни охлюви, Stylommatophora (1) I. Обекти на мониторинга Тип: Mollusca Клас: Gastropoda Разред: Stylommatophora Семейство: Valloniidae Vallonia enniensis (Gredler 1856) Семейство: Vertiginidae Vertigo (Vertigo) moulinsiana (Dupuy 1849) Vertigo (Vertilla) angustior Jeffreys 1830 II. Описание на обектите НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 1. Разпространение в Vallonia enniensis: в България е съобщавана за: Северното Черноморие (Варна и околностите; дюни северно от Несебър, България района на “Янкови кашли”); Тракийската низина (наносите на река Марица до Пловдив); Родопите; Средна Гора (с. Дюлево; Панагюрище) и Западна България. (A. Wagner (1927), Urbanski (1960), Дамянов и Лихарев (1975), Georgiev & Stoycheva (2009)). Общо разпространение: Европа (Австрия, Балеарските острови, Германия, Гърция, Латвия, Люксембург, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Чехия, Южна и Източна Испания, Северна Италия, Швеция, Швейцария), в т.ч. Балканите (Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Сърбия, Хърватия, Черна гора), както и Турция и Египет. Vertigo moulinsiana: в България е съобщавана за: Северното Черноморие (с. Топола, Варненско; с. Белослав, Варненско); Тракийската низина (Пловдивско, поречието на река Марица) и Северно от Стара планина (A. Wagner (1927), Urbanski (1960 a), Дамянов и Лихарев (1975)). Дамянов и Лихарев (1975) споменават вида за цялото Черноморие, но няма посочени конкретни находища, нито последващи достоверни данни, потвърждаващи това предположение. Общо разпространение: Европа (Австрия, Балеарските острови, Беларус, Белгия, Британия, Германия, Гърция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Литва, Молдова, Полша, Румъния, Сардиния, Словакия, Украйна, Унгария, Франция, Холандия, Чехия, Швеция, Швейцария), Балканите (България, Хърватия), както и Южна Армения. Vertigo angustior: в България е съобщаван за: Пловдивско (поречието на река Марица), Варненско (с. Белослав, Варненско, курорта Златни пясъци) и Бургаско (A. -

Especies Dudosas, Por Confirmar Y Extintas
ESPECIES DUDOSAS, POR CONFIRMAR Y EXTINTAS FUNGI LICHENES , L ICHENICO L OUS F UNGI BRYOPHYTA SPERMATOPHYTA ANNE L IDA NEMATODA MO ll USCA ARTHROPODA CHORDATA ESPECIES DUDOSAS, POR CONFIRMAR Y EXTINTAS Tachygonetria palmarum González Lama, López-Orge, Astasio-Arbiza, Zapatero-Ramos & Martínez-Fernández, 1981 (Secernentea, Oxyurida, Pharyngodonidae) Thelandros zoiloi López-Orge, González Lama, Astasio-Arbiza, Zapatero-Ramos & Martínez-Fernández, 1981 (Secernentea, Oxyurida, Pharyngodonidae) Phylum Mollusca Taxones cuya presencia en Canarias está pendiente de confirmación Galba cubensis (Pfeiffer, 1839) (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) Gyraulus parvus (Say, 1817) (Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) Vallonia enniensis (Gredler, 1856) (Gastropoda, Pulmonata, Valloniidae) Taxones extintos en Canarias Canariella pontelira Hutterer, 1994 (Gastropoda, Pulmonata, Hygromiidae) Hemicycla semitecta (Mousson, 1872) (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) Phylum Arthropoda Taxones de presencia dudosa en Canarias Aulacoderus canariensis ssp. bucheti (Pic, 1908) (Insecta, Coleoptera, Anthicidae) Bruchidius villosus (Fabricius, 1792) (Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae) Callophrys rubi (Linnaeus, 1758) (Insecta, Lepidoptera, Lycaenidae) Carabus gomerae Müller, 2004 (Insecta, Coleoptera, Carabidae) Coriomeris hirticornis (Fabricius, 1794) (Insecta, Hemiptera, Coreidae) Corticarina similata Gyllenhal, 1827 (Insecta, Coleoptera, Latridiidae) Cyphopterum fauveli (Noualhier, 1897) (Insecta, Hemiptera, Flatidae) Cyrtosia nitens Loew, 1846 (Insecta, Diptera, Mythicomyiidae) -

Liste De Référence Annotée Des Mollusques D'alsace (France) Annotated Checklist of the Continental Molluscs from Alsace (France)
MalaCo (2013) 9, 498-534 Liste de référence annotée des mollusques d'Alsace (France) Annotated checklist of the continental molluscs from Alsace (France) 1 2 Jean-Michel BICHAIN & STEPHANE ORIO 1 7 chemin du Moenchberg, 68140 Munster 2 1 rue du fossé, 67520 Marlenheim Correspondance : [email protected] Résumé – Le catalogue des mollusques d'Alsace de Devidts (1979) a été ici réactualisé en suivant le référentiel taxonomique proposé par Gargominy et al. (2011) et par ajout des données de la littérature, naturalistes et muséographiques. Alors que Devidts citait 155 taxons terminaux et 22 incertains pour la région, la présente mise à jour fait état de 206 taxons terminaux dont 138 terrestres et 68 aquatiques. Plus de 50 % de ces nouveautés proviennent des inventaires menés entre 1988 et 1998 par F. Geissert. Parmi cette faune alsacienne, qui compte presqu'un tiers du nombre total de taxons de France, 47 sont des endémiques européens dont deux micro- endémiques (Belgrandia gfrast Haase, 2000 et Trochulus clandestinus putonii (Clessin, 1874)). Par ailleurs, cinq espèces sont présentes en France uniquement en Alsace, alors que trois autres ne sont présentes que dans le grand est. Cinq espèces sont considérées comme disparues de la région, leur présence n'ayant pas été confirmée depuis plus d'un siècle pour la plupart d’entre elles. Alors que l'endémisme régional est très faible, la richesse spécifique de cette malacofaune s'explique cependant par la diversité des habitats en Alsace et par sa position de carrefour biogéographique entre les domaines atlantique, continental et boréo-alpin. Mots-clefs – Alsace, France, liste de référence, mollusques continentaux. -

Malakologische Notizen Aus Nord-, Ost- Und Südtirol
ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum Jahr/Year: 2001 Band/Volume: 81 Autor(en)/Author(s): Nisters Helmut Artikel/Article: Malakologische Notizen aus Nord-, Ost- und Südtirol. 155-194 © Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, Innsbruck download unter www.biologiezentrum.at VeröfTenllichimsien des Tiroler Landcsmuscunis Fcrdinandcum 81/2001 Innsbruck 2001 155-194 Malakologische Notizen aus Nord-, Ost- und Südtirol Helmut Nisters1 Malacological notes from the Tyrol and Alto Adige (Northern Italy) Zusammenfassung: Eine Übersicht über die Malakologie Gesamtlirols mit ausführlicher Artenliste. Habilatsangaben und Literatur- verzeichnis wird dargeboten. Eine kurze Geschichte der Forschung ist ebenfalls enthalten. Abstract: A review concerning the malacological science with a nearly complete checklist. indications of biotops and lite- rature is presenled. A brief history of Tyrolean malacologists is added. Keywords: Gastropoda, Bivalvia. Tyrol Einleitung Nach diversen entomologischen und anderen zoologischen wie botanischen Beitragen der Natur- wissenschaften in den Veröffentlichungen des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum wird hier eine weitere umfangreiche und bedeutende Tiergruppe unserer Heimat vorgestellt, die Schnecken und Muscheln . Der vorliegende Bericht erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dennoch wurde versucht, einen Überblick über Faunistik (Artenliste mit -

Liste De Référence Fonctionnelle Et Annotée Des Mollusques Continentaux (Mollusca : Gastropoda & Bivalvia) Du Grand-Est (France)
naturae 2019 ● 11 Liste de référence fonctionnelle et annotée des Mollusques continentaux (Mollusca : Gastropoda & Bivalvia) du Grand-Est (France) Jean-Michel BICHAIN, Xavier CUCHERAT, Hervé BRULÉ, Thibaut DURR, Jean GUHRING, Gérard HOMMAY, Julien RYELANDT & Kevin UMBRECHT art. 2019 (11) — Publié le 19 décembre 2019 www.revue-naturae.fr DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Bruno David, Président du Muséum national d’Histoire naturelle RÉDACTEUR EN CHEF / EDITOR-IN-CHIEF : Jean-Philippe Siblet ASSISTANTE DE RÉDACTION / ASSISTANT EDITOR : Sarah Figuet ([email protected]) MISE EN PAGE / PAGE LAYOUT : Sarah Figuet COMITÉ SCIENTIFIQUE / SCIENTIFIC BOARD : Luc Abbadie (UPMC, Paris) Luc Barbier (Parc naturel régional des caps et marais d’Opale, Colembert) Aurélien Besnard (CEFE, Montpellier) Vincent Boullet (Expert indépendant flore/végétation, Frugières-le-Pin) Hervé Brustel (École d’ingénieurs de Purpan, Toulouse) Patrick De Wever (MNHN, Paris) Thierry Dutoit (UMR CNRS IMBE, Avignon) Éric Feunteun (MNHN, Dinard) Romain Garrouste (MNHN, Paris) Grégoire Gautier (DRAAF Occitanie, Toulouse) Olivier Gilg (Réserves naturelles de France, Dijon) Frédéric Gosselin (Irstea, Nogent-sur-Vernisson) Patrick Haffner (UMS PatriNat, Paris) Frédéric Hendoux (MNHN, Paris) Xavier Houard (OPIE, Guyancourt) Isabelle Leviol (MNHN, Concarneau) Francis Meunier (Conservatoire d’espaces naturels – Picardie, Amiens) Serge Muller (MNHN, Paris) Francis Olivereau (DREAL Centre, Orléans) Laurent Poncet (UMS PatriNat, Paris) Nicolas Poulet (AFB, Vincennes) Jean-Philippe Siblet (UMS -

Narrow Environmental Niches Predict Land-Use Responses And
Wehner et al. BMC Ecol Evo (2021) 21:15 BMC Ecology and Evolution https://doi.org/10.1186/s12862-020-01741-1 RESEARCH ARTICLE Open Access Narrow environmental niches predict land-use responses and vulnerability of land snail assemblages Katja Wehner1* , Carsten Renker2, Nadja K. Simons1, Wolfgang W. Weisser3 and Nico Blüthgen1 Abstract Background: How land use shapes biodiversity and functional trait composition of animal communities is an impor- tant question and frequently addressed. Land-use intensifcation is associated with changes in abiotic and biotic con- ditions including environmental homogenization and may act as an environmental flter to shape the composition of species communities. Here, we investigated the responses of land snail assemblages to land-use intensity and abiotic soil conditions (pH, soil moisture), and analyzed their trait composition (shell size, number of ofspring, light prefer- ence, humidity preference, inundation tolerance, and drought resistance). We characterized the species’ responses to land use to identify ‘winners’ (species that were more common on sites with high land-use intensity than expected) or ‘losers’ of land-use intensity (more common on plots with low land-use intensity) and their niche breadth. As a proxy for the environmental ‘niche breadth’ of each snail species, based on the conditions of the sites in which it occurred, we defned a 5-dimensional niche hypervolume. We then tested whether land-use responses and niches contribute to the species’ potential vulnerability suggested by the Red List status. Results: Our results confrmed that the trait composition of snail communities was signifcantly altered by land-use intensity and abiotic conditions in both forests and grasslands.